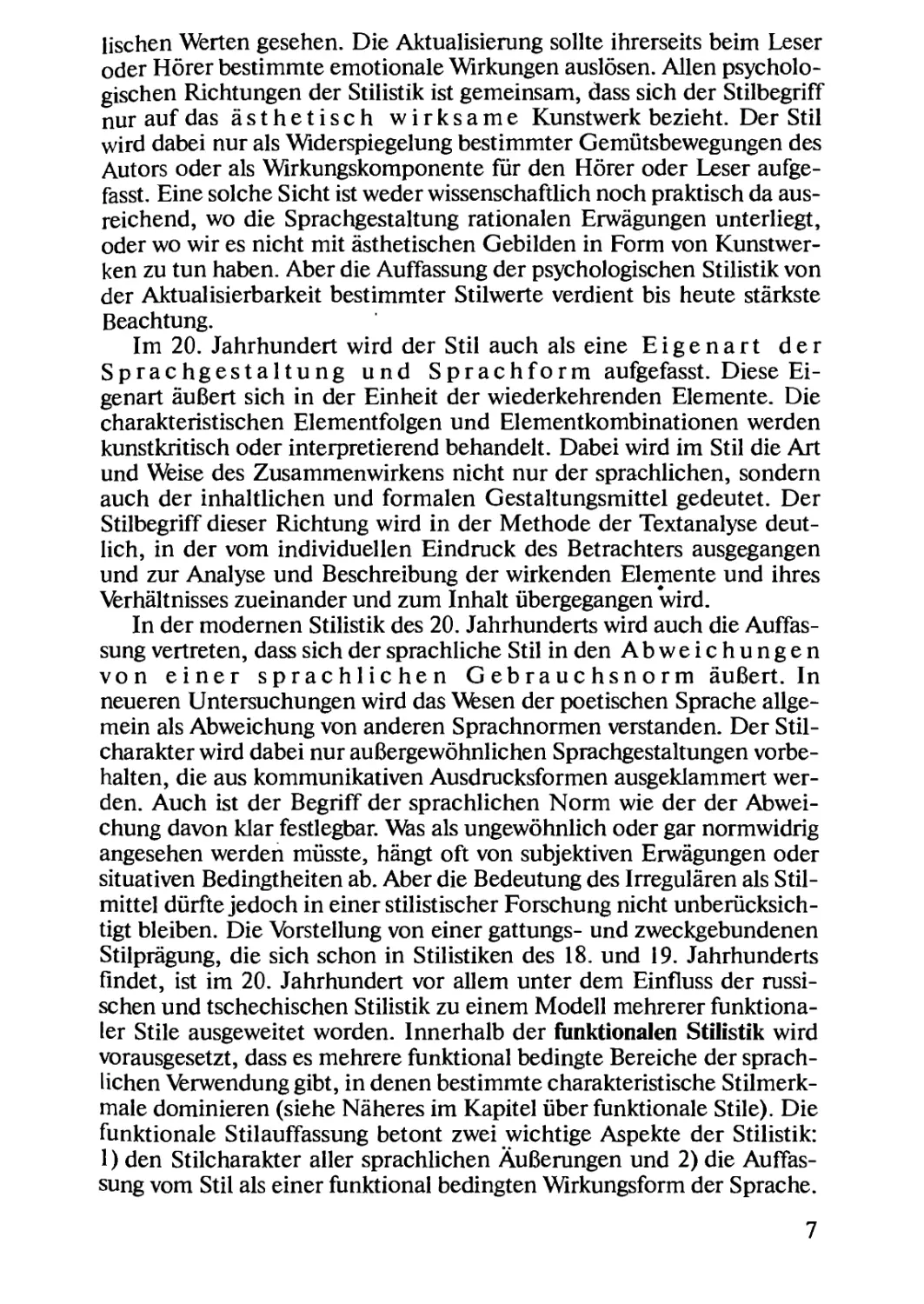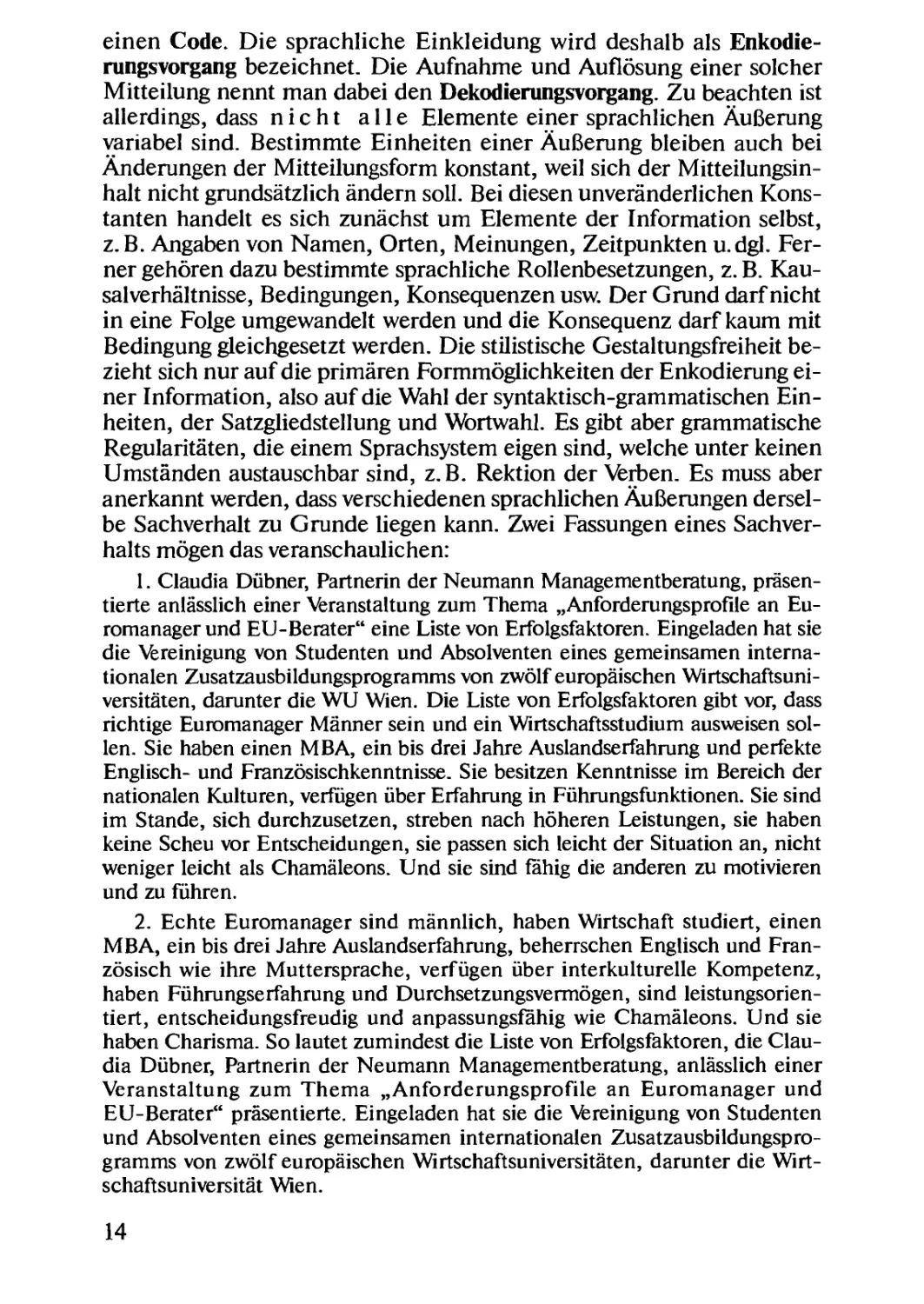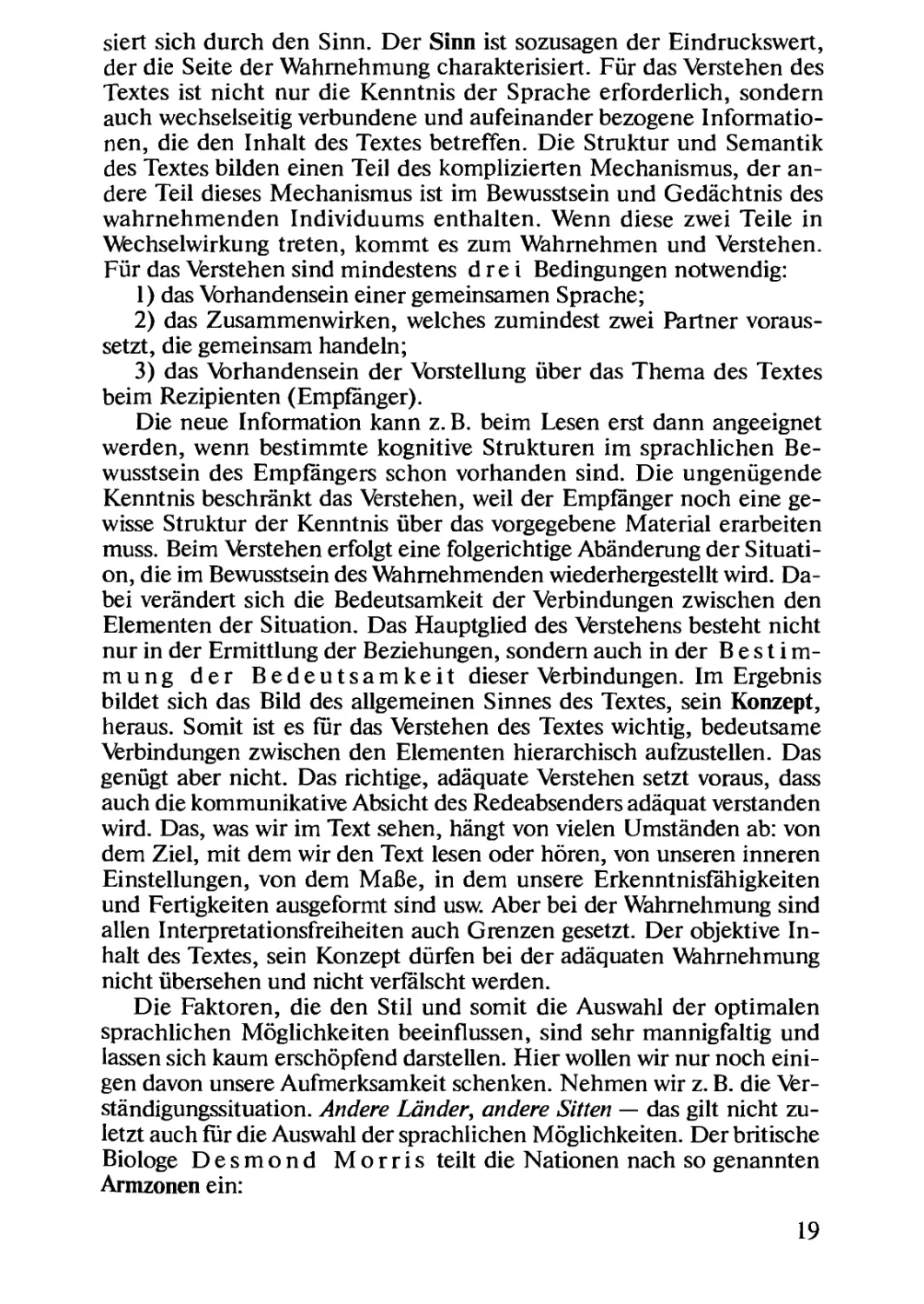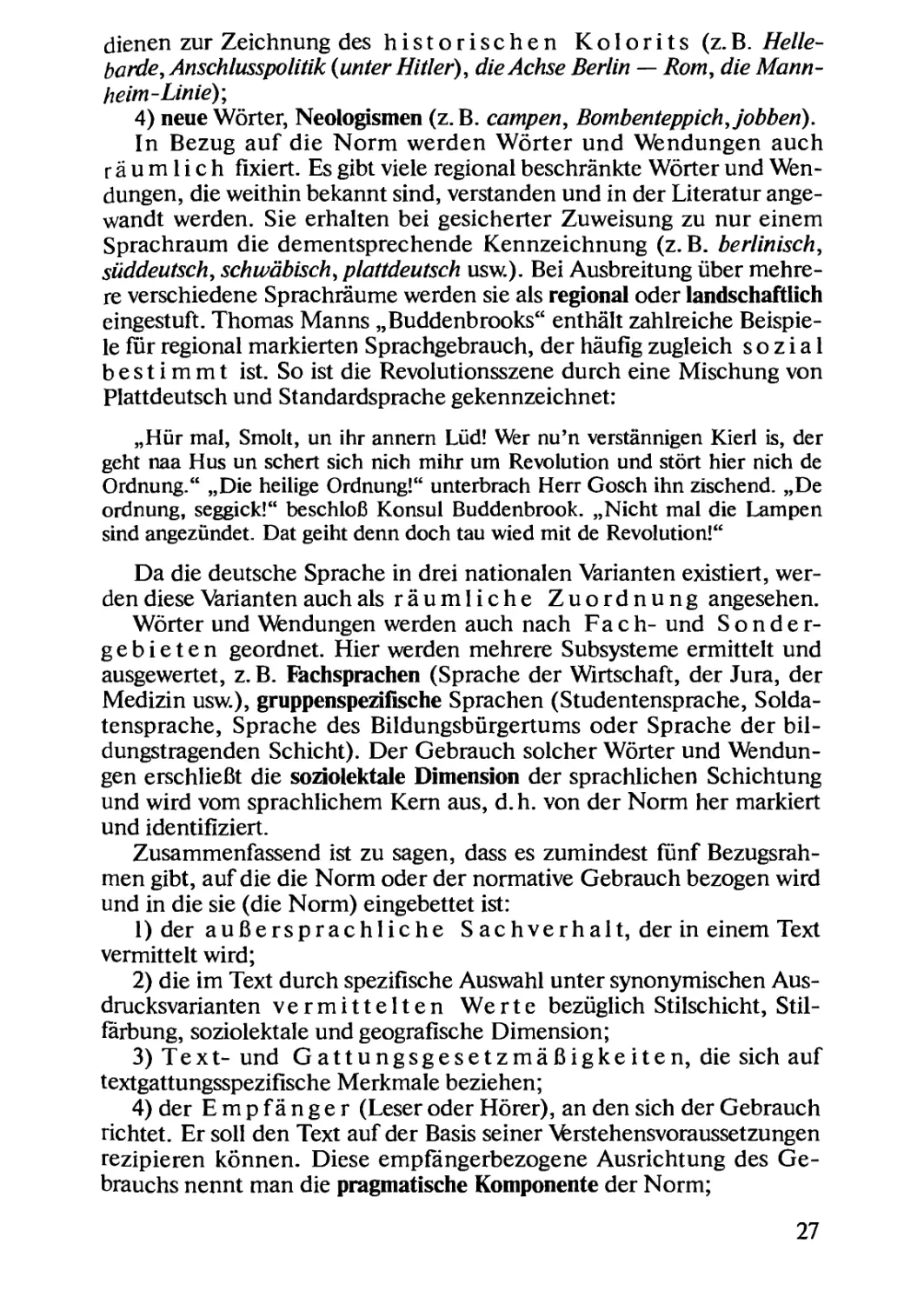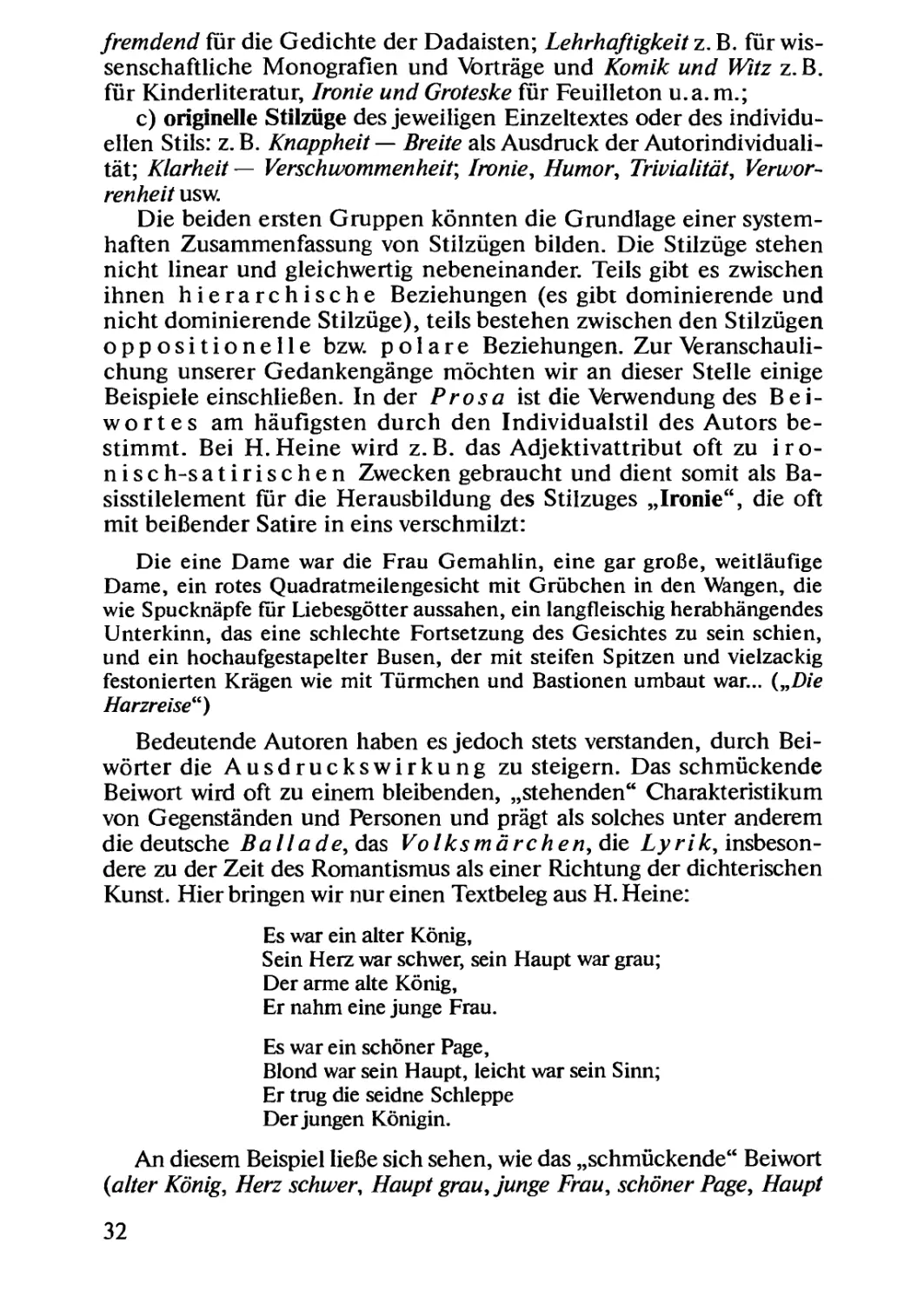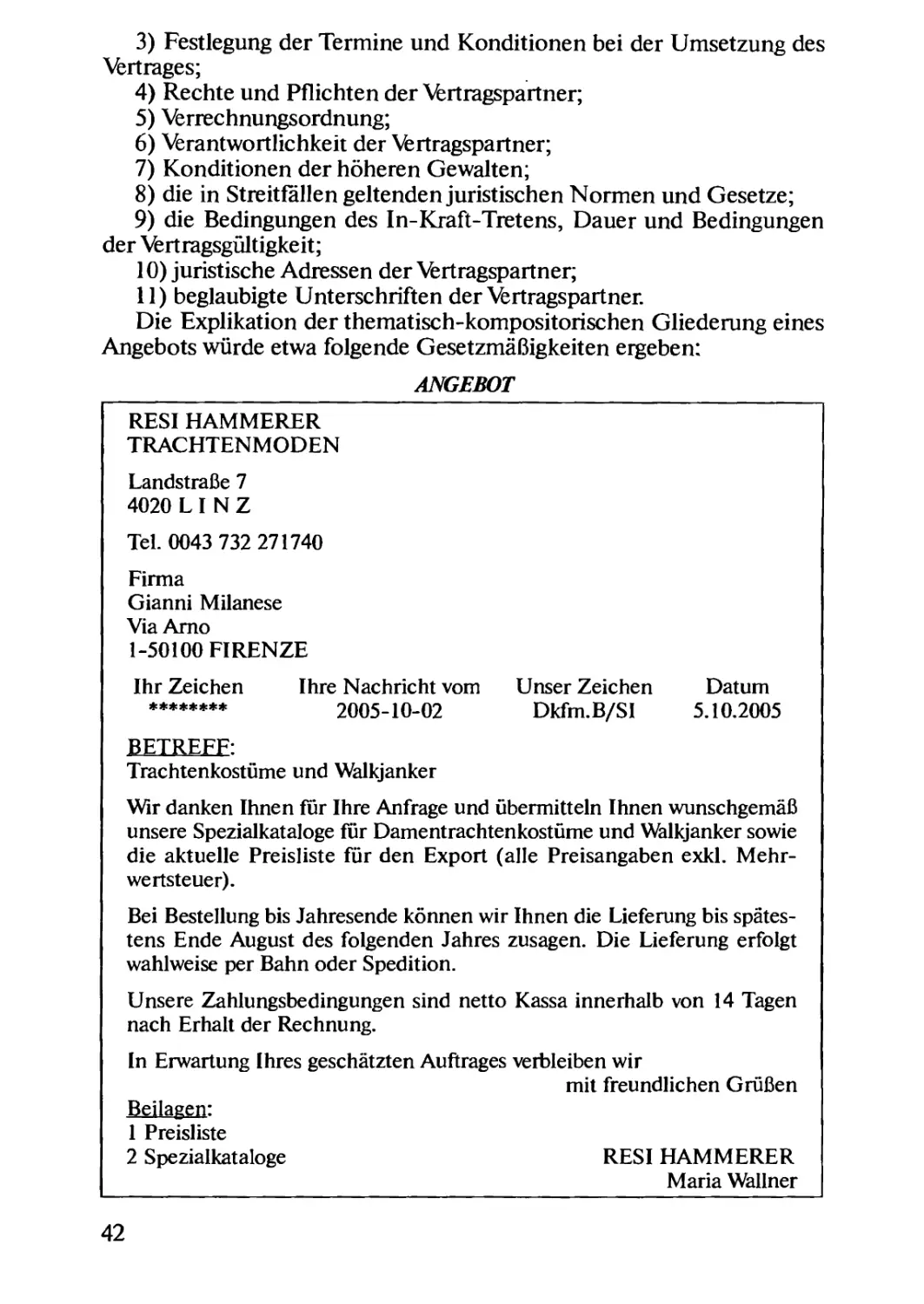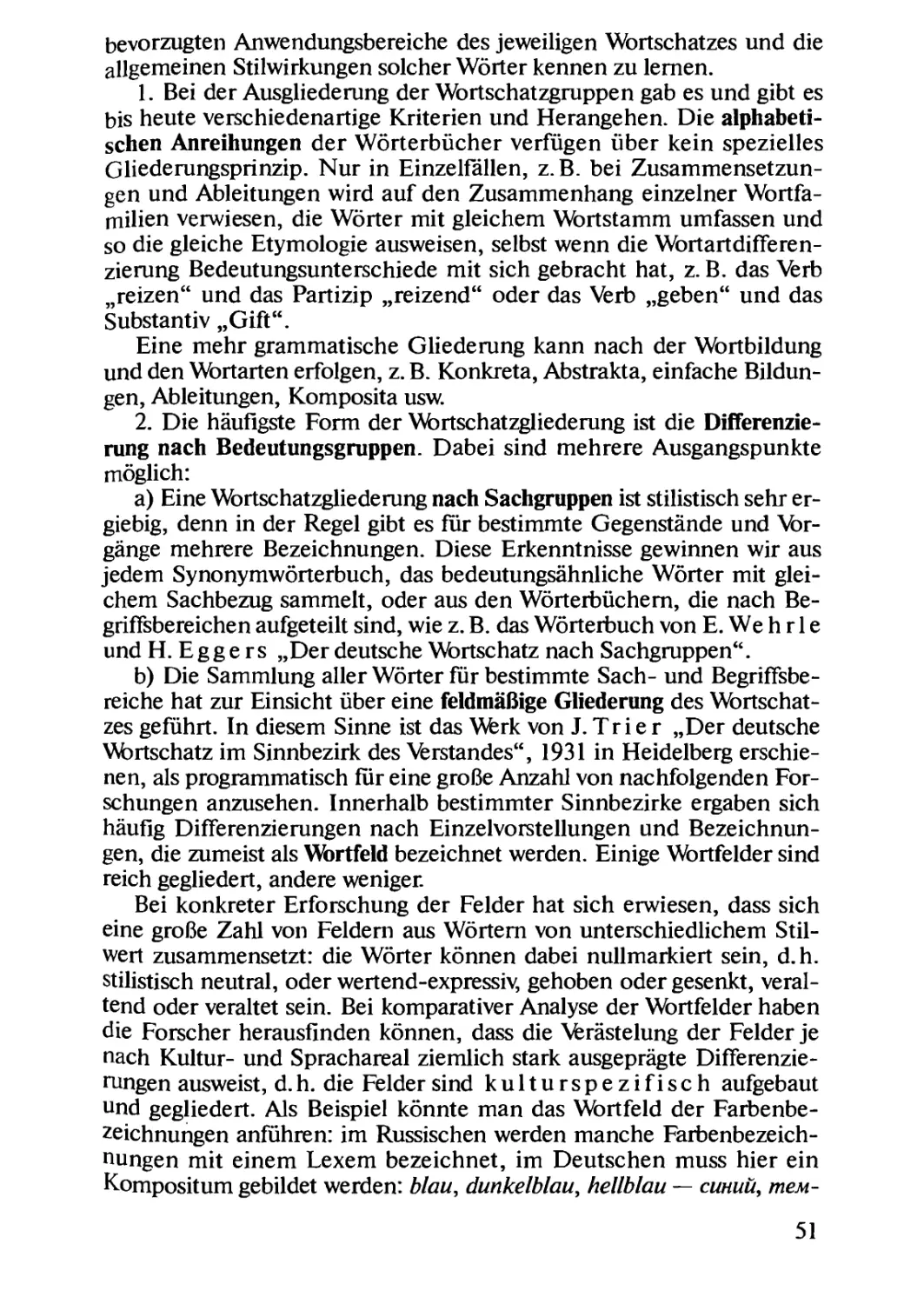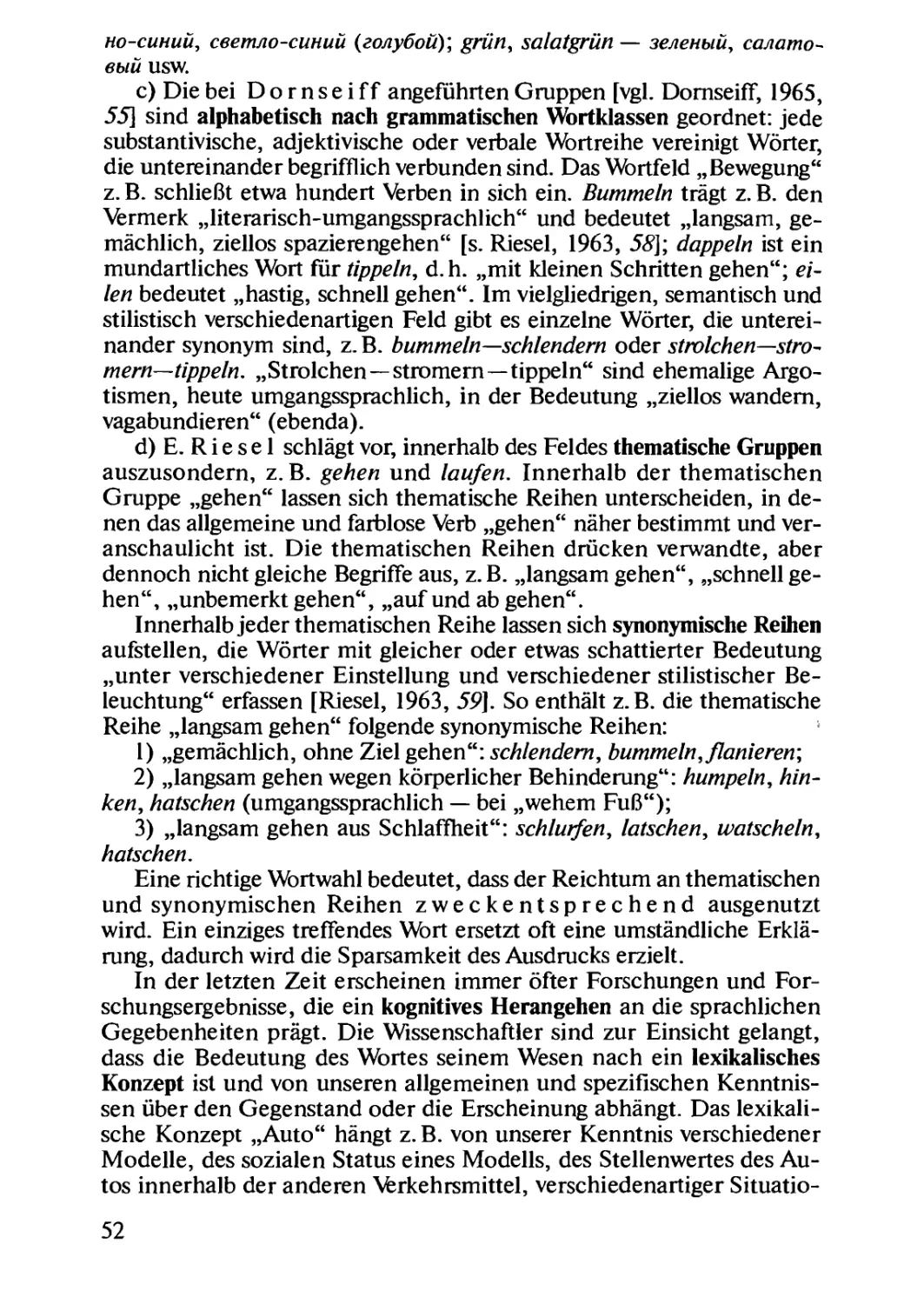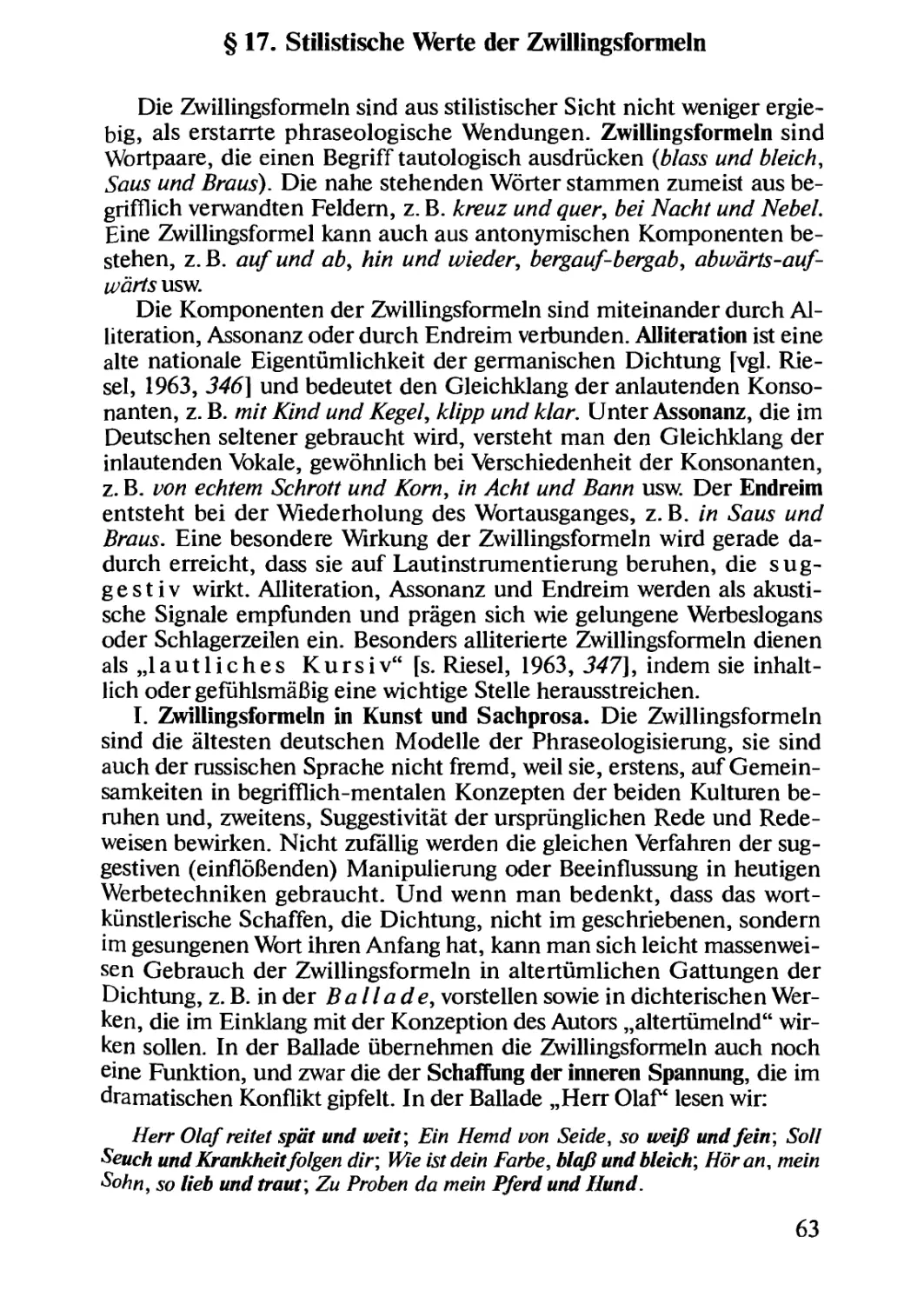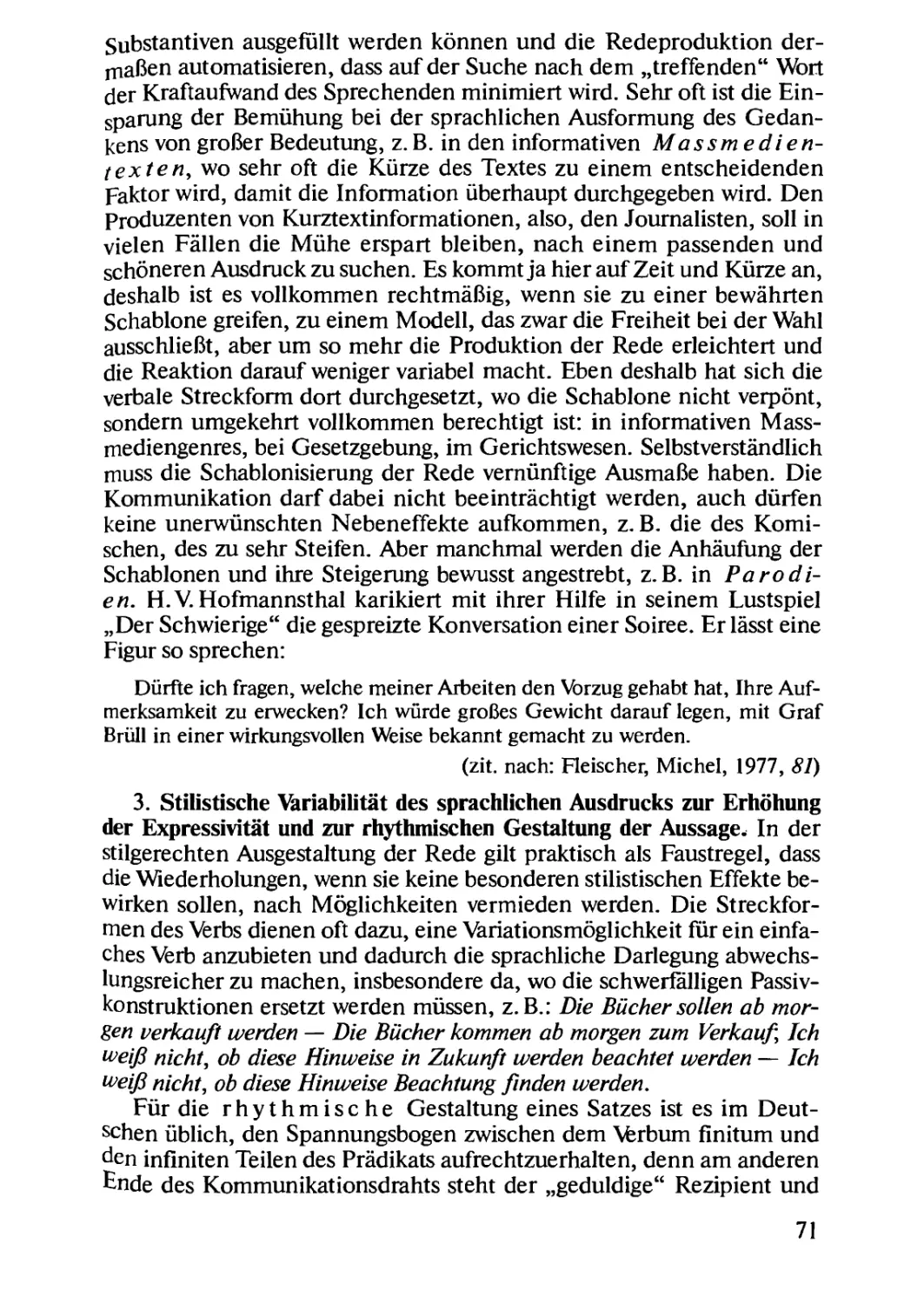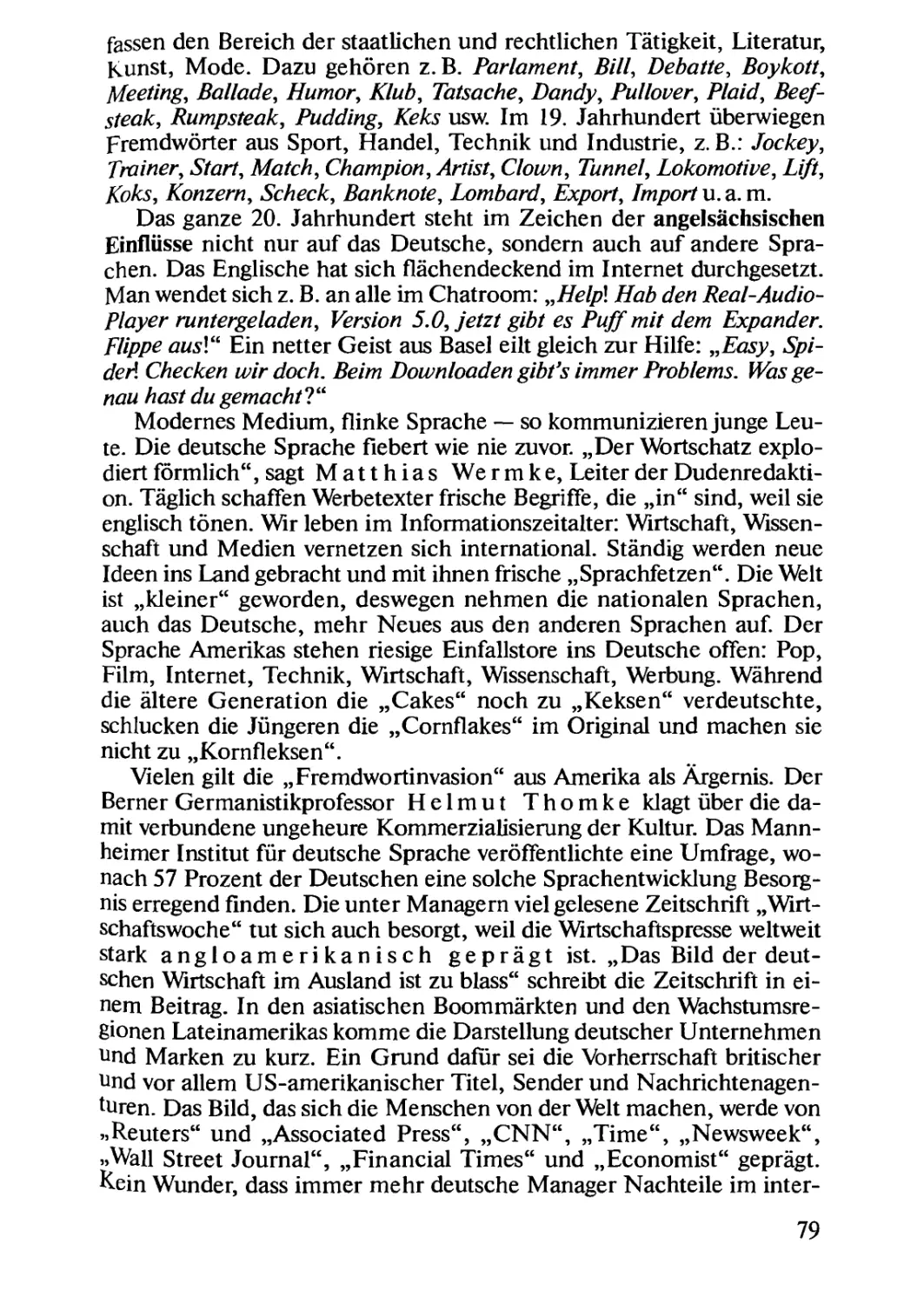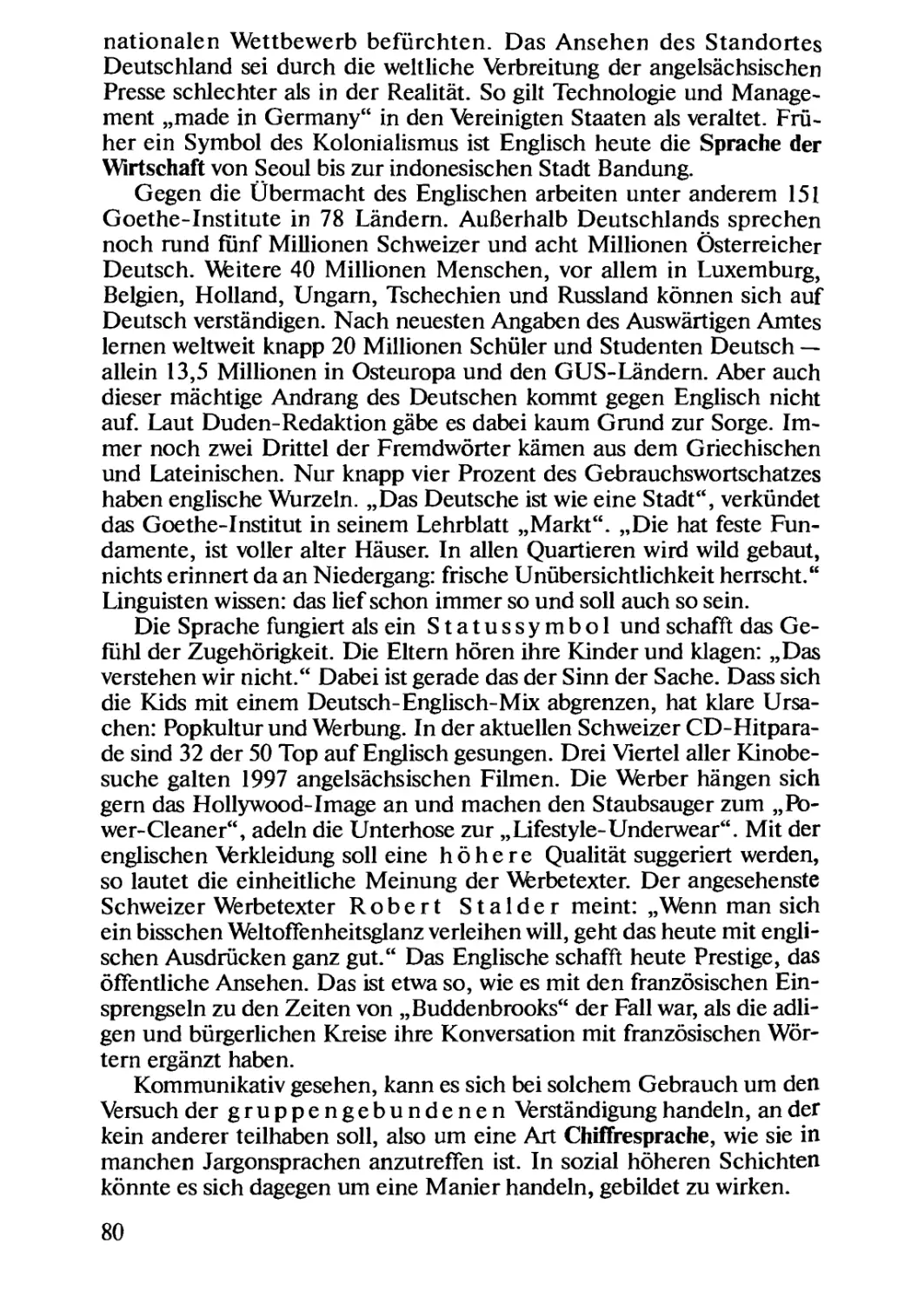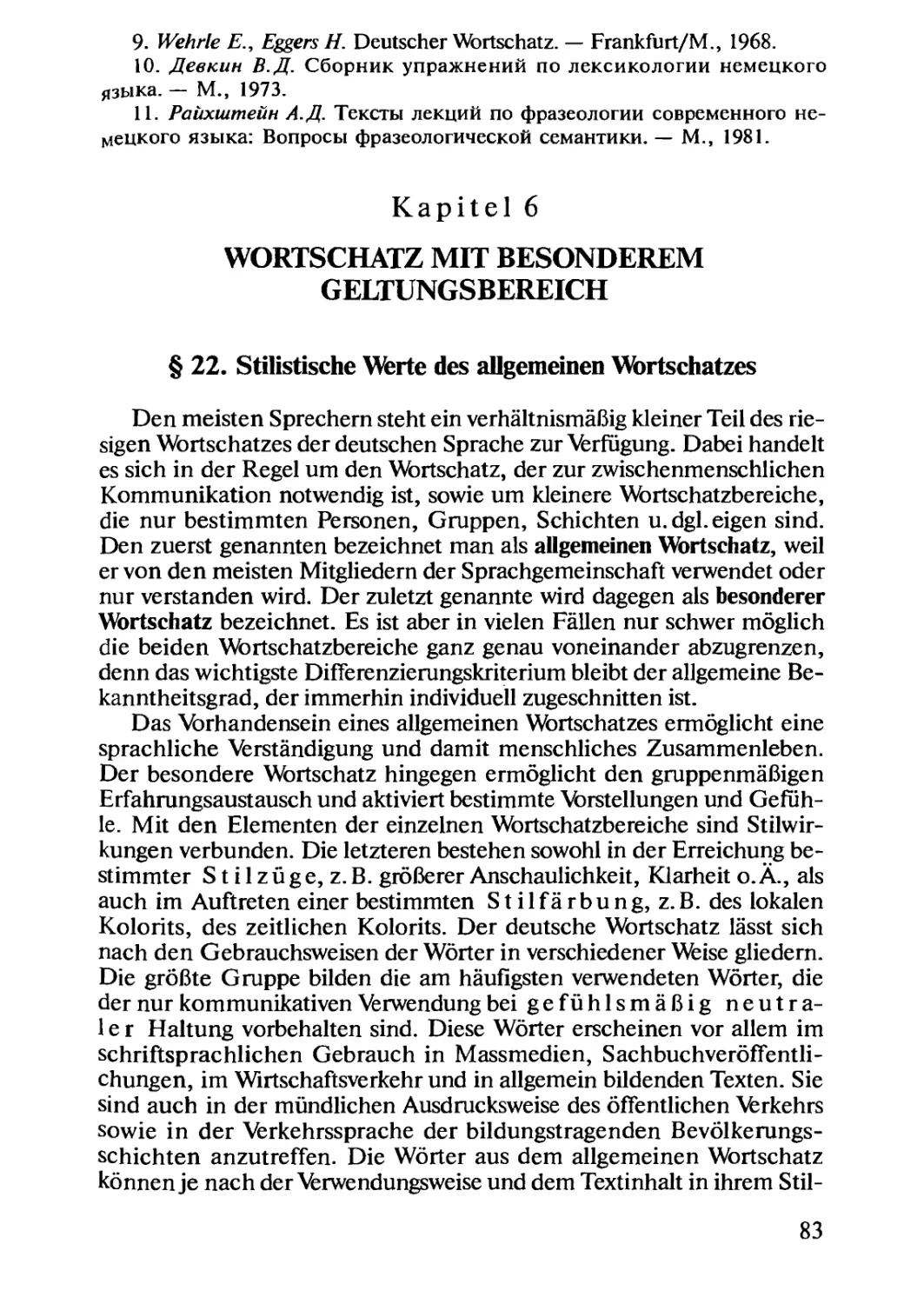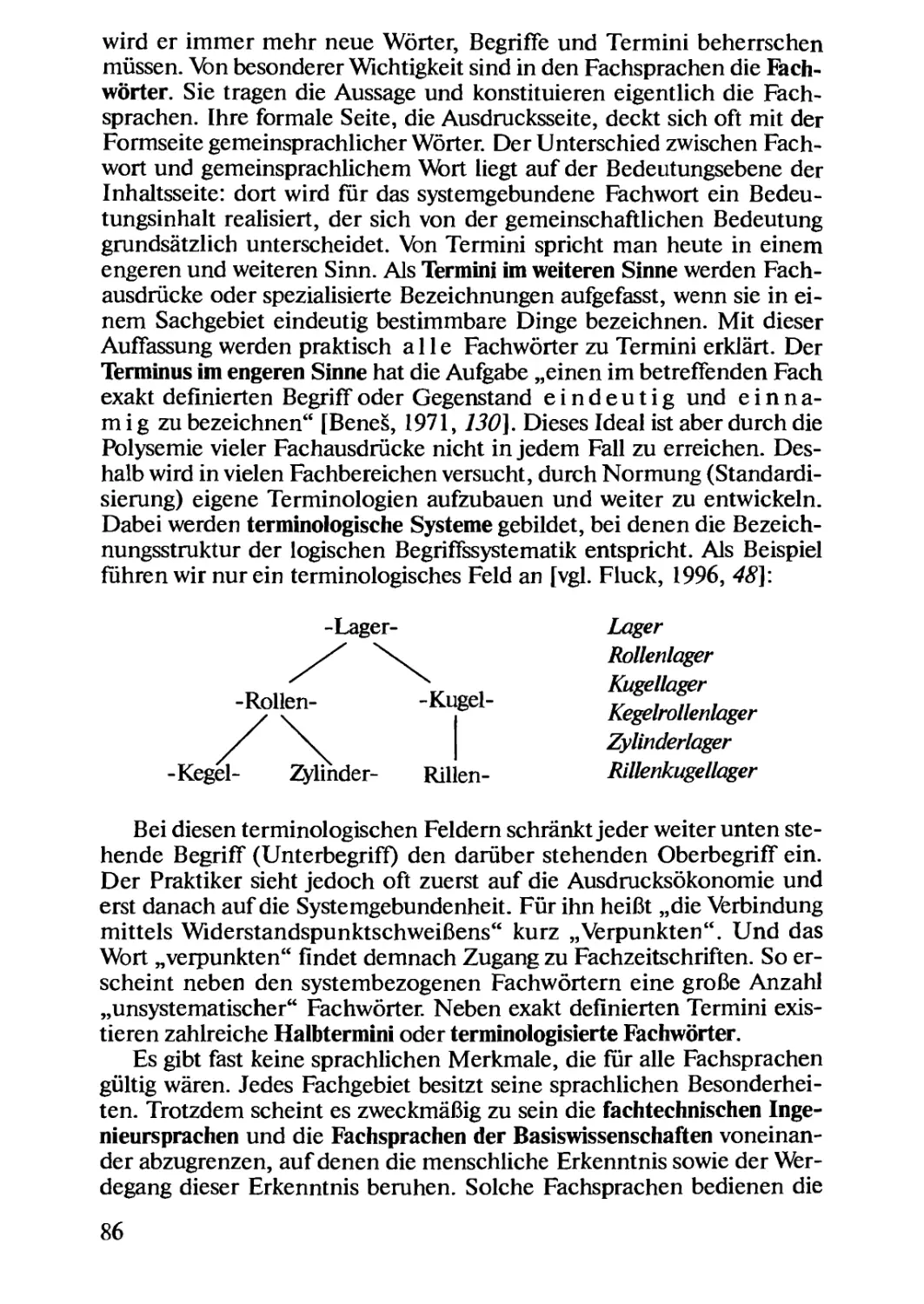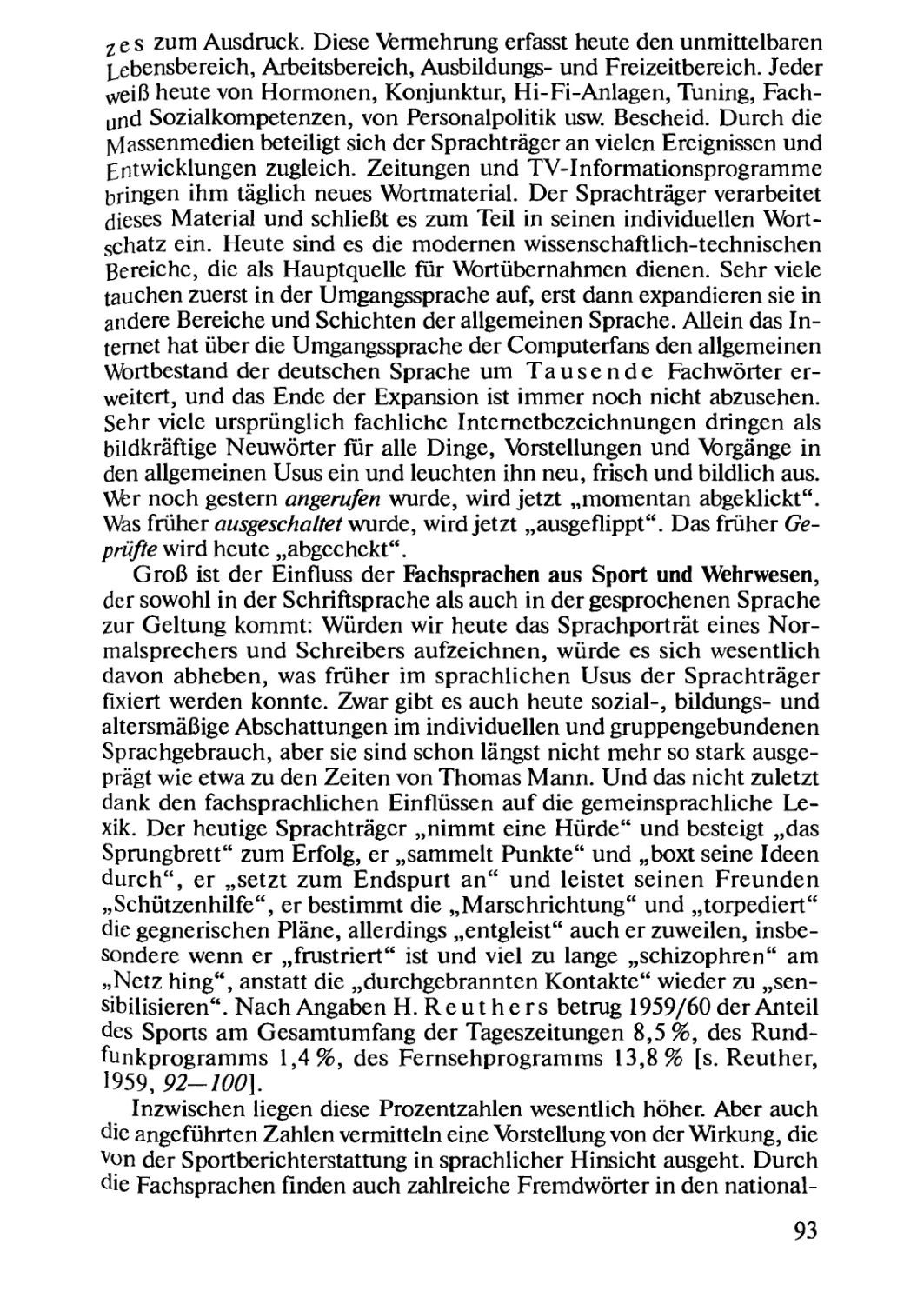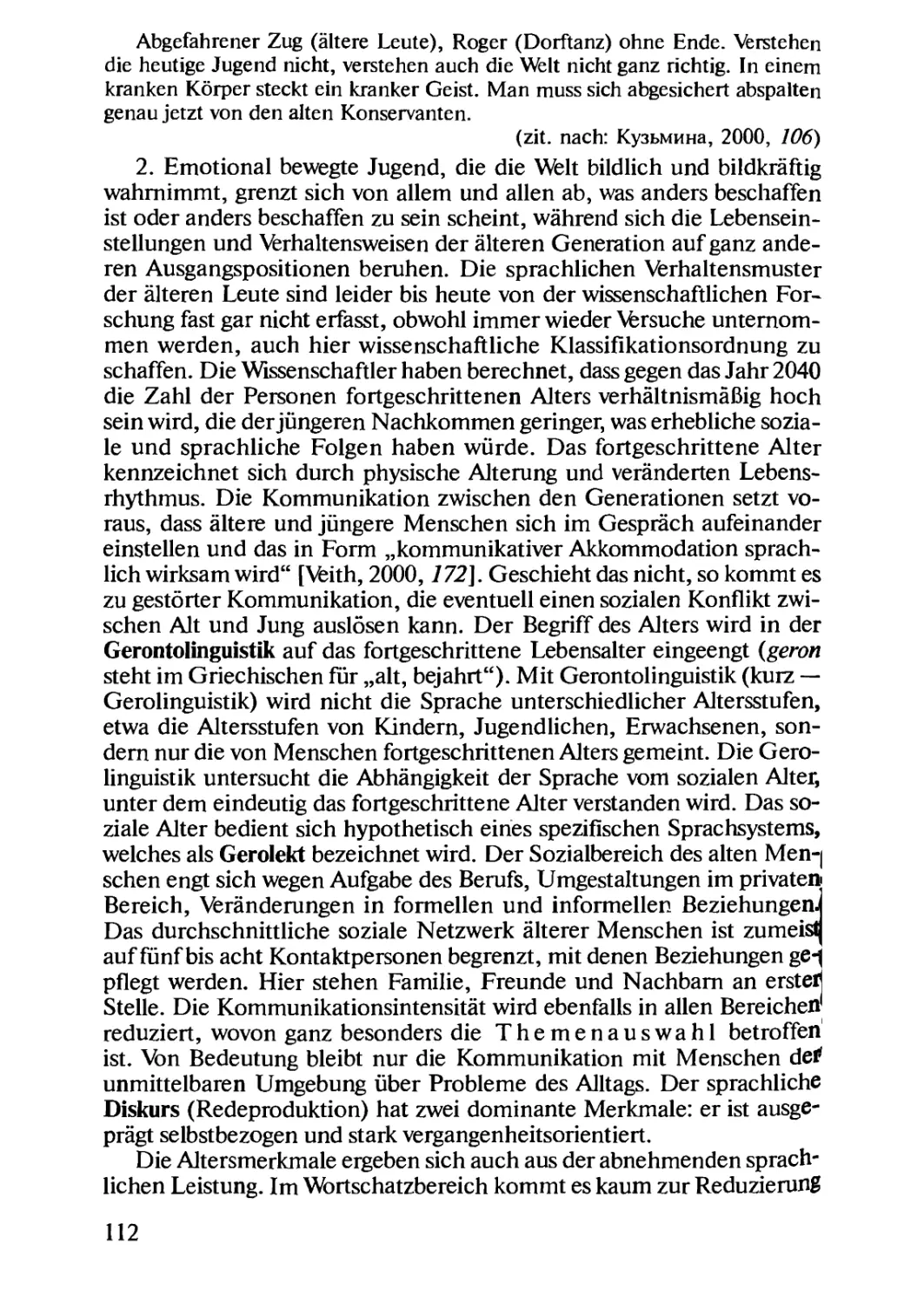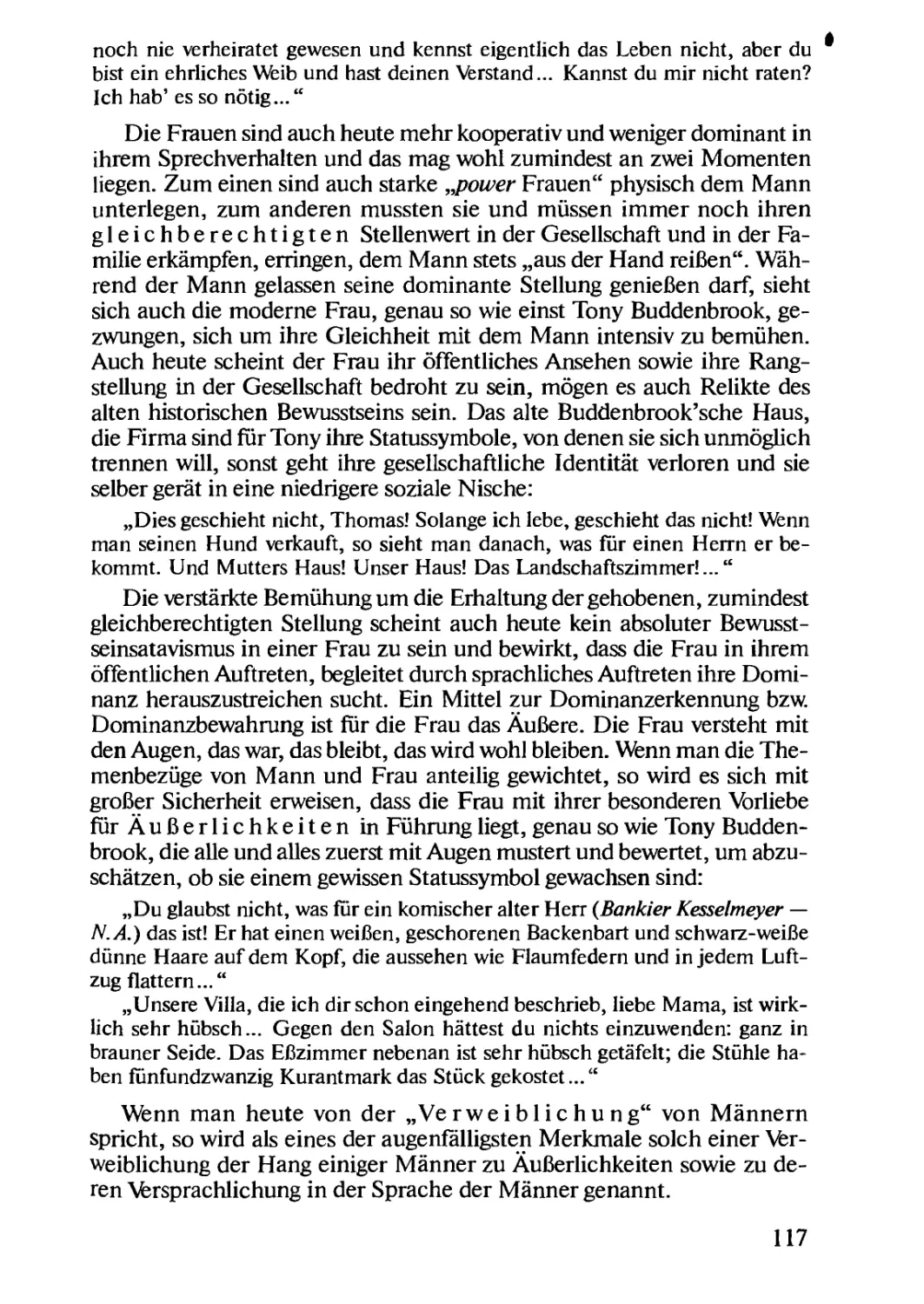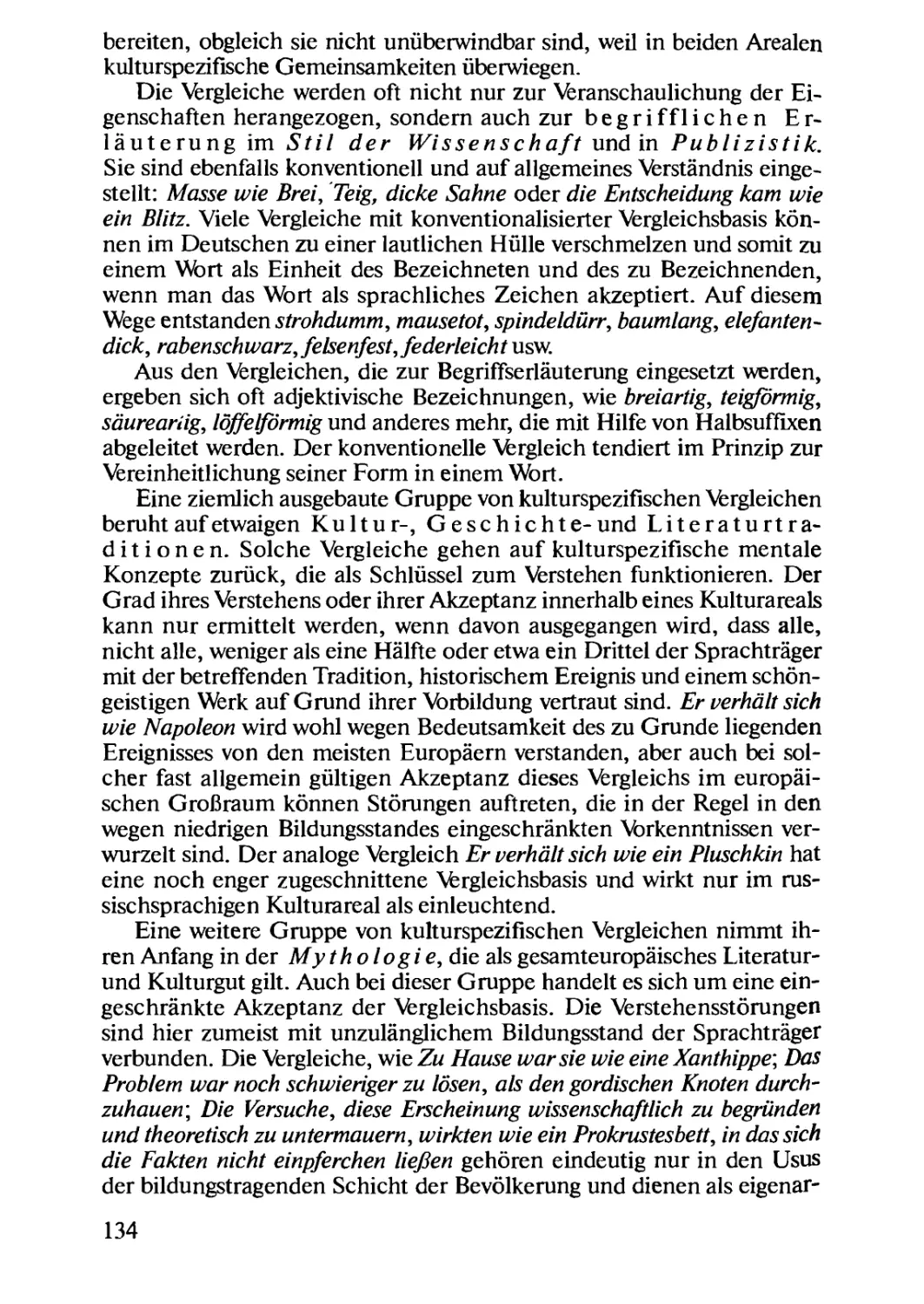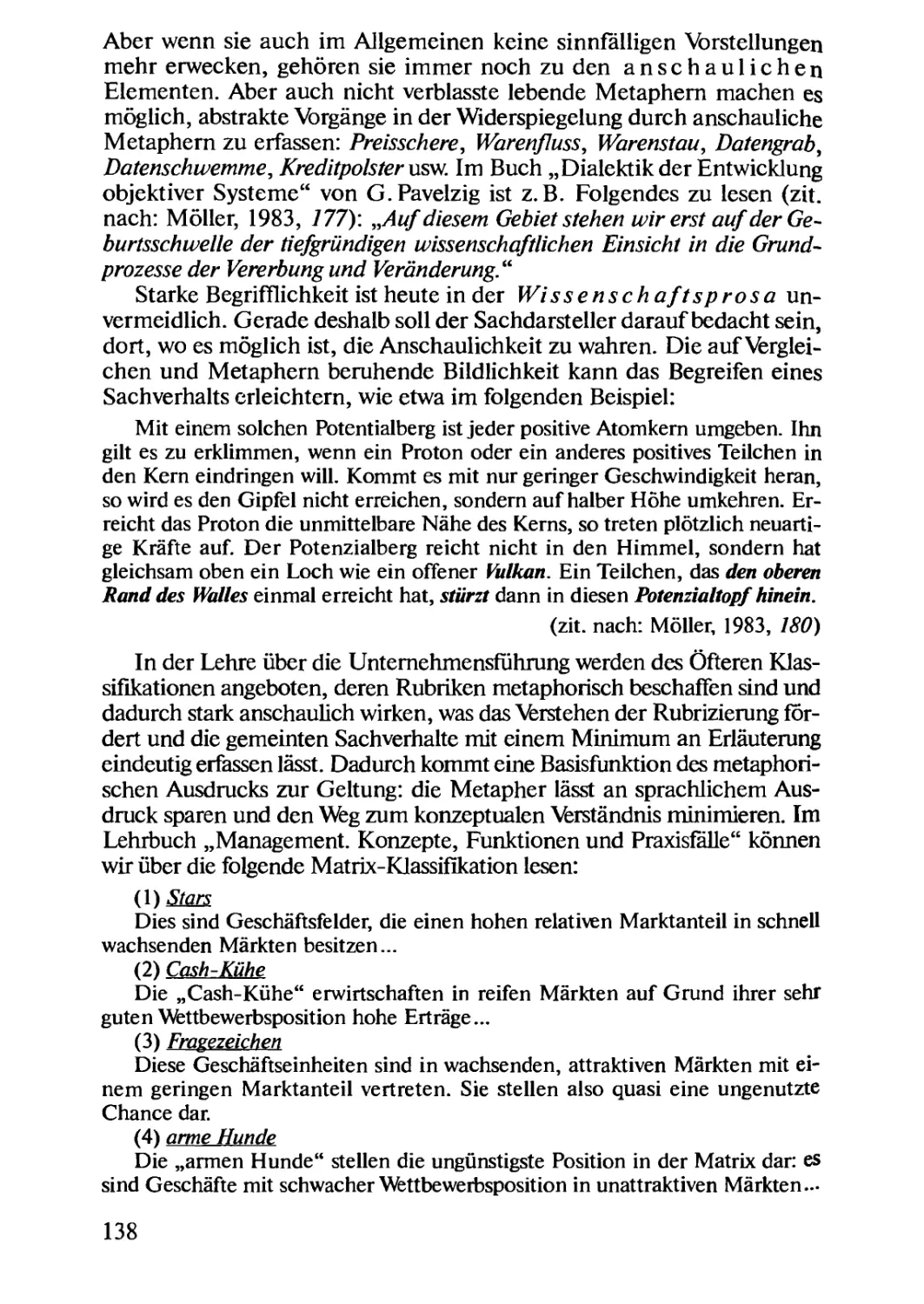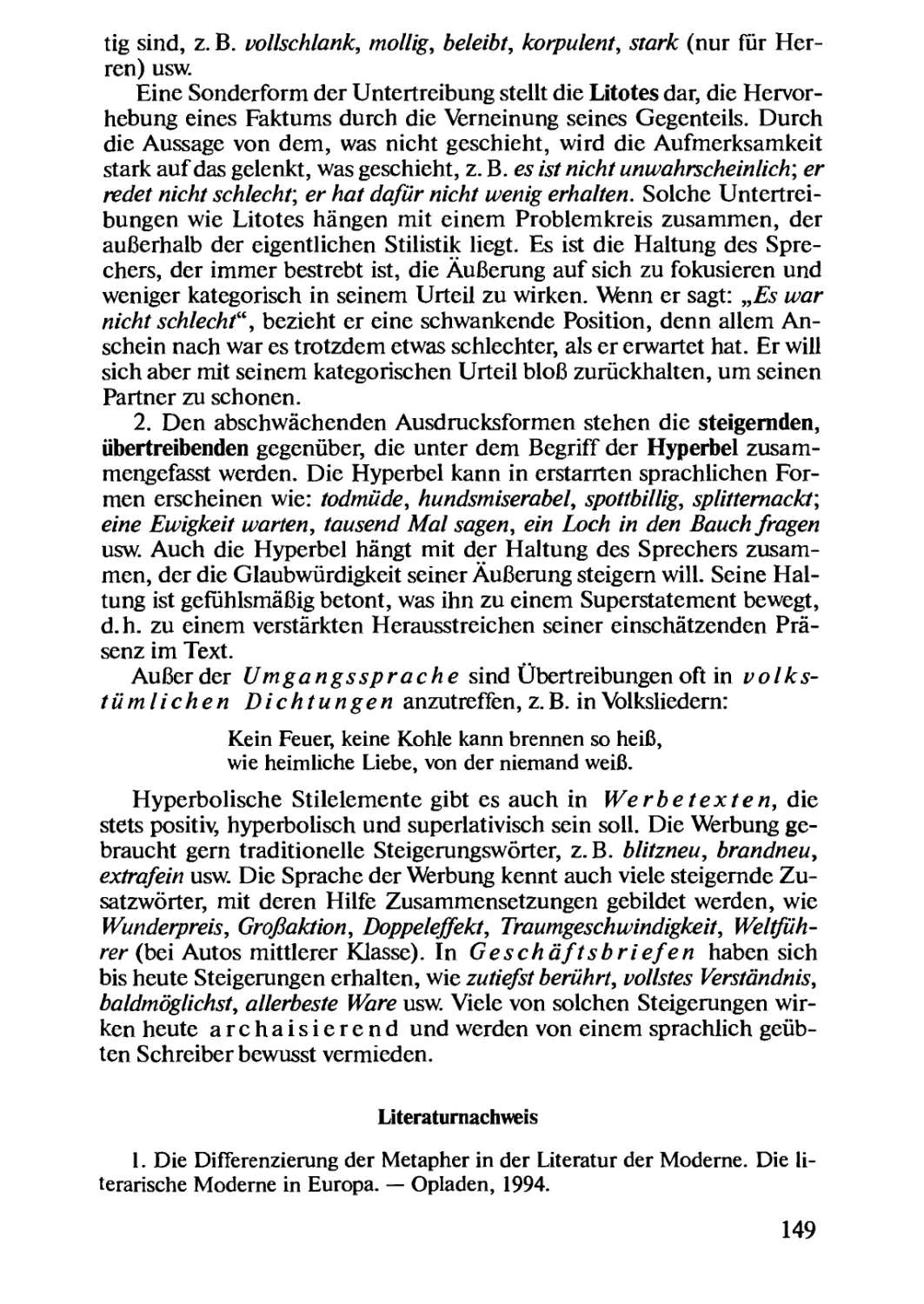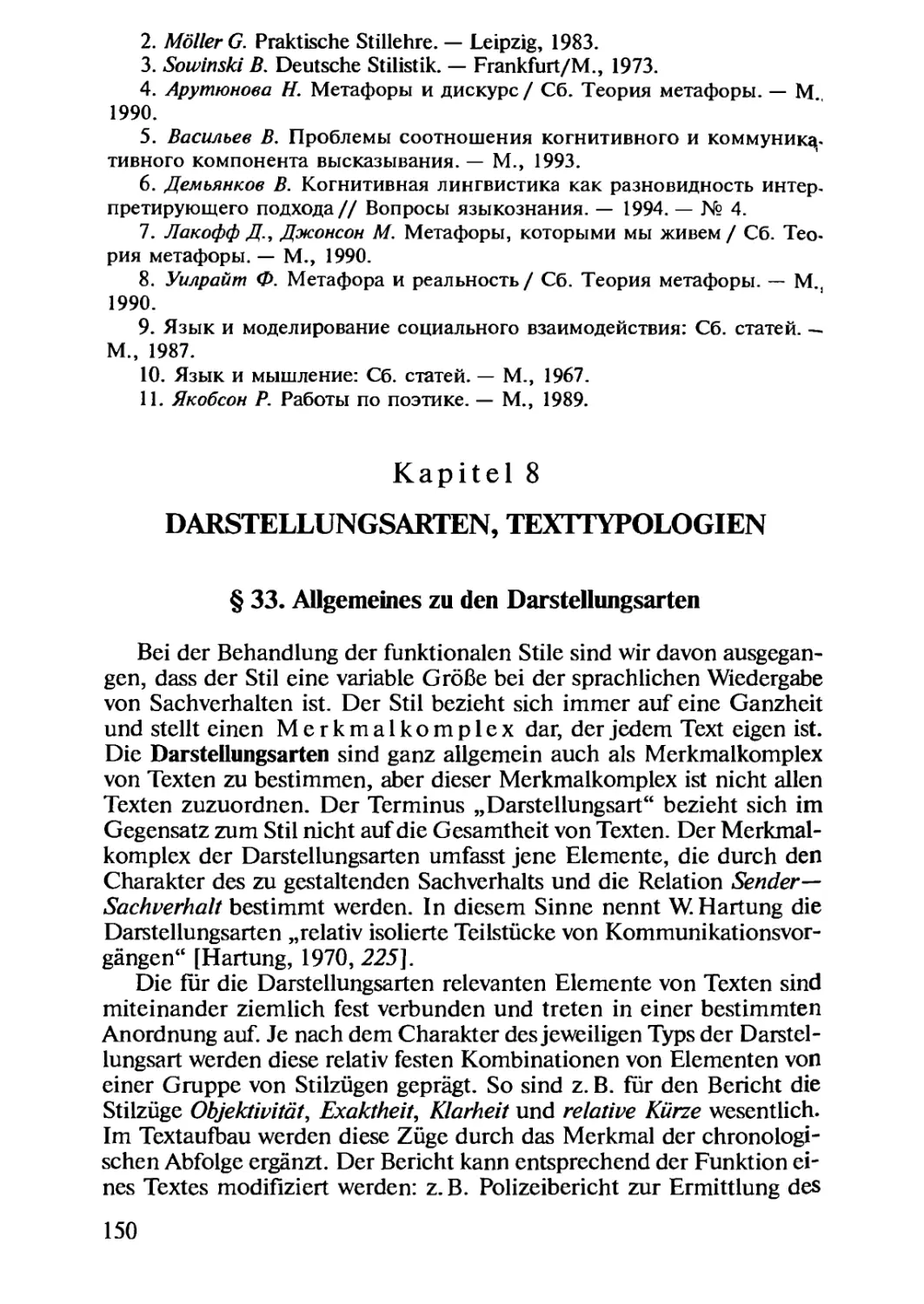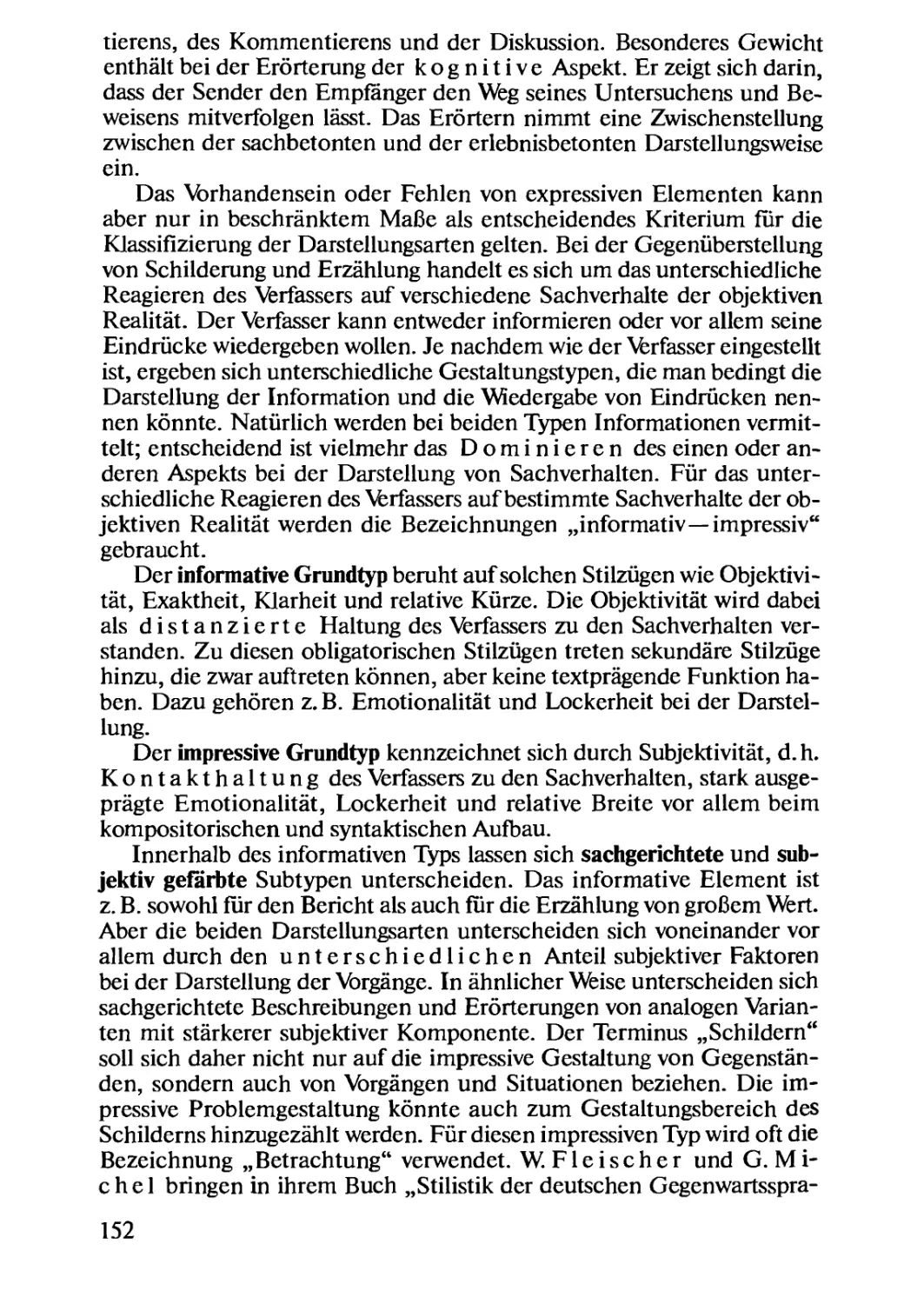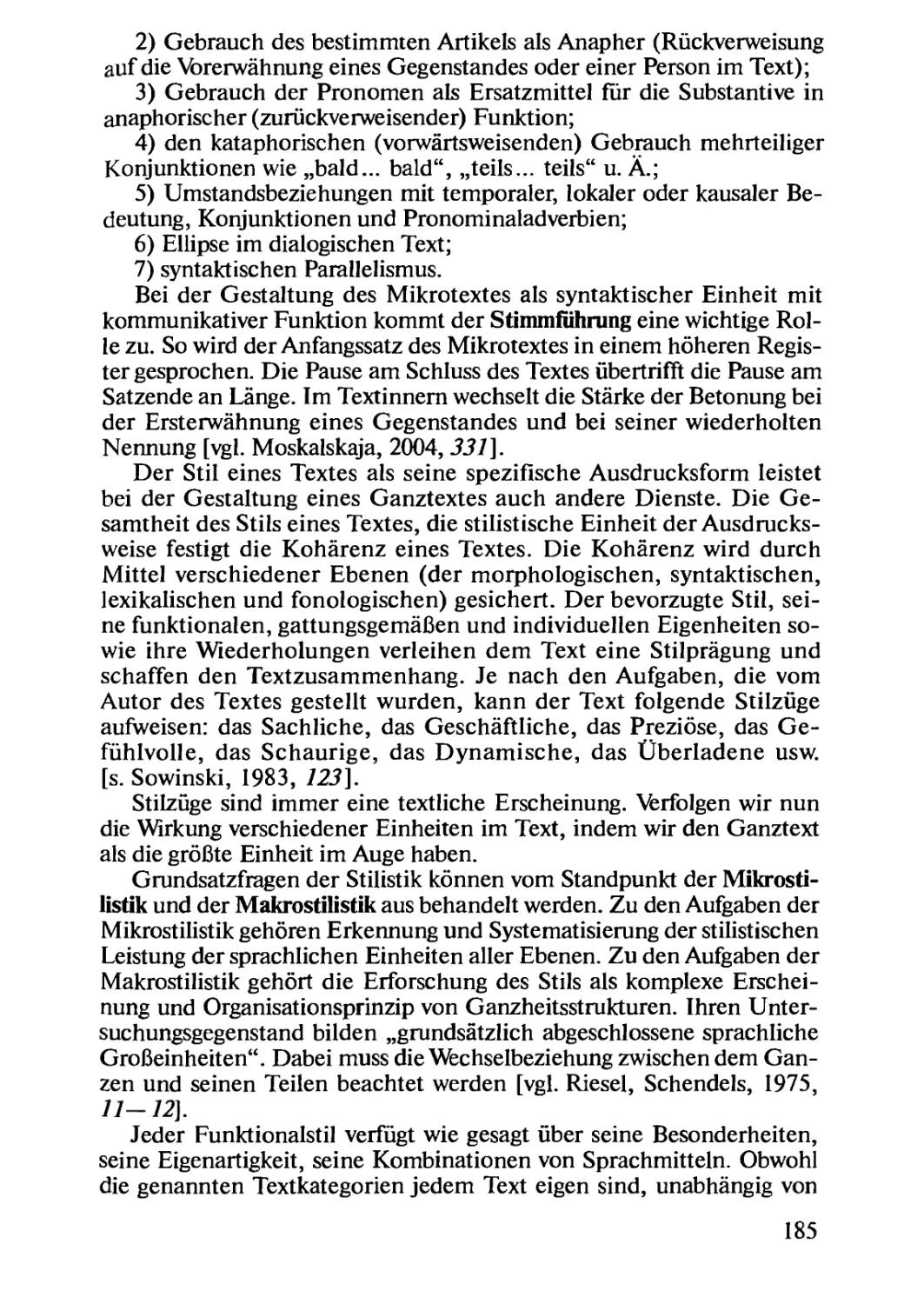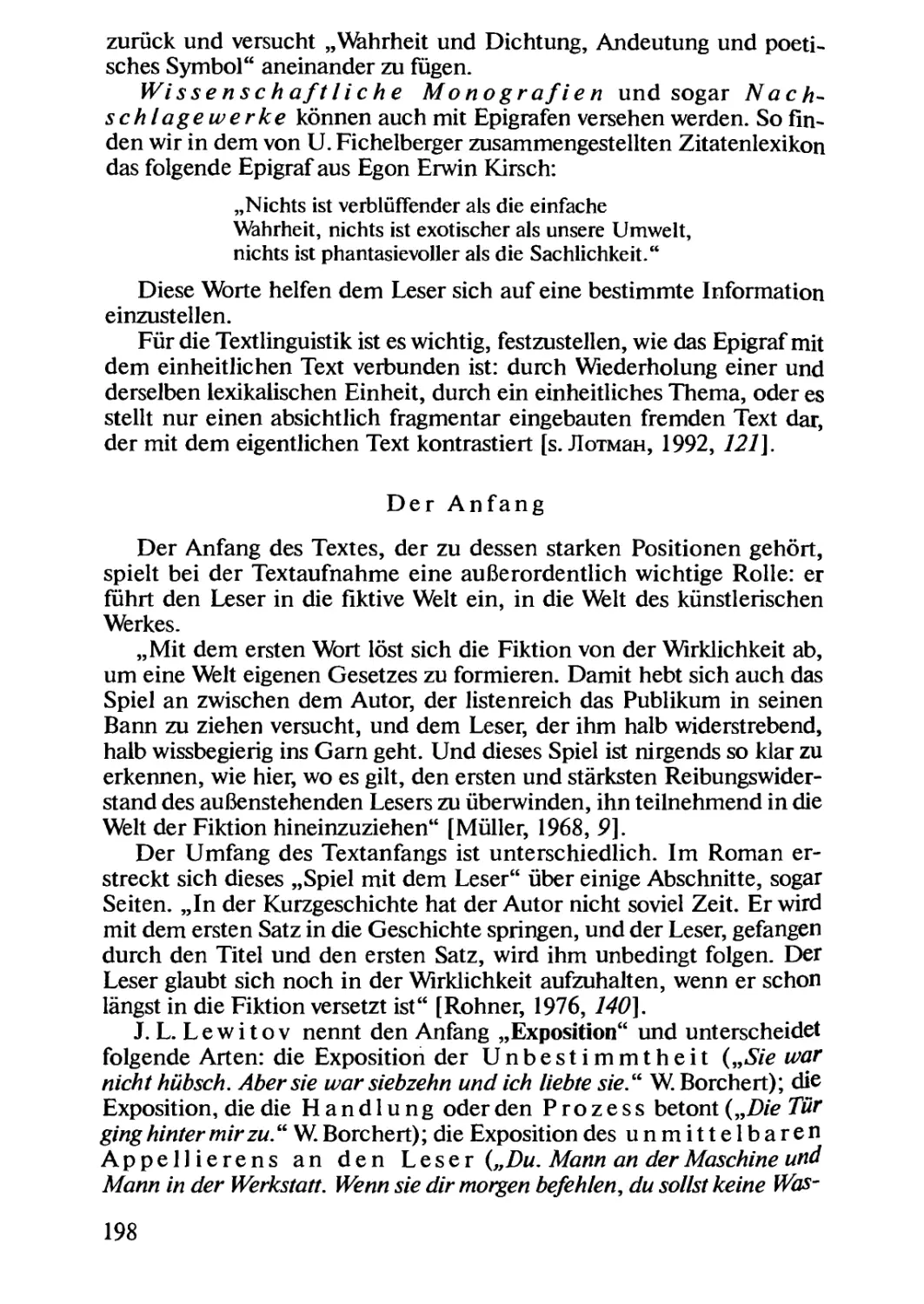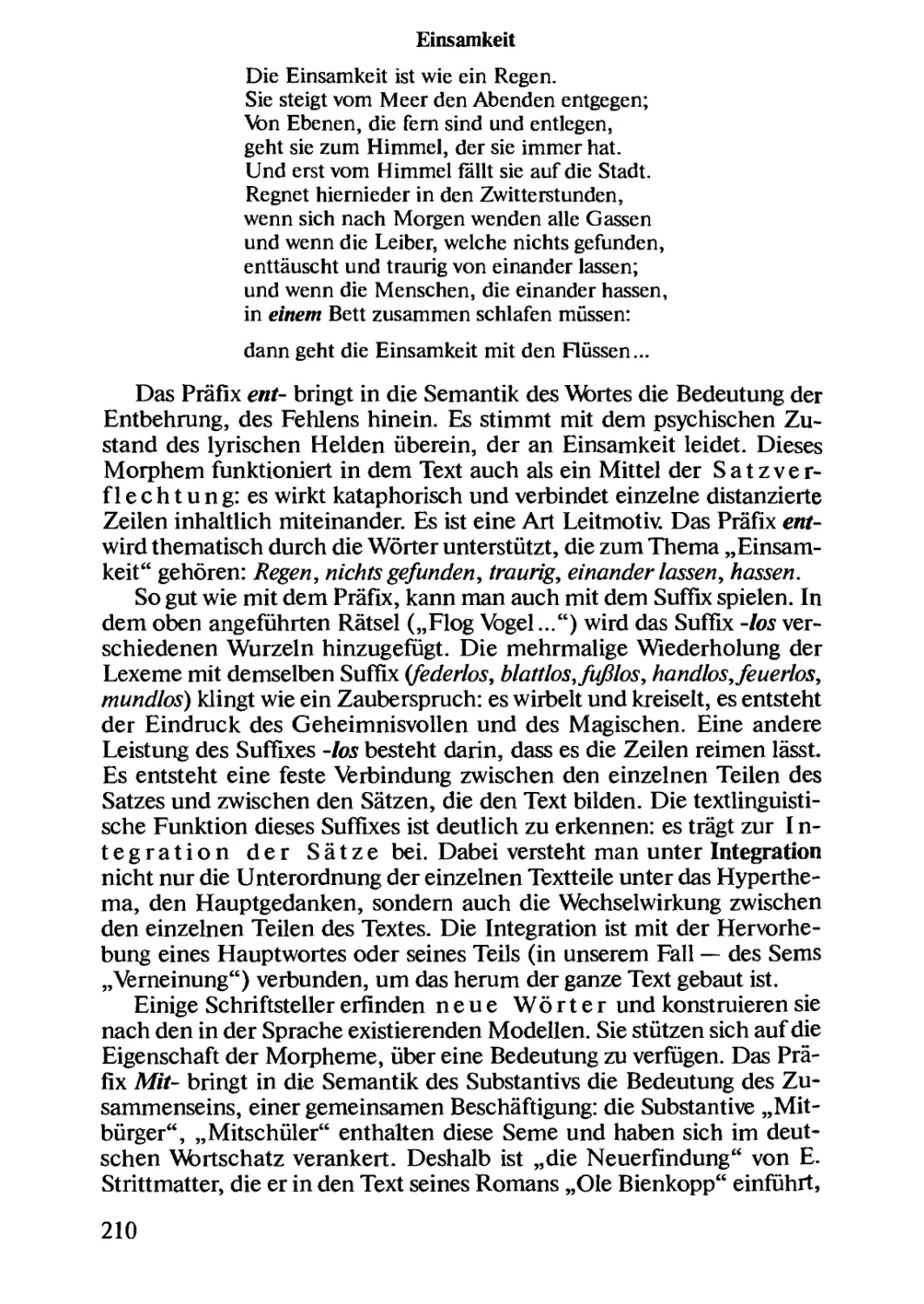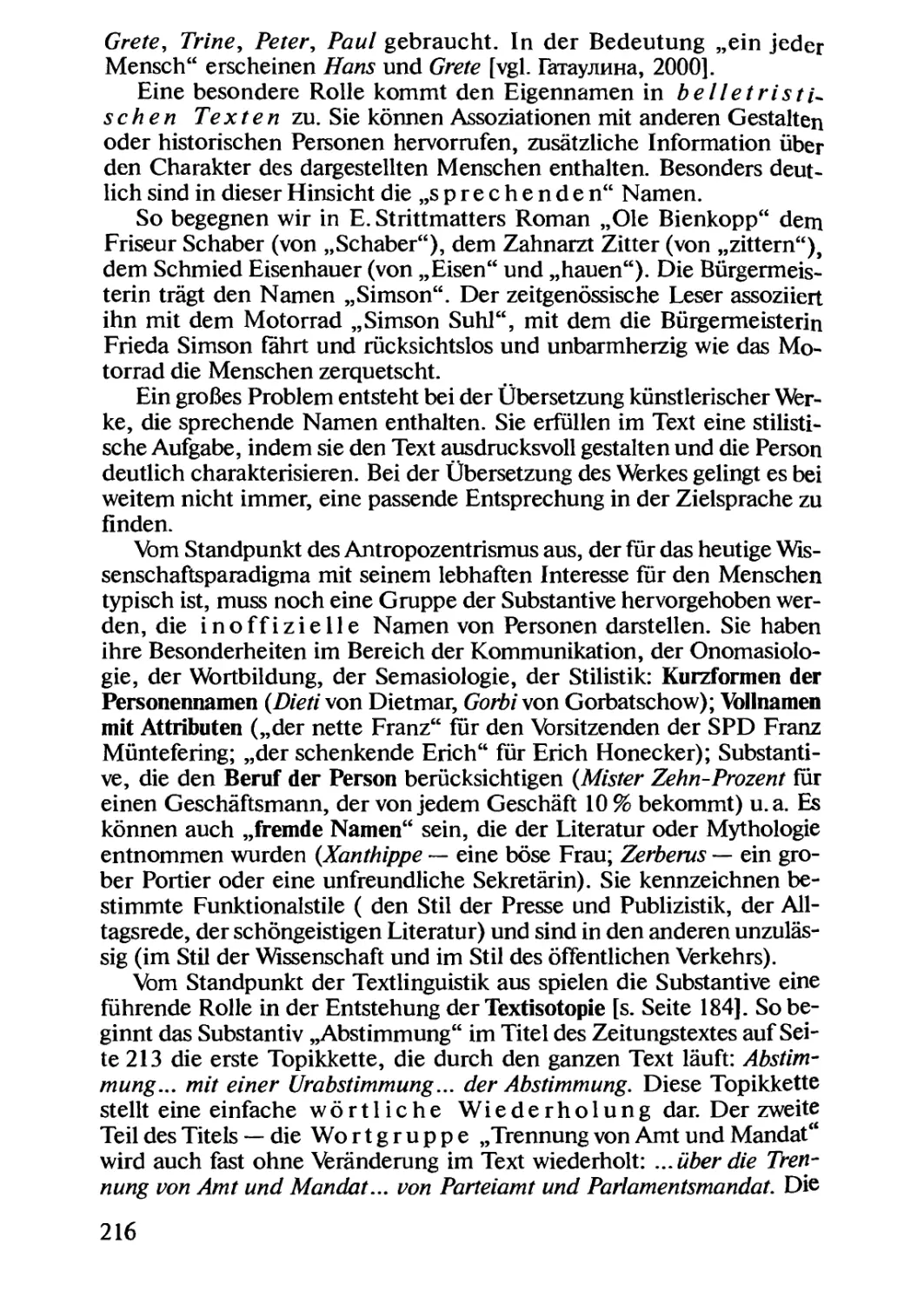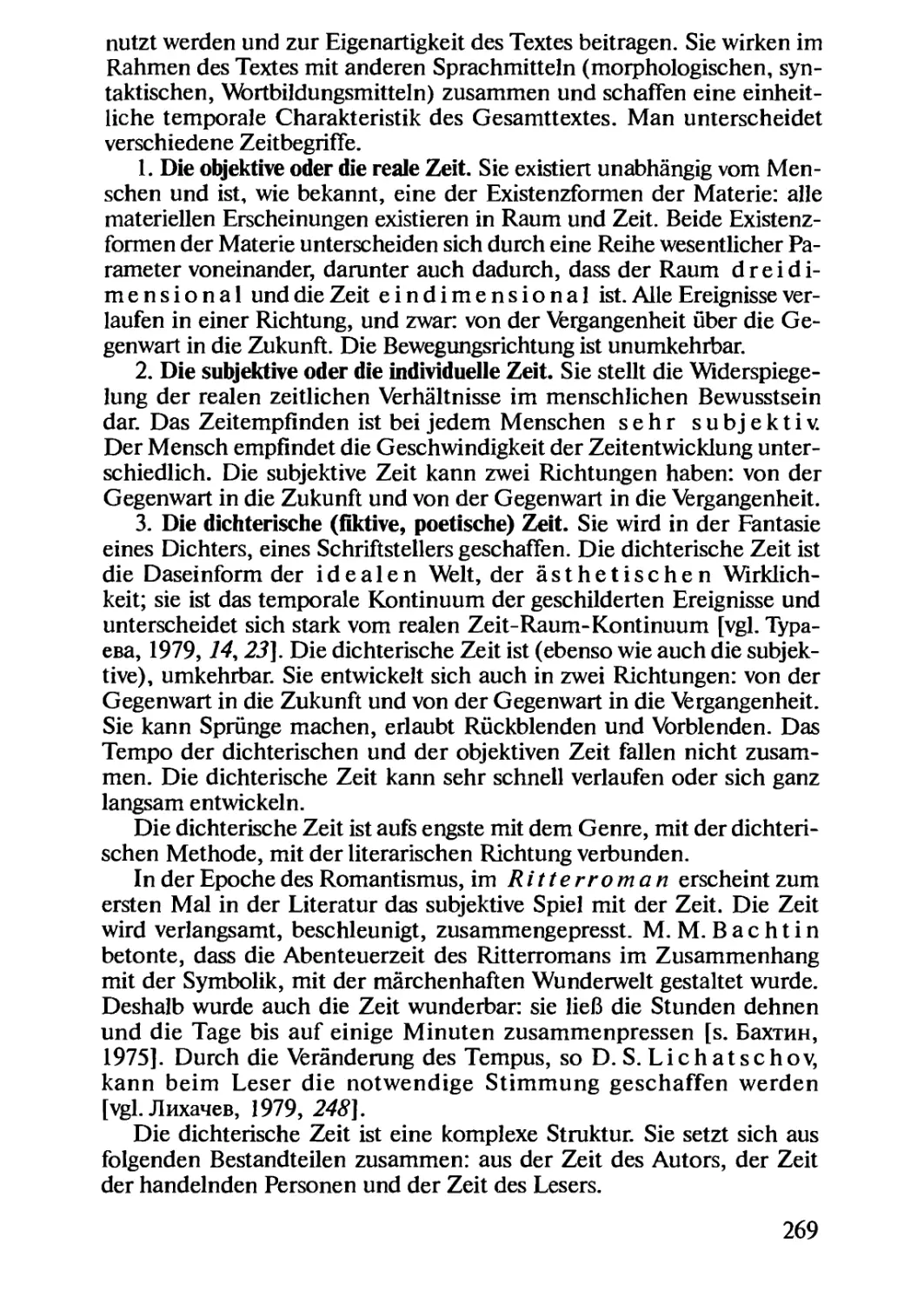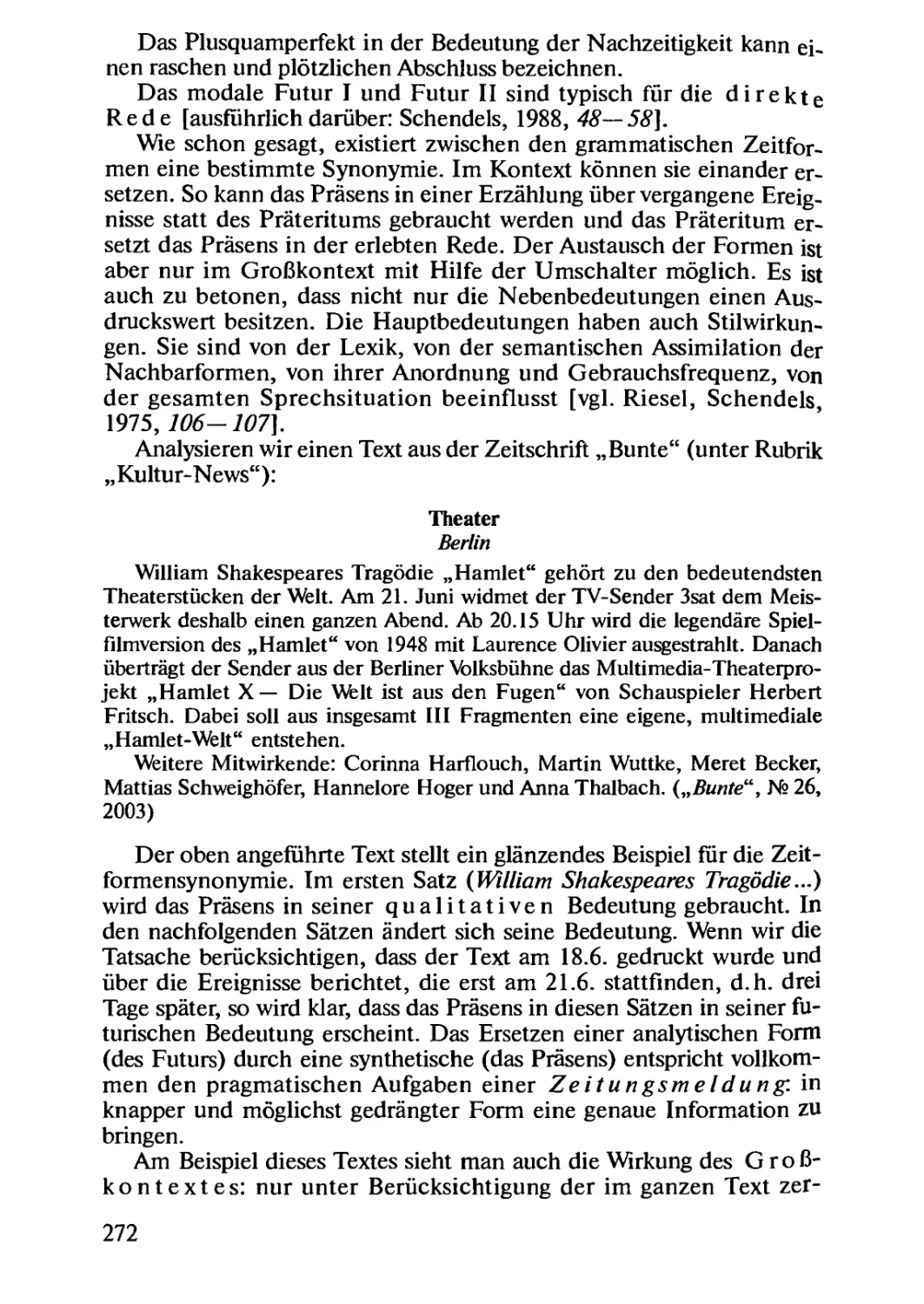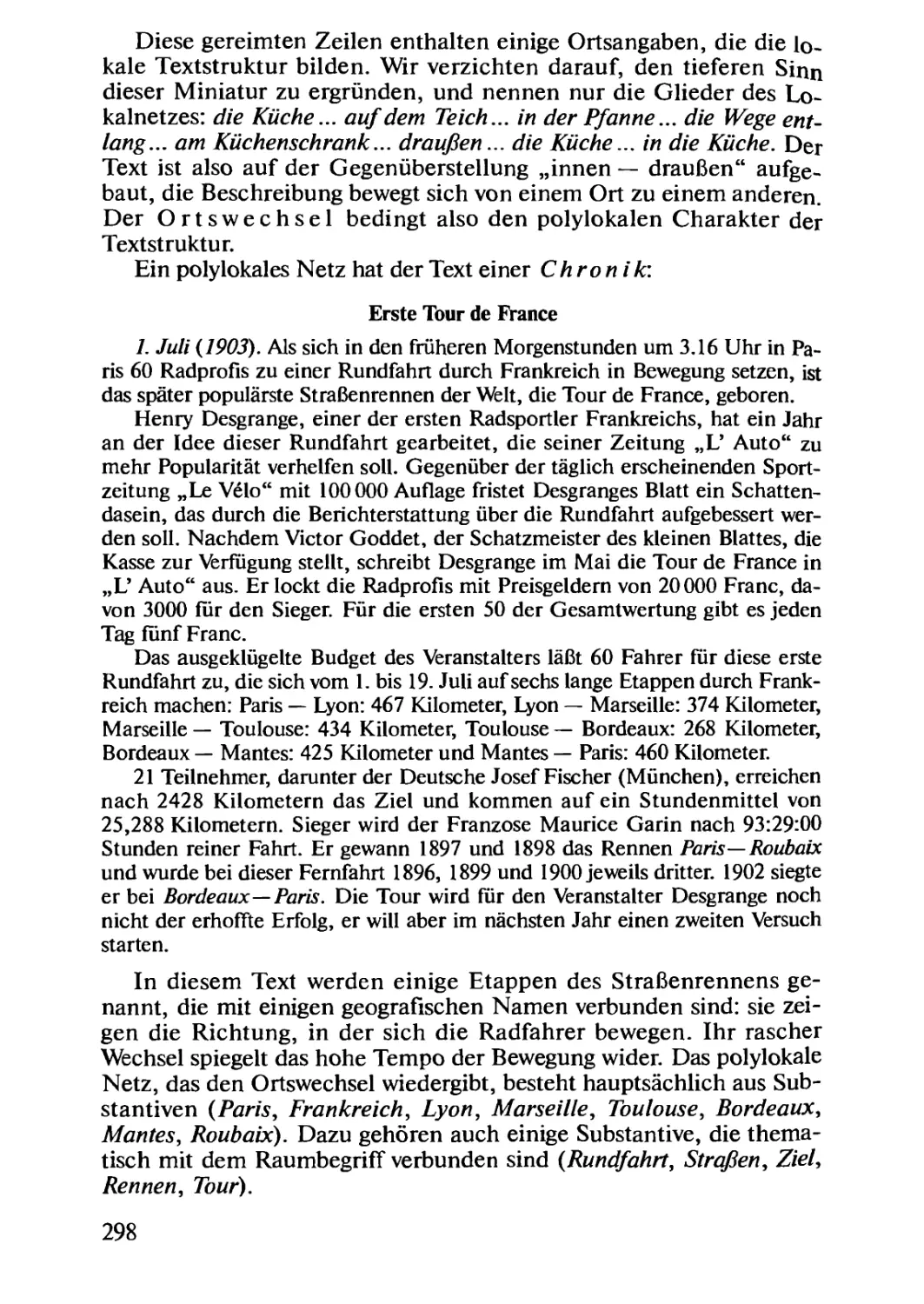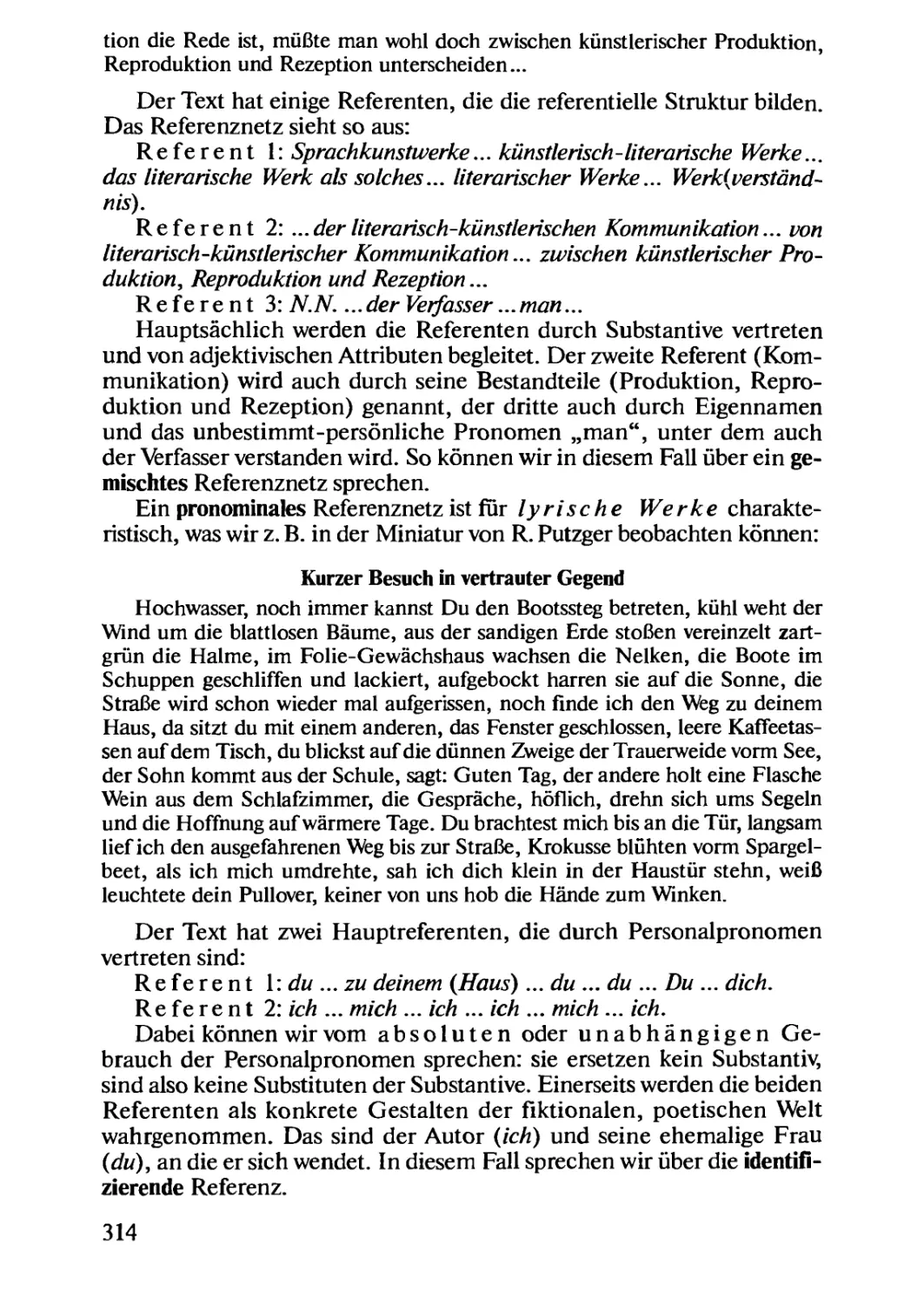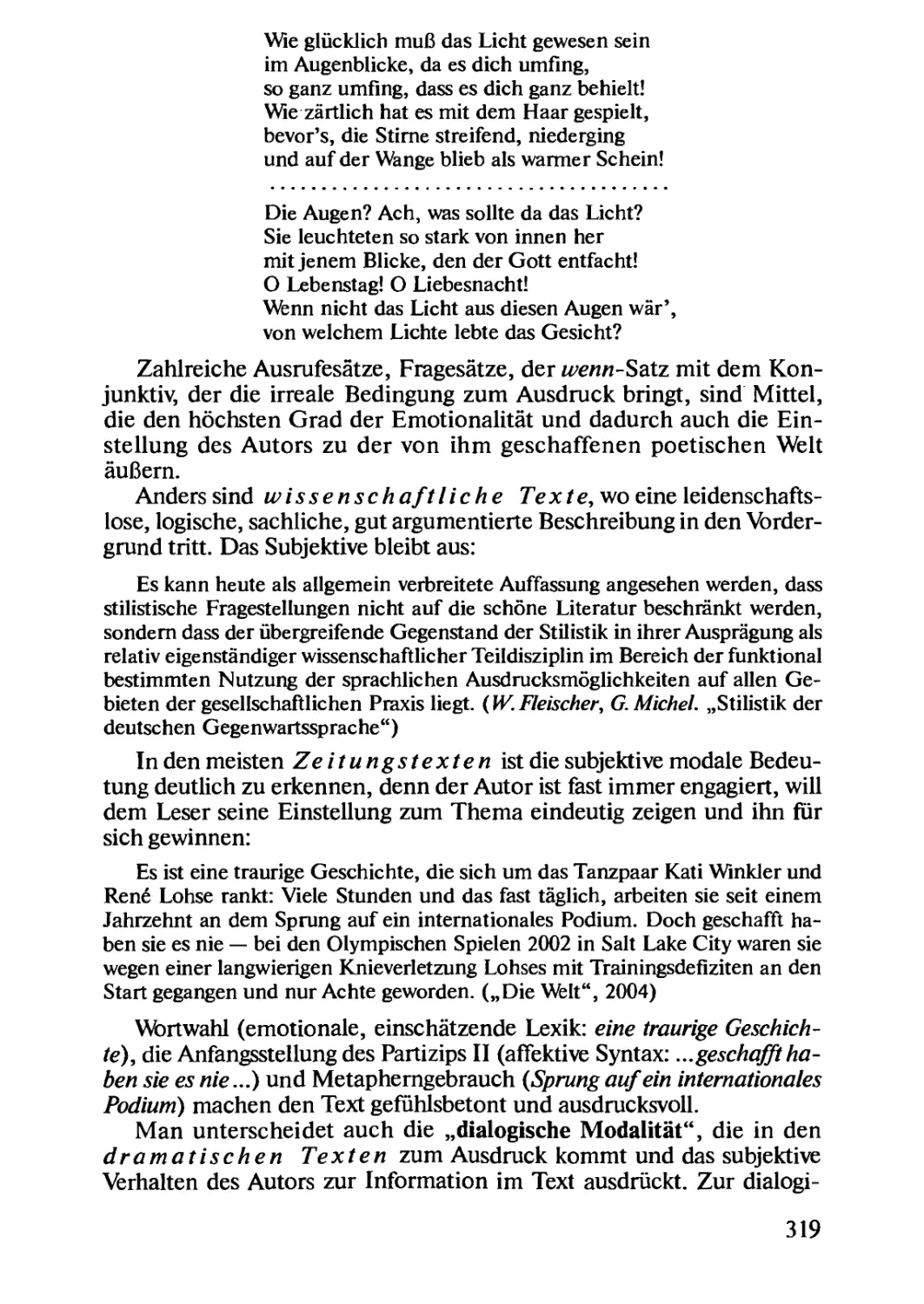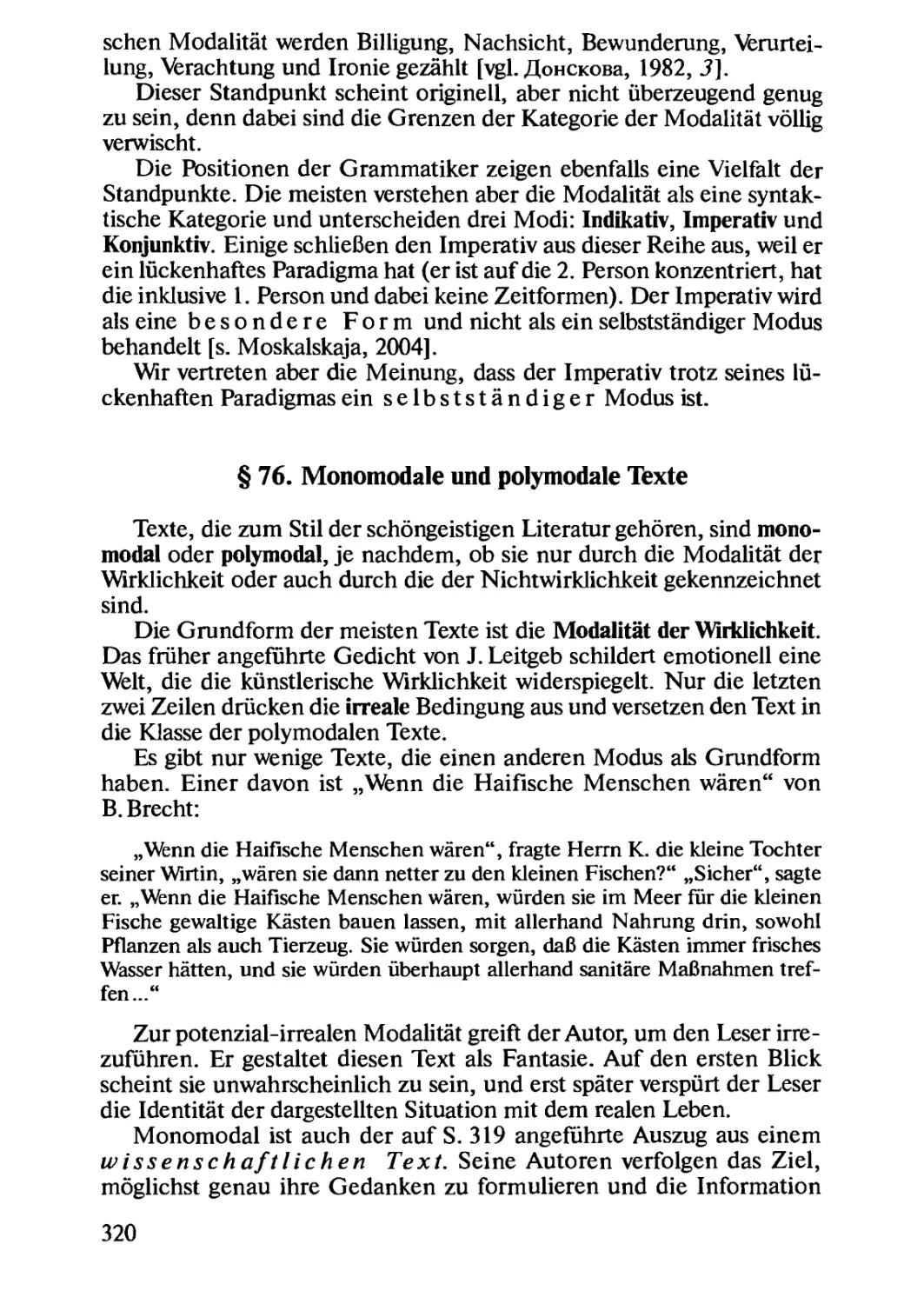Author: Богатырева Н.А. Ноздрина Л.А.
Tags: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии немецкий язык современный немецкий стилистика современного немецкого
ISBN: 5-7695-2115-5
Year: 2005
Text
Bbicuiee npocpeccuoHantHoe oöpasoßaHne
H. A. EoraTbipena
A. A. Ho3ApnHa
CTMAUCTUKA
COBPEMEHHOrO
HEMELJKOEO
5I3EIKA
STILISTIK
DER DEUTSCHEN
GEGENWARTSSPRACHE
BbICUIEE nPOQECCHOHAJIbHOE 0EPA30BAHME
H.A. EOrATbIPEBA, Jl.A. HO3flPWHA
CTHJ1MCTMKA COBPEMEHHOrO
H EM E LJ KO TO H3blKA
STILISTIK DER DEUTSCHEN
GEGENWARTSSPRACHE
PeKOMendoeaHo
yveÖHO-MemoduvecKUM oöbeduHeHueM no ofipasoeaHuio e oöjiacmu jiuH2eucmuKU
Munucmepcmea o6pa3O6QHL& u nayxu Poccuückoü (Pedepcmuu e Kcwecmee yveÖHoeo
nocofiufl djw cmydeHmoB, acnupanmoe u npenodaeamejieü JiUHSßucmiPiecKux eysoe
u cpaKynbmemoe
MocKBa
ACADEM*A
2005
y/JK803.0(075.8)
BBK81.2HeM-5n73
B732
PeueH3eHTbi:
.hoktop (JjwjiojiorwHecKWx HayK, npo^eccop Mockobckofo rocynapcTBeHHoro
oßjiacTHoro yHWBepcwTera, 33b. Ka^eapow repMaHWCTWKW M H. JIeeueHKO\
KaHannaT (JjwjiojiorwHecKWx HayK, npo^eccop Mockobckofo rocynapcTBeHHoro
jiwHrBwcTHHecKoro yHWBepcwTera, HaysHbift pyKOBO/urrejib IJKMOMR
K. F. Flaejioea}
KaHAwaaT <J)HjiojiorwHecKHX HayK, uoueHT Mockobckofo rocynapcTBeHHoro
jiWHrBWCTWHecKoro yHHBepcwTera, 33b. Ka^^pon HeMeuKOro H3biKa
E. C. EamypuHa
EoraTbipesa H. A.
B732 CTMJiMCTHKa coßpeMeHHoro HeMeuicoro n3MKa = Stilistik der
deutschen Gegenwartssprache: y<je6. nocoßne juui crya. jihhtb.
ByaoB n 4>aK. / H.A. BoraTMpeßa, JLA. Ho3apwHa. — M.: M3aa-
TeJibCKKii ueHTp «AKajjeMrifl», 2005. — 336 c.
ISBN 5-7695-2115-5
B yneßHOM nocoöww paccMaTpHBaioTC« TpaawnwoHHbie npoßjieMbi ctwjiwc-
thkw c n03wnww coBpeMeHHOM HayHHOM napanwrMbi: CTWJiwcTHHecKa« MapKWpo-
BaHHocTb oxnejibHbix jieKceM h cjioBocOHeraHwü; nparMaTWHecKWM noreHuwaji
CTMJlWCTWHeCKKX CpeflCTB H (jmiypj CTMJIWCTHHeCKa« 3HaHWMOCTb npO(j)ecCHOHajIb-
Hbix «3biKOB, wx BJiHHHwe Ha y3yc; remxepHbiM, BO3pacTHon h HaeojiorwHecKwn
(J)aKTOpbI B CTWJIHCTWHeCKOM npeJIOMJICHMH W Äp.
cryneHTOB JiWHrBWCTWHecKnx By3OB u (JjaKyjibTeTOB. Moxer 6biTb nojie3-
ho acnwpaHTaM w npenonaBarejiHM HeMeuKoro A3biKa.
yflK 803.0(075.8)
BBK 81.2HeM-5>i73
OpuzuHciJi-MaKern daHHOZo mdaHun nejixemcn coöcmeeHHOcmbK)
H3damejibCKO2o i^eHmpa «A/cadeMuw», u ezo eocnpouseedenue moöbiM chocoöom
6e3 coe/iacun npaeoofijiadamejiR sanpemaemcx
© EoraTbipeBa H.A., HoaapHHa JI.A., 2005
© O6pa3OBaTejibHO-M3,naTejTbCKWM ueHTp «AKaaeMwa», 2005
ISBN 5-7695-2115-5 © O<J)opMJieHwe. UsaaTejibcKHn ueHTp «AKaaeMw«», 2005
VORWORT
Mit unserem Buch wollten wir den Faden der germanistischen Stil-
forschungen in Russland aufgreifen, der seit den 70er Jahren abgerissen
zu sein schien. Wir standen vor der schwierigen Aufgabe, eine Brücke zu
schlagen zwischen dem, was in der russischen Germanistik vor etwa
30 Jahren erreicht worden ist, und neueren Erkenntnissen der Sprach-
forschung, die über einzelne Publikationen verstreut waren.
Im 21. Jahrhundert befinden wir es für notwendig und sinnvoll, sti-
listisch relevante Fragestellungen mit Erkenntnissen aus verschiedenen
Bereichen des humanitären Wissens anzureichern: aus Kulturologie,
Kommunikationsforschung, Textologie, Soziologie und nicht zuletzt
aus der kognitiven Lehre. Auch hat die Arbeit an diesem Buch immer
wieder erkennen lassen, wie viel in unserer Wissenschaft noch zu tun
ist, wie viele Fragen nicht oder auf vorläufige und nicht selten wider-
sprüchliche Art beantwortet werden und wie viele Probleme ungelöst
sind.
Das Konzept des Buches ergab sich aus praktischer Erfahrung der
Autorinnen sowie aus dem akuten Bedarf an Lehrbüchern für Stilistik,
die rein wissenschaftliche Fragestellungen mit ihrer praktischen Verwer-
tung in vielfältigen und zahlreichen Gattungen der schöngeistigen Lite-
ratur, in Sachprosa, Massmedienkommunikation sowie im Alltagsver-
kehr zu verknüpfen suchen.
Das Buch soll nicht nur bei Germanistikstudenten Anklang finden,
sondern bei allen, die Interesse an einem schönen und angemessenen
Wort, an einer wirksamen Redeproduktion haben, denn das Ziel einer
jeden Stilistik besteht darin, den Sprachnutzern alle Potenzen und Mög-
lichkeiten der Sprache zu zeigen, deren Kenntnis einer erfolgreichen
Kommunikation zu Grunde liegen soll.
Wir haben uns auch selber bemüht, in Darstellungsweise und Spra-
che verstehbar und verständlich zu sein. Aus diesem didaktischen Inte-
resse heraus ist die Zahl der Beispiele stark erhöht worden; sie werden
auch, wo dies der Raum zulässt, ausführlich analysiert und sind deshalb
weit mehr als nur Illustrationsmaterial. „Leserfreundlich“ heißt für uns
nicht „populärwissenschaftlich“; es heißt auch nicht, dass simplifiziert
wird, schwierige Sachverhalte ausgespart, Gemeinplätze breitgewalzt,
spektakuläre oder exotische Beispiele als Aufmacher benutzt werden.
Der Gegenstand der Stilistik und die Möglichkeit, sich von verschiede-
3
nen Ausgangspunkten her diesem Gegenstand zu nähern, sind als solche
spannend genug. Wer sich ernsthaft mit Stilistik auseinander setzen will,
muss gewillt sein, die Anstrengung auf sich zu nehmen, die jede wissen-
schaftlich-theoretische Beschäftigung kostet.
Wir danken allen, die uns mit Rat und Tat beigestanden haben: Frau
Doktor M. Levchenko, Frau Doktor E. Baturina für wertvolle Hinweise
und Unterstützung, DAAD-Lektor, Doktor Stephan Walter für seine
Mithilfe beim Korrekturlesen und bei der sprachlichen Aufbesserung ei-
niger missverständlicher Textstellen. Dem Verlag danken wir für die ge-
duldige Betreuung.
Autorinnen
EINFÜHRUNG
Die Sprache ist die wichtigste Grundlage menschlichen Zusammen-
lebens. Mit der Sprache setzen sich seit langem Philosophen auseinan-
der, die die Beziehungen zwischen Sprache und Existenz zu ermitteln
suchen, Theologen, die näher auf die Wirksamkeit der sprachlichen
Strukturen eingehen wollen, Psychologen, die sich bemühen, die Spra-
che auf die Individualität und Psyche eines Einzelnen zu beziehen, So-
ziologen, die nach Sprachbesonderheiten im Zusammenhang mit der
sozialen Schichtung und sozialen Sprachbarrieren urteilen, Pädagogen,
die über optimale Verfahren zur Sprachvermittlung reflektieren, Vertre-
ter der modernen Lyrik und Prosa, die die Möglichkeiten erschließen,
durch kühne Sprachexperimente zur Schablone gewordene Sprachfor-
men zu sprengen, und nicht zuletzt die Politiker, die es gewohnt sind,
unterschiedliche Interpretationen der Sachverhalte durch mehr oder
weniger gelungene Sprachtechniken zu untermauern.
Die Sprachwissenschaftler orientieren sich bei der Erforschung der
Sprache an dem sprachlichen System (paradigmatischer
Aspekt) und an der sprachlichen Verwendung (syntagmati-
scher Aspekt). Die Sprachforschung geht dabei von der Beobachtung
aus, dass sich innerhalb der zahllosen Verwendungsmöglichkeiten einer
Sprache die Normen und Strukturen ermitteln lassen, die von der einen
Seite die Sprache als Struktur ermöglichen, von der anderen Seite aber
die Abwandlung der sprachlichen Mittel erlauben, welche die Sprach-
verwendung unter konkreten situativen Bedingungen prägt. Die Sprach-
verwendung erweist sich dabei als ein Zusammenwirken verschiedener
sprachlicher und außersprachlicher Faktoren. Die schriftsprachlichen,
d. h. normierten Möglichkeiten können dabei durch bestimmte Aus-
drucksabsichten, situative Bedingtheiten und Erfordernisse des Stils
oder Genres variiert, ergänzt oder beeinflusst werden. Die jeweilige Prä-
gung des sprachlichen Ausdrucks durch die selektiven Faktoren binnen-
sprachlichen und außersprachlichen Charakters ergibt den Sprachstil.
Er (Sprachstil) ist Forschungsgegenstand der Stilistik und macht einen
wichtigen Teil der Linguistik der Sprachverwendung aus. Die Stilistik er-
forscht die Regularitäten und Irregularitäten der Sprachverwendung so-
wohl in Form von Inventaren der stilistischen Mittel und Möglichkei-
ten, z. B. in stilistischen Grammatiken, als auch in der Beschreibung
und Interpretation des Stils von Einzeltexten. Übrigens bestehen vor al-
5
lem in der wissenschaftlichen Stilistik unterschiedliche Auffassungen
über das Wesen des Sprachstils und somit über den Gegenstand, Ziele
und Methoden der Stilforschung.
Die ersten wissenschaftlichen Verallgemeinerungen über den Stil
sind uns seit den griechischen Sophisten im 5. Jahrhundert v. Chr. über-
liefert. Das war die Lehre von der kunstreichen Gestaltung der Rede,
besonders der öffentlichen Rede, die den Namen „Rhetorik“ bekam.
Die Rhetorik wurde seit dem 5. Jahrhundert auf den Schulen berufs-
mäßig gelernt. Der geschulte Redner konnte in der Öffentlichkeit Ein-
fluss, Macht und Reichtum gewinnen. Die Rhetorik wurde von den Rö-
mern weiter entwickelt und systematisiert. Innerhalb der rhetorischen
Lehre wird die Stilistik intensiv betrieben. In der Rhetorik werden fünf
Teile der Redevorbereitung unterschieden: l)Inventio (Stoffsamm-
lung), 2) Despositio (Stoffordnung), 3)Elocutio (sprachliche
Formulierung), 4) M e m o r i a (Einprägung der Rede), 5) P r o n u n-
t i a t i o (Vortrag). Die Elocutio sollte durch die Formulierung zugleich
die Stilisierung des Gesagten übernehmen, d. h. die Ausschmückung der
Gedanken mit den so genannten Stilfiguren (Wortfiguren als Stil-
mittel).
In der antiken und mittelalterlichen Rhetorik wurde als „Stil“ eine
Form der Sprachverwendung angesehen, die sich durch eine bestimmte
Art des rhetorischen Schmucks auszeichnete und sich dadurch von der ge-
wöhnlichen Umgangssprache unterschied. Allmählig ging die Rhetorik
immer mehr in Poetik auf, und es kam schon im Mittelalter dazu, dass
schließlich nur noch poetischen Texten ein Stil zugesprochen wurde.
Aber zumindest drei Aspekte des rhetorischen Stilbegriffs wurden in
neueren Stilauffassungen aufgegriffen und weiter entwickelt:
1) die Auffassung vom Stil als dem Ergebnis einer bewussten Sprach-
gestaltung;
2) die Auffassung von dem Vorhandensein seiner bestimmten Stil-
mittel, die gegenüber der gewöhnlichen Redeweise verfremdend wirken;
3) die Orientierung des Stils an bestimmten Redezwecken.
Im 17. und 18. Jahrhundert setzte sich die Auffassung durch, dass der
sprachliche Stil ein individueller Ausdruck des Spre-
chers ist. Die Sprache wurde dabei nicht als ein kommunikatives Ins-
trument, sondern als Medium des unmittelbaren Gedanken- und Ge-
fühlsausdrucks aufgefasst. Der Stil entsprang nur noch der Genialität ei-
nes Autors und seiner dichterischen Veranlagung. Diese Auffassung vom
Individual- oder Personalstil wurde zur Grundlage einer literarwissen-
schaftlichen Stilforschung, die die stilistischen Eigenarten verschiedener
Dichter und Schriftsteller zu ermitteln suchte.
Die personale Stilauffassung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in den psychologischen Richtungen der Stilistik verschieden modifiziert.
Von den Vertretern der psychologischen Stilistik wurde das Wesen des
dichterischen Stils in der sprachlichen Aktualisierung, d.h.
in der Benutzung der sprachlichen Einheiten als Hervorhebung von see-
6
lischen Werten gesehen. Die Aktualisierung sollte ihrerseits beim Leser
oder Hörer bestimmte emotionale Wirkungen auslösen. Allen psycholo-
gischen Richtungen der Stilistik ist gemeinsam, dass sich der Stilbegriff
nur auf das ästhetisch wirksame Kunstwerk bezieht. Der Stil
wird dabei nur als Widerspiegelung bestimmter Gemütsbewegungen des
Autors oder als Wirkungskomponente für den Hörer oder Leser aufge-
fasst. Eine solche Sicht ist weder wissenschaftlich noch praktisch da aus-
reichend, wo die Sprachgestaltung rationalen Erwägungen unterliegt,
oder wo wir es nicht mit ästhetischen Gebilden in Form von Kunstwer-
ken zu tun haben. Aber die Auffassung der psychologischen Stilistik von
der Aktualisierbarkeit bestimmter Stilwerte verdient bis heute stärkste
Beachtung.
Im 20. Jahrhundert wird der Stil auch als eine Eigenart der
Sprachgestaltung und Sprachform aufgefasst. Diese Ei-
genart äußert sich in der Einheit der wiederkehrenden Elemente. Die
charakteristischen Elementfolgen und Elementkombinationen werden
kunstkritisch oder interpretierend behandelt. Dabei wird im Stil die Art
und Weise des Zusammenwirkens nicht nur der sprachlichen, sondern
auch der inhaltlichen und formalen Gestaltungsmittel gedeutet. Der
Stilbegriff dieser Richtung wird in der Methode der Textanalyse deut-
lich, in der vom individuellen Eindruck des Betrachters ausgegangen
und zur Analyse und Beschreibung der wirkenden Elemente und ihres
Verhältnisses zueinander und zum Inhalt übergegangen wird.
In der modernen Stilistik des 20. Jahrhunderts wird auch die Auffas-
sung vertreten, dass sich der sprachliche Stil in den Abweichungen
von einer sprachlichen Gebrauchsnorm äußert. In
neueren Untersuchungen wird das XXfescn der poetischen Sprache allge-
mein als Abweichung von anderen Sprachnormen verstanden. Der Stil-
charakter wird dabei nur außergewöhnlichen Sprachgestaltungen vorbe-
halten, die aus kommunikativen Ausdrucksformen ausgeklammert wer-
den. Auch ist der Begriff der sprachlichen Norm wie der der Abwei-
chung davon klar festlegbar. Was als ungewöhnlich oder gar normwidrig
angesehen werden müsste, hängt oft von subjektiven Erwägungen oder
situativen Bedingtheiten ab. Aber die Bedeutung des Irregulären als Stil-
mittel dürfte jedoch in einer stilistischer Forschung nicht unberücksich-
tigt bleiben. Die Vorstellung von einer gattungs- und zweckgebundenen
Stilprägung, die sich schon in Stilistiken des 18. und 19. Jahrhunderts
findet, ist im 20. Jahrhundert vor allem unter dem Einfluss der russi-
schen und tschechischen Stilistik zu einem Modell mehrerer funktiona-
ler Stile ausgeweitet worden. Innerhalb der funktionalen Stilistik wird
vorausgesetzt, dass es mehrere funktional bedingte Bereiche der sprach-
lichen Verwendung gibt, in denen bestimmte charakteristische Stilmerk-
male dominieren (siehe Näheres im Kapitel über funktionale Stile). Die
funktionale Stilauffassung betont zwei wichtige Aspekte der Stilistik:
1) den Stilcharakter aller sprachlichen Äußerungen und 2) die Auffas-
sung vom Stil als einer funktional bedingten Wirkungsform der Sprache.
7
Der Stilbegriff der funktionalen Stilistik deckt sich weit gehend mit
der Stilauffassung der didaktischen Stilistik, die eine Lehre vom guten,
d.h. „angemessenen“ Stil darstellt. Innerhalb der didaktischen Stilistik
werden oft bestimmte Stilregeln verkündet, die selten hinlänglich durch
praktische Umsetzungen untermauert sind. Zum Beispiel wird in der di-
daktischen Stilistik eine Anweisung erteilt, möglichst oft Verben statt
Substantive zu verwenden. Aber sie ist dort wenig sinnvoll, wo es z. B.
um eine wissenschaftliche Arbeit geht, deren Formulierungen eine be-
sonders exakte Begrifflichkeit und dadurch einen ausgesprochenen No-
minalstil verlangen. Aber es scheint sinnvoll zu sein, wenn die didakti-
sche Stilistik die Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsicht, Aus-
drucksmitteln und Ausdruckswirkungen expliziert.
Die Autorinnen akzeptieren in ihren theoretischen Ausführungen
und praktischen Beurteilungen all das, was die stilistische Lehre an we-
sentlichen Leistungen erbracht hat, aber gehen davon aus, was die lin-
guistische Stilistik betont herausstreicht. Stil bedeutet hier, dass jedem
Redeprodukt eine Auswahl aus den vorhandenen syntaktischen und le-
xikalischen Mitteln der Sprache zu Grunde liegt. Die Auswahl erfolgt in
individueller Weise und äußert sich in gesetzmäßiger Wie-
derkehr bestimmter Stilmittel und Stilverfahren. Diese Auffassung er-
möglicht alle sprachlichen Äußerungen in das Blick- und Untersu-
chungsfeld des Forschers einzubeziehen und anzuerkennen, dass der
Stil auf wiederholtem Gebrauch und bestimmter Anordnung der Stil-
mittel beruht, die einen Text den anderen gegenüber abheben. Entschei-
dend für die Selektion und Anordnung bestimmter sprachlicher Variati-
onsmöglichkeiten ist die Ausdrucksabsicht, die ihrerseits komplexer Na-
tur ist und individuell psychologische, individuell schöpferische, gat-
tungs- und funktionalstilmäßige sowie kommunikationsspezifische An-
sätze umfasst.
Teil I
WORT UND WORTKONFIGURATIONEN
ALS QUELLE STILISTISCHER EFFEKTE
Kapitel 1
ZUM WESEN DER STILISTISCHEN PHÄNOMENE
§ 1. Stilistische Qualitäten der sprachlichen Einheiten
Im 20. Jh. haben viele Sprachforscherund Stilforscher unzählige Ver-
suche unternommen das Wesen des Stilistischen zu erfassen. Die einen
sahen es darin, wie die Sprachinhalte ausgestaltet werden, um zu Rede-
inhalten werden zu können und somit eine interpersonelle Kommuni-
kation zu ermöglichen. Die anderen suchten das Stilistische dort zu fin-
den, wo in der sprachlichen Einheit die Bedeutung liegt. Immer wieder
entstand die Frage: Steckt das Stilistische schon in der lexikalischen Be-
deutung drin oder liegt es daneben?
Die bekannte Stilforscherin E. R i e s e 1 wies in ihren Arbeiten darauf
hin, dass die Wartbedeutung komplex ist und zumindest drei Kompo-
nenten enthält: die denotative, signifikative und konnotative. Diese
Komponenten ergeben sich aus den Funktionen des Wortzeichens. Bei
diesem Herangehen an das Stilistische wird die Bedeutung als ein gesell-
schaftlich determiniertes interindividuelles Abbild der Merkmalstruktur
einer Erscheinung der objektiven Realität aufgefasst.
Die denotative Komponente sei dabei, die in einer sprachlichen
Äußerung realisierte Funktion des Wartzeichens, eine bestimmte Er-
scheinung der objektiven Realität (Denotat) zu repräsentieren.
Die signifikative Komponente sei die Funktion des Wortzeichens, das
invariante (interindividuelle) Abbild der Merkmalstruktur einer Er-
scheinung der objektiven Realität zu sein. Die signifikative Komponente
macht es möglich zu verallgemeinern und zu abstrahieren, d. h. ganze
Klassen von Gegenständen zu benennen.
Die konnotative Komponente ergibt sich aus wertenden semantischen
Merkmalen der denotativ-signifikativen Bedeutung der Wörter. Die Kon-
notation hat also semantische Beschaffenheit. Sie drückt ein emotiv
wertendes Verhältnis des Redesubjekts zur Wirklichkeit aus. Wenn
man z. B. sagt Das ist ja kein Kaffee, das ist ein Blümchen, meint man, dass
dieser Kaffee nicht genug stark ist, zu dünn ist, so dass man das Muster
auf dem Tassenboden leicht sehen kann. Wenn H. Heine in seinem Poem
„Deutschland. Ein Wintermärchen“ über das deutsche Volk schreibt, das
er tief und innig liebt und mit dem er unermessliches Mitleid empfindet:
9
Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Liitnmel.
lesen wir aus der Benennung „der große Lümmel“ seine Bitternis, seine
innere Betroffenheit darüber heraus, dass das Volk seine Unfreiheit, sei-
ne verzweifelt miserable Situation nicht begreift und sich auch noch wei-
ter betrügen lässt. Die Konnotation ist dementsprechend eine Wertung,
und die Wertung muss mit der Expression bei der Wahrnehmung verbun-
den sein. Die konnotative Bedeutung ist ein Ergebnis der sekundären
Nomination, ein Ergebnis der Umdeutung, wobei rationelle Wertungen
mit Emotionen durchsetzt werden.
Die sekundäre Nomination erfolgt auf Grund der Analogie und die
letzte wird in TYopen umgesetzt, d. h. in bildlichen und bildkräftigen
Ausdrucksweisen. Die Nomination ist ein Prozess, ein Mechanismus,
nicht zufällig sagt man, dass die Sprache funktioniert, wenn sie in den
Kommunikationsprozess gerät. Deshalb wird die Erscheinung der ob-
jektiven Realität von vornherein mit einer bestimmten Einstellung des
Subjekts der Rede nominiert oder sprachlich bezeichnet. Das Redesub-
jekt steht bei der Nomination vor der Wahl, einen positiven oder negati-
ven Effekt herauszustreichen oder umgekehrt neutral zu bleiben. Wir
setzen voraus, dass das emotive Verhältnis selbst dabei die wertende Mo-
dalität und die stilistische Markierung im weiten Sinne des Wortes, z. B.
gehoben, gesenkt, gespreizt usw. einschließen kann.
Für die verschiedenen stilistischen Markierungen hat E. R i e s e 1 eine
Wertskala aufgestellt [s. Riesel, 1963,26], Sie führt von der einfach-litera-
rischen Stilfärbung nach zwei Seiten: nach der einen Seite zur Ebene des
gehobenen, feierlichen Stils bis hin zum geschwollenen Stil, nach der an-
deren Seite — über verschiedene Stufen des umgangssprachlichen Stils bis
zum groben, gemeinen Ausdruck. Für jeden Begriff lassen sich auf den
Skalenpunkten stilistisch entsprechend gefärbte sinnverwandte Wörter
einsetzen:
die Seele aushauchen
entschlafen, verscheiden
sterben
ins Gras beißen
krepieren, verrecken
geschwollen/gespreizt
gewählt/gehoben
einfach-literarisch
1
umgangssprachlich
J/ . -
grob/vulgar
Die Riesel’sche Skala verhilft zu einem Überblick über die mögli-
chen stilistischen Markierungen des Wortes. Man muss über die mögli-
chen stilistischen Potenzen eines Wortes Bescheid wissen, um es stilge-
recht in einem Text einsetzen zu können. Fügt man ein Wort mit um-
gangssprachlicher Färbung in einen Text gehobenen Charakters, dann
kommt es zu einem S t i 1 b r u c h. In einer feierlichen Gedenkrede wäre
10
es vollkommen stilwidrig, wenn man vom Verstorbenen sagte, dass er
nun leider „ins Gras beißen musste“.
Aber man muss verstehen, dass derartige Zuordnungen eines Wortes
nicht absolut genommen werden dürfen. Sehr oft weisen Wörter und
Wendungen, die isoliert betrachtet werden, einfach-literarische Färbung
auf, aber im Textzusammenhang nehmen sie eine besondere Stilfärbung
an. Eine genaue Bestimmung der Stilqualität eines Wbrtes ist erst mög-
lich, wenn es in einen Sinnzusammenhang einbezogen ist. Zum
Beispiel ist das Wort „Schwein“ als Bezeichnung des Haustieres einfach-
literarisch, als sinnverwandtes Wort zu „Glück“ familiär-umgangs-
sprachlich und als Schimpfwort grob gefärbt.
§ 2. Stil und Expressivität
Das Wesen des Stilistischen beschränkt sich aber nicht darauf, dass
eine sprachliche Gegebenheit stilistisch (wie oben gezeigt) markiert ist.
Die meisten Verfechter der Linguostilistik vertreten die Auffassung, dass
jedem Text Stil eignet und dass auch die normgemäße Ausdrucksweise
als „stilistisch“ zu kennzeichnen sei. Die normgemäße Ausdrucksweise
kann als „expressiv merkmallos“ bezeichnet werden, aber nicht als „sti-
listisch merkmallos“.
Das Wesen der Expressivität sehen die Linguisten nicht nur in einer
emotionalen Abweichung von der gegebenen Norm, sondern auch in einer
gedanklich motivierten Hervorhebung. So spricht W. S c h m i d t nicht
nur von emotional bedingter Expressivität, sondern auch von einer sach-
lichen Hervorhebung, die man auch dem Begriff „Expressivität“ zuord-
nen kann [vgl. Schmidt, 1967, 264]. Als Beispiel könnte man folgende
Ausdrucksweisen anfuhren:
— emotional bedingte Hervorhebung:
Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten'. (H. Heine. „Wintermärchen“);
— sachlich betonte Hervorhebung:
Für einen Wirtschaftsaufschwung ist der Wille entscheidend und nicht
der optimale Zuwachs oder Leistungsbilanz (Tagespresse).
Hervorhebung, Abweichung von der üblichen grammatischen
Konstruktion ist beides. Im ersten Fall ist sie mit einer emotiona-
len Aufladung verbunden, im zweiten Fall — mit einer er-
kenntnismäßigen Akzentuierung. Oft ist aber eine stren-
ge Trennung zwischen den beiden Arten nur schwer möglich. Expres-
sivität kann einerseits systemintern sein (z.B. expressiv abge-
stufte Synonyme: Gesicht— Visage), sie kann auch andererseits durch
die Art der Sprachverwendung seitens des Sprechers er-
zeugt werden, zum Beispiel durch auffällige Kombinatio-
nen von Stilelementen im Text. Auch vom Sprachsystem her kön-
nen nullexpressive Ausdrucksmittel durch die Anordnung im
11
Text hervorgehoben werden. Als Beispiel sei hier eine Strophe aus
H. Heines „Junge Leiden“ zitiert:
Mein Kind, wir waren Kinder,
Zwei Kinder, klein und froh;
Wir krochen ins Hühnerhäuschen,
Versteckten uns unter das Stroh.
Die Wörter „Kind, klein, froh, Stroh“ usw. sind nicht expressiv. Ihre
Anordnung im Text aber ist poetisch motiviert und erzeugt Ex-
pressivität. In solchen Fällen sprechen wir von konstruktionsbedingter
oder sprecherbedingter Expressivität.
Die Orientierung des Stilistischen und somit der Stilistik auf emotio-
nal-expressive Färbungen wäre sehr wichtig aber bei weitem nicht aus-
reichend. Bei aller Anerkennung der Bedeutsamkeit emotional-expres-
siver Färbungen ist für die Stilistik auch der primäre begriffli-
che Gehalt der sprachlichen Mittel von großer Bedeutung. Er spielt
bei Fragen der Wortwahl die grundlegende Rolle und ist stilistisch rele-
vant. Es ist z. B. möglich zu formulieren:
— Er sagte, dass er...
— Er meinte, dass er...
— Er führte aus, dass er...
— Er äußerte, dass er...
— Erbrachte zum Ausdruck, dass er...
Die hier verwendeten Verben der Redeeinführung unterscheiden sich
nicht durch besondere nicht begriffliche Färbungen (wie etwa „sterben“
und „verscheiden“). Sie werden mit gleichem Denotatsbezug gebraucht
und der Sprecher hat die Möglichkeit zwischen ihnen zu wählen. Die Spra-
che räumt dem Sprecher einen Entscheidungsspielraum und der Sprecher
kann diesen Spielraum im Interesse einer optimalen Kommunikation aus-
nutzen. Innerhalb einer Reihe bedeutungsähnlicher Ausdrucksmöglichkei-
ten entscheidet sich der Sprecher zur Realisierung einer bestimmten kom-
munikativen Absicht für einen treffenderen, sach- und zielgerechteren Aus-
druck. Diese Tatsache beschränkt sich nicht auf sprachliche Mittel mit be-
sonderer Färbung, sondern auch auf die große Masse der äquivalenten Aus-
drucksmittel innerhalb des Sprachsystems ohne besondere Färbung.
§ 3. Stil als aktualisierte Variationsmöglichkeiten
In der Stilistik ist das Denkmodell der Wrianz—Invarianz bei der Be-
stimmung des Stilbegriffs verbreitet. Dieses Modell basiert auf der Vorstel-
lung, dass es möglich ist, einen Sachverhalt sprachlich auf unter-
schiedliche Weise wiederzugeben [s. Fleischer, Michel, 1977, 47].
Stil bedeutet hier, dass aus den vorhandenen syntaktischen und lexikologi-
schen Möglichkeiten der Sprache zur Ausgestaltung eines Textes nur ein-
zelne, auf individuelle Weise ausgewählte Möglichkeiten verwendet werden.
12
Die meisten Gegebenheiten und Informationen sind sprachlich in mehrfa-
cher Weise gestaltbar. Verschiedene Ausdrucksvariationen können einander
innerhalb eines bestimmten Sinnzusammenhanges ersetzen. Im Bereich
des Wortschatzes werden solche bedeutungsähnlichen Wörter als S y-
nonyme, auch bedeutungsähnliche Aussagen oder Sätze
angesehen. Als Synonyme können auch bestimmte grammatische Struktu-
ren gelten. An Stelle des Aktivs kann z. B. das Passiv erscheinen, an Stelle
des Adjektivattributs ein prädikatives Adjektiv usw. Wir stellen im Folgen-
den einige lexikalisch und stilistisch relevante Synonyme gegenüber
1) Urlaub — Ferien', Wagen — Auto; Premiere — Uraufführung; arbeiten—
schaffen;
2) der feige Soldat — der Soldat ist feige; die uneigennützige Hilfe — die Hilfe
ist uneigennützig;
3) Mein Nachbar ist Betriebswirt. — Der Mann nebenan arbeitet als Betriebs-
wirt. — Mein Nachbar, der Betriebswirt, ist jetzt...
In den Synonymwörterbüchern der Einzelsprachen werden Überein-
stimmungen in lexikalischer Reihenfolge dargeboten. Wir wählen einige
Beispiele: die Angst, die Furcht, der Schreckten). Die drei Substantive be-
zeichnen das Gefühl der Bangigkeit, der Beängstigung. Das Substantiv
„Angst“ drückt den Begriff allgemeiner aus, „Furcht“ und „Schrecken“
deuten auf einen höheren Grad dieses Gefühls. Im Vergleich zu „Angst“
und „Furcht“ ist „Schrecken“ nie von langer Dauer.
Verben bitten und ersuchen bedeuten „sich mit einer Bitte an jeman-
den wenden“. Das Verb „ersuchen“ wird bei offiziellen Gelegenheiten
gebraucht. In dem gleichen Fall gebraucht, steht „bitten“ hauptsächlich
im Passiv. Die beiden Verben stehen mit einem Akkusativ der Person
und mit dem präpositionalen Objekt um + Akk. bzw. einem unabhängi-
gen Infinitiv. Aber die beiden Verben weisen auch Verschiedenes auf:
„bitten“ bedeutet auch „sich für jemanden einsetzen“ und steht hier mit
der präpositionaler Wendung für + Akk., z. B. Ich bitte ja nicht für mich,
ich bitte für ihn. Außerdem bedeutet „bitten“ auch „jemand zu einer
Veranstaltung einladen, zum Betreten eines Raumes auffordern“ und
wird hier mit dem präpositionalen Objekt zu + Dat. oder in + Akk. ge-
braucht, z. B. zum Tee bitten, ins Zimmer bitten.
Die semantischen Synonyme müssen in der Stilistik als sprachliche
Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte Informationen angesehen wer-
den, aus denen der jeweilige Sprecher beim Sprechvorgang (bzw. bei sei-
ner Umsetzung in die Schrift) eine bestimmte Wahl treffen kann. Dieser
Vorgang vollzieht sich nicht immer bewusst, die Auswahl aus den
sprachlichen Möglichkeiten kann von der Situation, dem bewussten
Zweck, dem Kontext (im weitesten Sinne), der Psyche und Erfahrung
des Sprechers und anderen Faktoren bestimmt sein. Auch sind dabei
nicht alle Elemente der Aussage durch Synonyme ersetzbar. In jedem
Fall handelt es sich um die Einkleidung einer Information in eine be-
stimmte, aus mehreren Möglichkeiten ausgewählte Mitteilungsform, in
13
einen Code. Die sprachliche Einkleidung wird deshalb als Enkodie-
rungsvorgang bezeichnet. Die Aufnahme und Auflösung einer solcher
Mitteilung nennt man dabei den Dekodierungsvorgang. Zu beachten ist
allerdings, dass nicht alle Elemente einer sprachlichen Äußerung
variabel sind. Bestimmte Einheiten einer Äußerung bleiben auch bei
Änderungen der Mitteilungsform konstant, weil sich der Mitteilungsin-
halt nicht grundsätzlich ändern soll. Bei diesen unveränderlichen Kons-
tanten handelt es sich zunächst um Elemente der Information selbst,
z.B. Angaben von Namen, Orten, Meinungen, Zeitpunkten u.dgl. Fer-
ner gehören dazu bestimmte sprachliche Rollenbesetzungen, z. B. Kau-
salverhältnisse, Bedingungen, Konsequenzen usw. Der Grund darf nicht
in eine Folge umgewandelt werden und die Konsequenz darf kaum mit
Bedingung gleichgesetzt werden. Die stilistische Gestaltungsfreiheit be-
zieht sich nur auf die primären Formmöglichkeiten der Enkodierung ei-
ner Information, also auf die Wahl der syntaktisch-grammatischen Ein-
heiten, der Satzgliedstellung und Wortwahl. Es gibt aber grammatische
Regularitäten, die einem Sprachsystem eigen sind, welche unter keinen
Umständen austauschbar sind, z.B. Rektion der Verben. Es muss aber
anerkannt werden, dass verschiedenen sprachlichen Äußerungen dersel-
be Sachverhalt zu Grunde liegen kann. Zwei Fassungen eines Sachver-
halts mögen das veranschaulichen:
1. Claudia Dübner, Partnerin der Neumann Managementberatung, präsen-
tierte anlässlich einer Veranstaltung zum Thema „Anforderungsprofile an Eu-
romanager und EU-Berater“ eine Liste von Erfolgsfaktoren. Eingeladen hat sie
die Vereinigung von Studenten und Absolventen eines gemeinsamen interna-
tionalen Zusatzausbildungsprogramms von zwölf europäischen Wirtschaftsuni-
versitäten, darunter die WU Wien. Die Liste von Erfolgsfaktoren gibt vor, dass
richtige Euromanager Männer sein und ein Wirtschaftsstudium ausweisen sol-
len. Sie haben einen MBA, ein bis drei Jahre Ausländserfahrung und perfekte
Englisch- und Französischkenntnisse. Sie besitzen Kenntnisse im Bereich der
nationalen Kulturen, verfügen über Erfahrung in Führungsfunktionen. Sie sind
im Stande, sich durchzusetzen, streben nach höheren Leistungen, sie haben
keine Scheu vor Entscheidungen, sie passen sich leicht der Situation an, nicht
weniger leicht als Chamäleons. Und sie sind fähig die anderen zu motivieren
und zu führen.
2. Echte Euromanager sind männlich, haben Wirtschaft studiert, einen
MBA, ein bis drei Jahre Ausländserfahrung, beherrschen Englisch und Fran-
zösisch wie ihre Muttersprache, verfügen über interkulturelle Kompetenz,
haben Führungserfahrung und Durchsetzungsvermögen, sind leistungsorien-
tiert, entscheidungsfreudig und anpassungsfähig wie Chamäleons. Und sie
haben Charisma. So lautet zumindest die Liste von Erfolgsfaktoren, die Clau-
dia Dübner, Partnerin der Neumann Managementberatung, anlässlich einer
Veranstaltung zum Thema „Anforderungsprofile an Euromanager und
EU-Berater“ präsentierte. Eingeladen hat sie die Vereinigung von Studenten
und Absolventen eines gemeinsamen internationalen Zusatzausbildungspro-
gramms von zwölf europäischen Wirtschaftsuniversitäten, darunter die Wirt-
schaftsuniversität Wien.
14
Beide Fassungen beziehen sich auf denselben Sachverhalt. In den
Unterschieden der Texte drücken sich Unterschiede in der Art der Ab-
bildung, der Widerspiegelung des Sachverhalts im Bewusstsein des Au-
tors aus. Das sprachlich fixierte Abbild ist im Text 2 anders struk-
turiert als im Text/: die Abbildeelemente sind anders aufeinander be-
zogen. Aber nicht nur der Sachverhalt ist diesen Texten gemeinsam. Die
fixierten Abbilder sind objektiv bestimmt und weisen auch Gemeinsa-
mes auf. Diese teilweise Identität ist die Invarianz oder die Invariante
beider Texte [vgl. Fleischer, Michel, 1977, 48]. Für die Ermittlung des
Stils ist nicht so sehr die Invarianz, viel mehr die "Varianz (Variante) ent-
scheidend. Sie drückt sich in den Unterschieden von Texten mit glei-
chem Sachverhaltsbezug aus, also in den Besonderheiten eines Textes
gegenüber dem anderen Text. Die Variante hängt mit der Subjektivität
der Widerspiegelung zusammen. Sie ist subjektiv b e d i n g t. Es ist
nicht schwer herauszufinden, an welchen Stellen im Text die Variante
steckt und an welchen die Invarianten. Variabel ist hier der Satzbau,
Wbrtstruktur, Satzfolge, Gliederung in Satzeinheiten und Absätze,
Wortwahl usw.
Invariabel bleiben neben dem Sachverhalt Namen (Personennamen
und Institutionsnamen), Themenangaben, Ortsrealien, Zahlenrealien.
Man könnte das Stilistische aus der Sicht der Varianz—Invarianz als rea-
lisierte semantische Tiefenstruktur und nämlich der Information oder
Mitteilung auffassen.
Die Auffassung des Stils als Ergebnis einer bestimmten Wahl von
sprachlichen Gegebenheiten aus verschiedenen Möglichkeiten inner-
halb des Ausdrucksinventars einer Sprache ist heute die bisher umfas-
sendste Stiltheorie. Wir werden daher diese Stilauffassung unseren nach-
folgenden Darstellungen zu Grunde legen. Unter Stil verstehen wir in
vollem Einvernehmen mit Bernhard Sowinski [Sowinski, 1973, 27] Fol-
gendes:
„Stil ist eine in sich verhältnismäßig einheitliche, anderen Texten ge-
genüber jeweils unterschiedliche Form des wiederholten Gebrauchs be-
stimmter sprachlicher Variationsmöglichkeiten für bestimmte Ausdrucksab-
sichten“
§4. Stilelemente
Das Wesen des Stilistischen steckt in der Auswahl der Varianten. Aber
ob alle Varianten stilistisch bedeutsam sind? Als stilistisch können nur sol-
che Varianten angesehen werden, die sich nicht aus obligatorischen Re-
geln der Grammatik, den verbindlichen Gesetzmäßigkeiten der Wortbil-
dung und des semantischen Systems der gegebenen Sprache ableiten las-
sen. Folglich sind nur solche Elemente als stilistisch zu bezeichnen, die
sich als fakultative Varianten erweisen. Damit sind jene Varianten Elemen-
te gemeint, die auf Grund der synonymischen Möglichkeiten der Sprache
15
ausgetauscht, weggelassen oder hinzugefügt werden können. Wollen wir
das am Beispiel von zwei Aussagen veranschaulichen:
1. Die Einträglichkeit des Unternehmens bestimmt wesentlich die Höhe von
Ausschüttungen an Aktionäre.
2. Die an Anteilseigner ausgezahlten Dividende werden in hohem Maße durch
die Rentabilität des Unternehmens bestimmt.
Die beiden ersten Äußerungen beziehen sich auf denselben Sachver-
halt. Sie weisen invariante und Variante Elemente auf. Zu den Varianten
sind unter anderem die Besonderheiten zu zählen, die durch die Wa h 1
zwischen Aktiv und Passiv bedingt sind. DieseXärianz ergibt
sich aus der Bildungsweise und dem Strukturwert der beiden Genera.
Die Entscheidung des Sprechers, den passivischen Satz statt des aktivi-
schen zu gebrauchen, war frei und nur an seine (des Sprechers) Absicht
gebunden. Aber nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, hat der
Sprecher bei der grammatischen Ausgestaltung der Aussagen viel weni-
ger Spielraum. Er muss davon ausgehen, dass das Agens in Form des
Nominativs im passivischen Satz die Form eines präpositionalen Kasus
annimmt. (Die Entscheidung für Passiv war stilistisch relevant, aber die
syntaktischen Umstellungen, die bei der passivischen Transformation
verbindlich sind, dürfen kaum als stilistisch bedeutsam angesehen wer-
den.) Zu den Variationen von der Formseite her können wir den
Wechsel des Wortbildungstyps und der Wortart rech-
nen: wesentlich — in hohem Maße, Aktionär — Aktienhaber, die Ausschüt-
tung — die ausgezahlten Dividende. Doch neben den formalen Unter-
schieden umfasst die Variation auch semantische Elemente. Die inhalt-
liche und formale Komponente der sprachlichen Mittel bzw. komplexer
sprachlicher Äußerungen stehen in einer We chselbeziehung: be-
stimmte formale Veränderungen führen zu inhaltlichen Nuancierungen,
und jede inhaltliche Veränderung erfordert ihre spezifischen sprachli-
chen Formen. So bedingt der Gebrauch des Passivs statt des Aktivs, dass
die Handlungsrichtung abgeändert wird. Mit der Wahl des Passivs sind
aber nicht alle Möglichkeiten der Variation erschöpft. Für „Einträglich-
keit“ gibt es Rentabilität oder Ertrag, für „Ausschüttungen“ gibt es Divi-
dende, für „Aktionäre“ — Anteilseigner und Aktienhaber.
Art und Grenzen der fakultativen Variation sind abhängig von den
obligatorisch bedingten Besonderheiten der Rede, denen wiederum eine
Entscheidung zwischen fakultativen Möglichkeiten vorangegangen ist.
Der Begriff „Redestil“ bezieht sich dementsprechend sowohl auf die
formale als auch auf die inhaltliche Seite der sprachlichen Äußerung.
Was die Form der Rede angeht, gibt es hier bestimmte Elemente, die
außerhalb der Variation stehen. Hier handelt es sich nicht um Elemente,
die durch den sprachlich dazustellenden Sachverhalt bedingt sind, son-
dern um solche, die durch grundsätzliche Strukturbesonderhei-
ten der gegebenen Sprache, durch die allgemeinen Merkmale des Satz-
baues bestimmt sind.
16
Der Begriff „Stil“ darf jedoch nicht mit der gesamten Form der Rede
bzw. mit dem gesamten Inhalt der Rede gleichgesetzt werden, da es sich
nur auf die Varianten Form- und Inhaltselemente der Rede innerhalb ei-
ner synonymischen Reihe von Ausdrucksmöglichkeiten orientiert. Da
jede Rede fakultative Elemente aufweist, besitzt auch jede Rede Stil.
Jede Rede ist die Realisierung nur einer unter mehreren synonymi-
schen Möglichkeiten. Stilistisch von Bedeutung sind die vom Sprecher
wählbaren, nicht die obligatorischen Ausdrucksmittel. Aber die Spiel-
räume des Sprechers sind nicht beliebig breit. Der Verwendung der fa-
kultativen Varianten sind Grenzen gesetzt, da es gesellschaftliche, histo-
risch bedingte Normen gibt.
§ 5. Determinanten des Stils
Vorher haben wir schon darauf hingewiesen, dass der Stil da einsetzt,
wo die Auswahl, d. h. Austauschbarkeit und Kombinierbarkeit beginnen.
Demnach wären in zwei und mehr Texten mit gleichem Objektbezug die
sprachlichen Varianten, die subjektbedingt (sprecherbedingt) sind, fa-
kultativ. Die Entscheidung für Aktiv/Passiv, direkte/indirekte Rede,
nullexpressive/expressive Satzgliedfolge, Wortgruppe/Kompositum usw.
ist dem Sprecher nicht vom Sprachsystem her diktiert, solche Entschei-
dung wird auf Grund sprachexterner Bedingungen reguliert.
Fast in allen wissenschaftlichen Werken wird herausgestrichen, dass
der Stil nicht die Summe einzelner Stilmittel ist, sondern Ganzheits-
charakter hat. Es genügt noch nicht alle Stilmittel eines Textes rest-
los aufzuzählen und zu beschreiben. Die Ganzheit ist immer ein System
von Teilen, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen.
Wenn der Stil eines Textes als Ganzheit aufgefasst wird, so tritt die
Frage auf, was seine „Teile“ sind. Wir halten es für zweckmäßig, diese
„Teile“ als Stilelemente zu bezeichnen.
Stilelemente sind variable sprachliche Erscheinungen eines Textes, die
bei gleich bleibendem denotativen Bezug auf Substitution und Kombination
beruhen.
Es sind Elemente auf verschiedenen linguistischen Ebenen, die in
hierarchischer Beziehung zueinander stehen (fonetisch-prosodische,
morphematische, lexematische, Wortgruppen-, Satz- und Satzkombi-
nationsebene) [vgl. Fleischer, Michel, 1977, 65].
Im Falle der Stilelemente handelt es sich um die Ganzheiten indivi-
dueller zweckgebundener Sprachverwendung. Substituierbarkeit oder
Kombinierbarkeit der Stilelemente beruht darauf, dass der Redesubjekt
(Sprecher) die realen Sachverhalte in seinem Bewusstsein abbildet, die
Kenntnisse über diese Sachverhalte aufbewahrt, verwendet, übermittelt
und transformiert, je nachdem welches Ziel bei der Kommunikation
verfolgt wird. Es bedeutet, dass der Sprecher die Kenntnis über die rea-
len Sachverhalte verarbeitet. Das Resultat der Verarbeitung charakteri-
17
siert man in solchen Termini, wie Raster, Frame, Skript usw. Indem der
Mensch in einer bestimmten Kultur aufwächst, eignet er sich ganze Stil-
und Beziehungsfelder oder sogar Räume an, die dann in seinem sprach-
lichen Bewusstsein angespeichert werden. Er weiß z. B., dass der Raster
„Wald“ nicht nur die Bezeichnungen der einzelnen Baumarten ein-
schließt, sondern auch Vögel und Tiere, die in diesem Wäld hausen. Je
mehr Erfahrung er sich im Umgang mit den Elementen des Rasters
„Wald“ aneignet, desto mehr Elemente kann er in dieses Begriffsfeld
einschließen, z. B. Gefahr, Stille, zielloses Umherirren usw. Wie wir sehen,
können diese Elemente so ziemlich weit von den Kembezeichnungen
entfernt liegen und sich assoziativ an diese angliedem. Den Assoziatio-
nen liegen dabei eigene oder angelernte Erfahrungen zu Grunde. Der
Mensch eignet sich die Welt an und ordnet sie, indem er die Abbilder
der Realität in seinem Bewusstsein verarbeitet. Der Prozess der Verar-
beitung trägt heute die Bezeichnung „Kognition“. Die Kognition sorgt
nicht nur dafür, dass im sprachlichen Bewusstsein die Bedeutung oder
der Sinn herausgebildet werden, sondern auch für die Vielfalt der
möglichen Beziehungen zwischen diesen Bedeutungen. Bezie-
hungen und Bedeutungen sind schon Bausteine dafür, dass der Mensch
im Rahmen einer bestimmten Kultur diese Bedeutungen und Beziehun-
gen im Kommunikationsakt präsentiert.
Die verbale Kommunikation ist darauf gerichtet, das Normgemäße
im Gebrauch von Bedeutungen, Interpretationen und Begriffen zu ver-
einbaren. Wenn sich der Sprecher für eine Bedeutung (repräsentiert
durch ein Lexem) und für eine Beziehung (repräsentiert z. B. durch eine
attributive Gruppe) entscheidet, stützt er sich auf sein assoziatives Ge-
dächtnis. Das Letzte stellt ein Netz von Gegenüberstellungen, Opposi-
tionen dar, welches eine schnelle Identifikation der bekannten Elemente
ermöglicht und schnellen Zugang zum entsprechenden Informations-
fragment sichert. Das Xferfahren selbst, wie die Information sprachlich
vor- und dargestellt wird, steht mit der soziokulturellen Erfahrung des
Sprechers im Einklang. Erworbene und angespeicherte Kenntnisse über
reale Sachverhalte sind an einen Vorrat von kognitiven Strateg i-
e n gebunden, welche ihrerseits daraus erwachsen, dass der Mensch im
Prozess seiner Entwicklung immer neue kommunikative Bereiche er-
schließt. Wenn das Kind das Wort „Stroh“ nur von der Bedeutung her
wusste, dass es Reste des Getreides nach der Mahd sind, gerät es mit der
Zeit in die Situation, wo die Leute nur über nichtige Belange sprechen,
wobei das Wichtige bewusst oder unbewusst verschwiegen wird, und
weiß Bescheid, was „leeres Stroh dreschen“ bedeutet.
In gleichem Maße wie der Sprecher determiniert der Hörer/Leser
die Auswahl und Anordnung der Stilelemente. Unsere Kenntnisse über
die Welt sind durch das Bedeutungsfeld strukturiert. Der Mensch sieht
die Welt durch das Bedeutungsfeld, welches mit der Hierarchie der
menschlichen Tätigkeiten korrespondiert. Das Bedeutungsfeld ist
durch das Xferhältnis des Menschen zur Wirklichkeit gefärbt und reali-
18
siert sich durch den Sinn. Der Sinn ist sozusagen der Eindruckswert,
der die Seite der Wahrnehmung charakterisiert. Für das Verstehen des
Textes ist nicht nur die Kenntnis der Sprache erforderlich, sondern
auch wechselseitig verbundene und aufeinander bezogene Informatio-
nen, die den Inhalt des Textes betreffen. Die Struktur und Semantik
des Textes bilden einen Teil des komplizierten Mechanismus, der an-
dere Teil dieses Mechanismus ist im Bewusstsein und Gedächtnis des
wahrnehmenden Individuums enthalten. Wenn diese zwei Teile in
Wechselwirkung treten, kommt es zum Wahrnehmen und Verstehen.
Für das Verstehen sind mindestens drei Bedingungen notwendig:
1) das Vorhandensein einer gemeinsamen Sprache;
2) das Zusammenwirken, welches zumindest zwei Partner voraus-
setzt, die gemeinsam handeln;
3) das Vorhandensein der Vorstellung über das Thema des Textes
beim Rezipienten (Empfänger).
Die neue Information kann z. B. beim Lesen erst dann angeeignet
werden, wenn bestimmte kognitive Strukturen im sprachlichen Be-
wusstsein des Empfängers schon vorhanden sind. Die ungenügende
Kenntnis beschränkt das Verstehen, weil der Empfänger noch eine ge-
wisse Struktur der Kenntnis über das vorgegebene Material erarbeiten
muss. Beim Verstehen erfolgt eine folgerichtige Abänderung der Situati-
on, die im Bewusstsein des Wahmehmenden wiederhergestellt wird. Da-
bei verändert sich die Bedeutsamkeit der Verbindungen zwischen den
Elementen der Situation. Das Hauptglied des Verstehens besteht nicht
nur in der Ermittlung der Beziehungen, sondern auch in der Bestim-
mung der Bedeutsamkeit dieser Verbindungen. Im Ergebnis
bildet sich das Bild des allgemeinen Sinnes des Textes, sein Konzept,
heraus. Somit ist es für das Verstehen des Textes wichtig, bedeutsame
Verbindungen zwischen den Elementen hierarchisch aufzustellen. Das
genügt aber nicht. Das richtige, adäquate Verstehen setzt voraus, dass
auch die kommunikative Absicht des Redeabsenders adäquat verstanden
wird. Das, was wir im Text sehen, hängt von vielen Umständen ab: von
dem Ziel, mit dem wir den Text lesen oder hören, von unseren inneren
Einstellungen, von dem Maße, in dem unsere Erkenntnisfähigkeiten
und Fertigkeiten ausgeformt sind usw. Aber bei der Wahrnehmung sind
allen Interpretationsfreiheiten auch Grenzen gesetzt. Der objektive In-
halt des Textes, sein Konzept dürfen bei der adäquaten Wahrnehmung
nicht übersehen und nicht verfälscht werden.
Die Faktoren, die den Stil und somit die Auswahl der optimalen
sprachlichen Möglichkeiten beeinflussen, sind sehr mannigfaltig und
lassen sich kaum erschöpfend darstellen. Hier wollen wir nur noch eini-
gen davon unsere Aufmerksamkeit schenken. Nehmen wir z. B. die Ver-
ständigungssituation. Andere Länder, andere Sitten — das gilt nicht zu-
letzt auch für die Auswahl der sprachlichen Möglichkeiten. Derbritische
Biologe Desmond Morris teilt die Nationen nach so genannten
Armzonen ein:
19
1. In „Ellenbogen-Ländern“ wie Spanien, Italien, Griechenland,
Türkei, Indien und Südamerika kommt man sich beim Gespräch auch
unter Fremden so nah, dass die Ellenbogen sich berühren. Persönliche
Beziehungen werden wichtiger genommen als staatliche Gesetze. Des-
halb wählen die Sprechenden im Genre eines Smalltalks lieber private
Themen, als wenn sie abstrakte, oft politische Themen diskutieren wür-
den. Sie vermischen ihre Reden mit direkten und sehr persönlichen
Komplimenten.
2. In „Handgelenk-Kulturen“ wie Frankreich, USA, Russland, China
und Australien wächst der Abstand, den die Gesprächspartner als ange-
nehm empfinden, auf Armeslänge. Hier ist ein Kongressredner, dem die
beiden Partner zugehört haben, oft ein brauchbareres Thema als das Pri-
vatleben des Angesprochenen.
3. In „Fingerspitzen-Staaten“ wie Deutschland, England, den skan-
dinavischen Ländern, Kanada oder Japan wird Wert auf großen körper-
lichen Abstand gelegt. Privatleben oder Familie sind in einem Smalltalk
oft ein Tabu. Hier ist ein Gespräch über die gemeinsam erlebte Situation
ergiebiger als über Persönliches. Komplimente über den Beruf, die Fir-
ma, das professionelle Wissen werden unbefangener entgegengenom-
men.
Unabhängig von den Armzonen gelten für das professionelle Ge-
plauder (Smalltalk) generell folgende Regeln: Fragen nach regionalen
Speisen und Getränken, am besten in ein Lob für die Landesküche ver-
kleidet sowie Komplimente über lokale Sehenswürdigkeiten. Das Wetter
empfiehlt sich nur, wenn der Gesprächspartner es überzeugend loben
kann.
Auch das sprachliche Zeichensystem selbst wäre für die Auswahl der
Stilelemente relevant. Von der Beschaffenheit der Sprache her ist im
Prinzip die Fragestellung ableitbar, ob es vollkommene Äquivalenzbe-
ziehungen gibt, wenn aus einer Sprache in die andere übersetzt werden
soll? Bleibt dabei das Stilelement erhalten, schwindet es, ist es mit ande-
ren Mitteln rekonstruierbar usw. Auch innerhalb eines Sprachsystems
sind analoge Fragestellungen ziemlich oft zu erleben, z. B. Appendizitis
oder Blinddarmentzündung oder Entzündung des Wurstformsatzes.
Wie die Verständigung vor sich geht, ist für die Auswahl der Stilele-
mente ebenfalls von Bedeutung. Geht die Verständigung mündlich vor
sich, verändert sich vieles z. B. in der syntaktischen Ausformung der
Rede. Nebenordnung läuft der Unterordnung den Rang ab, Satzlängen
werden augenscheinlich kürzer, Einschachtelungen und Satzabbrüche
häufen sich, ellyptische Strukturen verdrängen oft voll entfaltete Satz-
baupläne, Explikation logischer Verhältnisse nimmt beim mündlichen
Verkehr deutlich Schaden. Das Mündliche tendiert zu einem anderen
normativen Gebrauch als das Schriftliche. Vor dem Hintergrund des
normal-umgangssprachlichen erscheinen (oft unbewusst) Einsprengsel
des Gesenkten, ja sogar des Groben. Die Entscheidung für oder gegen
ein Stilelement hängt nicht in letztem Maße auch davon ab, wie der
20
Mitteilungsgegenstand (Denotat) beschaffen ist. Die Nachricht über
den Tod wird bestimmt in andere Wörter und Wortverbindungen einge-
kleidet, als die von der bevorstehenden Heirat stattgefundene Verlobung.
Heute werden Informationen über immer neue Kanäle vermittelt:
Massenmedien, Internet. Die Kanäle der Informationsübermittlung
restringieren die Auswahl der sprachlichen Mittel und der Stilelemente.
Die Tonart kann z. B. im Rundfunk und Fernsehen zu frequentierten
Stilelementen gezählt werden, ist aber innerhalb der anderen Kanäle der
Informationsübermittlung nicht erreichbar. Die konkrete soziale Praxis
des Sprechers ist also der primäre objektive Faktor in der Determination
des Stils. In Abhängigkeit von ihr erfolgt die Widerspiegelung der objekti-
ven kommunikativen Bedingungen. Auf dieser Basis der Widerspiegelung
der objektiven Realität entstehen bewusstseinsmäßige Voraussetzungen
des Sprechers in Bezug auf sich selbst (Selbstbild), den Kommunika-
tionspartner (Fremdbild), das sprachliche Zeichensystem (Sprachbil-
dung), den Mitteilungsgegenstand (Sachkenntnis), die Verständigungssi-
tuation (Situationsverständnis). Auf Grund dieser stildeterminierenden
Faktoren trifft der Sprecher seine Entscheidungen zur sprachlichen
Realisierung seiner kommunikativen Absicht.
Literaturnachweis
1. Faulseit D., Kühn G. Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen
Sprache. — Leipzig, 1965.
2. Fleischer PK., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —
Leipzig, 1977.
3. Krahl 5., Kurz L Kleines Wörterbuch der Stilkunde. — Leipzig, 1970.
4. Möller G. Deutsch von Heute. — Leipzig, 1964.
5. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. — Moskau, 1963.
6. Schmidt W. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. — Berlin, 1967.
7. Sowinski B. Deutsche Stilistik. — Frankfurt/M., 1973.
Kapitel 2
STILNORMEN
§ 6. Zum Begriff der Stilnorm
Das Auftreten und Anordnung bestimmter Stilelemente ist nicht nur
vom Sprecher abhängig. Von der Struktur der Sprache her sind die stil-
bildenden Faktoren fakultativ, aber ihre Auswahl und Anordnung ist zu
einem gewissen Grad durch außersprachliche Faktoren bedingt. Fakul-
tative Varianten sind an bestimmte gesellschaftliche Anwen-
dungsnormen gebunden. Die Mittel einer Sprache spezialisieren
21
sich mehr oder weniger deutlich auf bestimmte Anwendungsbereiche
und soziale Sphären. Es gibt also gesellschaftliche Normen, die als
Wahrscheinlichkeitswerte in Bezug auf ihre vorzugsweise Verwendung in
einer bestimmten kommunikativen Situation aufzufassen sind. Bei die-
sen Normen handelt es sich um gesellschaftliche Werte, deshalb ist der
einzelne Sprecher an sie gebunden. Die Norm gestattet dem Sprecher
einen gewissen „Spielraum“ und er erreicht einen besonderen Effekt,
wenn er die Norm „überspielt“, auflockert, doch gerade das beweist,
dass der Gebrauch der sprachlichen Mittel nicht nur an bestimmte
sprachliche, sondern auch an außersprachliche Bedingungen gebunden
ist. Da es sich bei dieser Art von Normen um den Sprachgebrauch aus
stilistischer Sicht handelt, werden sie als Stilnormen bezeichnet.
Die Stilnorm ist dementsprechend die gesellschaftlich gültige Bevorzu-
gungsynonymischer Varianten in einem bestimmten Anwendungsbereich.
Unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen werden die einen
Ausdrucksvarianten gegenüber den anderen Varianten bevorzugt ge-
braucht. Bestimmte sprachliche Varianten werden von verschiedenen
Gruppen der Sprecher unterschiedlich bewertet. Die Stilnorm beruht
also auf einem Werturteil über die stilistische Angemessenheit, bzw. Un-
angemessenheit der sprachlichen Ausdrucksweise. Das Werturteil kommt
zu Stande, wenn die Entscheidung getroffen wird, welche Ausdrucksva-
riante unter bestimmten kommunikativen Bedingungen als Präferenz
vorliegt. Die Existenz und das Wirken der Norm werden vor allem dann
bewusst, wenn sie verletzt werden. Die Aufforderung Beeil dich mit dem
Essen\ kann zwar von der Mutter gegenüber dem Kind geäußert werden,
kaum jedoch gegenüber einem fremden Besucher in derselben Situati-
on. Manchmal wird zur Charakterisierung der Norm der Terminus „Er-
wartungswert“ verwendet [s. Fleischer, Michel, 1977, 57], Die Stilnor-
men entsprechen der Erwartung bzw. Nichterwartung bestimmter
sprachlicher Mittel in bestimmten Situationen.
Die Stilnorm ist als kein statistischer Mittelwert aufzufassen, die Stil-
norm markiert mehr den Endpunkt der Skala, unterhalb dessen die
Markierung des Abnormen liegt.
Die Stilnorm ist uns in der Empfindung gegeben, wenn wir eine Aus-
drucksweise als situationsgemäß oder situationsunange-
mäß in unserem Bewusstsein einstufen. So wird gewiss jeder Informant
den Wortlaut „Eingang für Unbefugte verboten“ oder „Parken nur für
Anrainer“ als eine normgerechte, wenn auch nicht als einzig mögliche
Ausdrucksweise einschätzen, wenn er diese Ausdrucksweise an der Tür
eines Büroraums oder in der Nähe eines Geschäftshauses sieht. Hier
decken sich seine persönlichen Erwartungen mit den übergreifenden ge-
sellschaftlichen Normen.
Wenn der Leser/Sprecher mit einer anderen gesellschaftlichen Rolle
ausgestattet wird, z. B. sich in die Rolle des Studenten an einer Wirt-
schaftshochschule versetzen soll, ändern sich seine Ansprüche und Er-
wartungen in Bezug darauf, was er in seinem Fach schreibt, hört und
22
liest. Er soll eine bestimmte Entfernung überbrücken zwischen dem,
was er in seiner häuslichen Umgebung hört und dem, was er in einer
Monografie liest. Zunächst fallt ihm das gar nicht so leicht, denn die
aufgelockerten Normen des umgangssprachlichen Gebrauchs übertra-
gen sich nicht auf die sprachliche Ausformung der monografischen Tex-
te. Auch die Sachverhalte sind hier ganz anders. Er steht dann vor dop-
pelten Schwierigkeiten: erstens soll er neue Erfahrung im Umgang mit
neuen bisher unbekannten Sachverhalten erwerben und zweitens neue
sprachliche Konzepte erschließen und entschlüsseln. Hier führen wir ei-
nen Textbeleg aus der Monografie über strategische Unternehmensfuh-
rungen an:
Auf relativ hoch aggregierter Ebene kann die Produktlebenszyklus-Analyse
jedoch als Typologisierung strategisch relevanter Situationen herangezogen
werden. In diesem Sinne wird das Lebenszykluskonzept als wichtiges Gestal-
tungselement einer Konzeption der Marktevolution in den Mittelpunkt der
strategischen Marketingplanung gestellt.
An diesem Beispiel lässt sich deutlich sehen, dass die Qualität der
Rede anders geworden ist. Es erscheinen Wörter, die an sich genommen
ganze Fachkonzepte widerspiegeln: Produktlebenszyklus-Analyse, Typo-
logisierung, Marktevolution, Marketingplanung, Sie sind nicht nur funk-
tional gebunden, sondern dienen selbst der Bezeichnung bestimmter
wissenschaftlicher Konzeptionen. Es hat sich nicht nur die sprachliche
Ausprägung des Textes im Unterschied z. B. zu einem Romantext ge-
wandelt, auch das Verstehen solcher Texte erfordert den Anschluss ganz
anderer konzeptualer Kenntnisse.
Der kommunikative Effekt, der beim Gebrauch des sprachlichen Mit-
tels außerhalb seiner Stilnorm entsteht, beruht darauf, dass den sprachli-
chen Mitteln selbst die Bevorzugung eines bestimmten Anwendungsbe-
reiches als zusätzliches funktionales Merkmal, als konnotatives Bedeu-
tungselement, anhaftet. Sprecher und Hörer haben ein Empfinden da-
für, ob der kommunikative Effekt, den ein Ausdruck in einer bestimm-
ten Rede und außersprachlichen Situation erzeugt, als stilistisch
normgerecht zu beurteilen ist. „Aggregierte Ebene“ oder „Markt-
evolution“ wären keinesfalls passende Bezeichnungen bei einer Teerun-
de mit Nachbarn.
§ 7. Stilistische Schichtung des deutschen Wortschatzes
Wenn es eine stilistische Norm gibt, da muss es möglich und ratsam
sein, eine sprachliche Gegebenheit stilistisch einzuschätzen. Die
Schwierigkeit bei dieser Aufgabe liegt darin, dass hier das subjektive Ele-
ment nicht auszuschließen ist. Das Sprachgefühl ist nicht bei allen Men-
schen gleich, es muss also zu Schwankungen in der stilistischen Beurtei-
lung kommen. Der kritische Sprachbenutzer wird sich immer wieder
23
fragen müssen: Ist das betreffende Wort oder die Redewendung für mein
Sprachgefühl richtig bewertet?
Bei der Bewertung und Kennzeichnung des Wortschatzes unterschei-
den R. Klappenbach und W S teinitz vier Ebenen [s. Klappen-
bach, Steinitz, 1980, 77]:
1) die Stilschichten und Stilfarbungen,
2) die zeitliche Zuordnung,
3) die räumliche Zuordnung,
4) die fachliche Zuordnung.
Sie unterscheiden vier Stilschichten:
1. Die normalsprachliche Schicht. Sie wird bei gefühlsmäßig neutraler
Haltung im schriftlichen und mündlichen Gebrauch verwendet. Auch
im öffentlichen Gebrauch ist sie allgemein üblich. Das ist die breiteste
Schicht des Wortschatzes und wird als Grundwortbestand der
deutschen Sprache bezeichnet. In Wörterbüchern erhalten solche Wör-
ter und Wendungen keinen besonderen Vermerk, z. B. Abend, Tisch, ge-
hen usw.
Eine "Variante der Normalsprache, die im mündlichen Gebrauch
entsteht, wird als Umgangssprache bezeichnet. Beide Schichten liegen
im Bereich des normativen Gebrauchs, bloß dass die umgangssprachli-
chen "Varianten eine gewisse Vertraulichkeit, Lockerheitbei
der Kommunikation erzeugen. Anstatt „bekommen“ sagt man im um-
gangssprachlichen Gebrauch „kriegen“, statt „Party“ kann man
„Fete“ hören. Es ist äußerst schwer eine konsequente Opposition auf-
zubauen zwischen „normalsprachlich“ und „umgangssprachlich“,
wenn man die Umgangssprache nicht als einen gesenkten Sprach-
gebrauch betrachtet. Deshalb ist es ohne weiteres logisch den Null-
punkt der normativen Skala im Bereich des normal- und umgangs-
sprachlichen zu sehen.
2. Die gehobene Schicht. Über der ersten, der normalsprachlichen
Schicht, liegt die gehobene Schicht. Diese Bewertung kennzeichnet
Wort- und Redewendung, die sich auf die bewusste Auswahl stützen,
wenn der Sprecher z. B. bei feierlichen Gelegenheiten des öffentlichen
Lebens auf gepflegte Sprache besonderen Vvfert legt. Zu dieser Schicht
gehören die dichterischen Wörter und Wendungen, die im Allge-
meinen der poetischen Gestaltung eines Werkes vorbehalten
sind, z. B.: j-n unter seine Fittiche nehmen, auf Gedeih und Verderb be-
freundetsein, in die Fußtapfen (des Vaters) treten usw.
Die gehobene Schicht geht leicht in den Bereich des Gespreizten
über, besonders heute, wenn die Norm aufgelockert wird. Das Gespreiz-
te erzeugt nicht den Effekt der Gepflegtheit des sprachlichen Ge-
brauchs, sondern bewirkt den Eindruck des Komischen, des Sati-
rischen.
Wenn man heute dem Freund, der uns besuchen kommt, sagen wür-
de: Sie haben uns mit Ihrer Visite über alle Maße beehrt, oder: Würden Sie
sich bitte an die Tafel geziemen, um zu speisen, dann würden solche Rede-
24
weisen den Gast eher abschrecken, als davon überzeugen, dass er in Ih-
rem Haus willkommen ist.
Unter der normalsprachlichen Schicht finden sich zumindest zwei
Schichten:
3. Die salopp-umgangssprachliche Schicht. Die Schicht, die sich
von der Normalsprache, einschließlich ihrer umgangssprachlichen Va-
riante, durch eine gewisse Nachlässigkeit unterscheidet, ist
im alltäglichen Verkehr der Menschen untereinander besonders heute
sehr verbreitet. Im öffentlichen Leben würde sie etwas anstößig wir-
ken. Die Wörter und Wendungen dieser Stilschicht sind zumeist ge-
fühlsbetont und bildkräftig. Ein Beispiel aus dem Studenten-
gespräch:
— Na, und wie wafs in der Vorlesung! Was Neues"!
— Nee, eher alter Abwasch.
Der „alte Abwasch“ steht hier für das Fehlen der neuen aufschluss-
reichen Informationen in der Vorlesung.
4. Die Schicht vulgärer Wörter und Wendungen. Unter der normal-
sprachlichen Schicht liegt auch die Schicht vulgärer Wörter und Wen-
dungen, die als ausgesprochen grob empfunden und deshalb im Allge-
meinen vermieden werden. Zumeist werden sie zum Ausdruck einer
verächtlichen Einstellung zu etwas oder zu jemandem ge-
braucht. Wenn man heute hört: Das ist Ja zum Kotzen, oder: Alles ist eine
große Scheiße, oder: Der ist ja ein Superdreck, dann begreift man, wel-
ches Verhältnis des Sprechenden zum Objekt der Rede in diesen Ge-
brauchsweisen zum Ausdruck kommt.
Die oben genannten Stilschichten sind aber keine absolut ge-
schlossenen Subsysteme. Zwischen den Schichten gibt es eine gewis-
se Korrespondenz, d.h. die Schichten sind durchlässig und im
Stande, Einheiten aus der gewöhnlich unteren Ebene aufzunehmen
und zu verarbeiten. Der normative Gebrauch unterliegt einem zeitli-
chen Wandel. Die Norm steht stets unter dem Druck des Gebrauchs,
des Usus. Wenn der Gebrauch sich quantitativ erweitert, kann es vor-
kommen, dass die Norm aufgelockert wird und das aufnimmt, was
früher außerhalb der normativen Markierung lag. Die Norm, die als
Vorschrift und Anordnung unter der Flagge der Pflege umgesetzt
wird, ist selber schon eine Art Druck auf den Usus. Aber wenn die
Vorschrift nicht so strikt eingehalten wird, fassen im normativen Ge-
brauch Eindringlinge Fuß. Heute nimmt keiner daran Anstoß, wenn
in einem Zeitungsartikel steht, dass Der Standort Deutschland bald
baden geht oder vor die Hunde kommt. Die Reinhaltung der Sprache,
die als Pflege bezeichnet wird, hat merklich in allen europäischen
Sprachen nachgelassen, und da nur „einige wenige Liebhaber von
Goethe“ dafür Sorge tragen, dass die Norm aufrechterhalten bleibt,
kommt es immer häufiger zu Überlappungen zwischen den
einzelnen Stilschichten.
25
§ 8. System von Stilfärbungen
Außer den Stilschichten unterscheidet man zur Kennzeichnung von
Wörtern und Wendungen auch noch die so genannten Stilfärbungen.
Die Stilfärbungen entstehen zwar auf Basis der kommunikativen Situati-
on, funktionieren aber als Eindruckswerte an der Seite des Rezipienten
der Rede. Der Rezipient nimmt diese sprachlichen Gegebenheiten in
den schon vorhandenen Bewusstseinsraster auf und sucht ihre Stelle hier
zu ermitteln. Im Prozess des Vergleichens oder der Gegenüberstellung
stellt er fest, dass neue Lexeme eine gefühlsmäßige Entfremdung bewir-
ken und neuere Emotionen erregen, als die Einheiten, die schon längst
im Raster lagern. Zu den Stilfärbungen gehören:
1) scherzhafte Färbung (Angsthase, Langfinger, lange Latte usw.);
2) vertrauliche Färbung (einen schönen guten Abend'.; du, mein Alter-
chen, mein goldiges Kind'. usw.);
3) verhüllende Stilfärbung — kennzeichnet Wörter und Wendungen,
die etwas Unangenehmes beschönigen sollen (z. B. abberufen werden
statt „sterben“);
4) übertriebene Färbung (z. B. ein milliardenschwerer Vertrag, ab-
scheulich reich sein);
5) abwertende oder pejorative Färbung (ein Scheusal vom Menschen,
der Abhub der Menschheit, Ablasskrämer usw.);
6) spöttische oder ironische Färbung (z. B. Bücherwurm, Amtsschim-
mel, allein selig machend);
7) derbe Färbung (z. B. das stinkt zum Himmel).
Auch gefühlsmäßige Stilfärbungen sind nicht ein für alle Male gege-
ben. Ziemlich oft verwischt sich die derbe oder abwertende abschätzige
Hülle eines Wortes oder einer Wendung im Laufe der Zeit. An Stelle der
Entfremdung tritt die Gewöhnung. Der Spott oder die Abschätzig-
keit werden als Angemessenheit empfunden, was das Gefühl des Nor-
malen, des Üblichen, des Nicht-aus-der-Reihe-Fallenden bewirkt.
Wiederum führt der Usus, der Gebrauch, zur Auflockerung der Norm.
In der Äußerung Ich hab’ mehrmals angeklopft, aber kein Aas scheint zu
Hause zu sein ist das Wort „Aas“ kein Schimpfwort mehr, sondern Aus-
druck der Verärgerung darüber, dass niemand im Moment zu Hause war.
Hinsichtlich der Norm werden die Wörter und Wendungen auch
zeitlich gekennzeichnet. Dabei gilt die folgende Einteilung als allge-
mein üblich:
1) veraltete Wörter und Wendungen — sie werden heute gar nicht
oder nur wenig gebraucht, kommen nur in der gelesenen Litera-
tur vor, aber werden weithin verstanden (z. B. Binokel, Eidam);
2) veraltende Wörter und Wendungen — sie gehören vornehmlich
dem Wortschatz der älteren Generation an (Boudoir, prätentiös,
seriös, obszön);
3) historische Wörter und Wendungen — sie bezeichnen Gegenstän-
de, Sitten und Bräuche der historischen Vergangenheit und
26
dienen zur Zeichnung des historischen Kolorits (z. B. Helle-
barde, Anschlusspolitik (unter Hitler), die Achse Berlin — Rom, die Mann-
heim-Linie)',
4) neue Wörter, Neologismen (z. B. campen, Bombenteppich jobberi).
In Bezug auf die Norm werden Wörter und Wendungen auch
räumlich fixiert. Es gibt viele regional beschränkte Wörter und Wen-
dungen, die weithin bekannt sind, verstanden und in der Literatur ange-
wandt werden. Sie erhalten bei gesicherter Zuweisung zu nur einem
Sprachraum die dementsprechende Kennzeichnung (z. B. berlinisch,
süddeutsch, schwäbisch, plattdeutsch usw.). Bei Ausbreitung über mehre-
re verschiedene Sprachräume werden sie als regional oder landschaftlich
eingestuft. Thomas Manns „Buddenbrooks“ enthält zahlreiche Beispie-
le für regional markierten Sprachgebrauch, der häufig zugleich sozial
bestimmt ist. So ist die Revolutionsszene durch eine Mischung von
Plattdeutsch und Standardsprache gekennzeichnet:
„Hür mal, Smolt, un ihr annern Lüd! Wer nu’n verstännigen Kierl is, der
geht naa Hus un schert sich nich mihr um Revolution und stört hier nich de
Ordnung.“ „Die heilige Ordnung!“ unterbrach Herr Gosch ihn zischend. „De
Ordnung, seggick!“ beschloß Konsul Buddenbrook. „Nicht mal die Lampen
sind angezündet. Dat geiht denn doch tau wied mit de Revolution!“
Da die deutsche Sprache in drei nationalen Varianten existiert, wer-
den diese Varianten auch als räumliche Zuordnung angesehen.
Wörter und Wendungen werden auch nach Fach- und Sonder-
gebieten geordnet. Hier werden mehrere Subsysteme ermittelt und
ausgewertet, z. B. Fachsprachen (Sprache der Wirtschaft, der Jura, der
Medizin usw.), gruppenspezifische Sprachen (Studentensprache, Solda-
tensprache, Sprache des Bildungsbürgertums oder Sprache der bil-
dungstragenden Schicht). Der Gebrauch solcher Wörter und Wendun-
gen erschließt die soziolektale Dimension der sprachlichen Schichtung
und wird vom sprachlichem Kern aus, d. h. von der Norm her markiert
und identifiziert.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es zumindest fünf Bezugsrah-
men gibt, auf die die Norm oder der normative Gebrauch bezogen wird
und in die sie (die Norm) eingebettet ist:
1) der außersprachliche Sachverhalt, der in einem Text
vermittelt wird;
2) die im Text durch spezifische Auswahl unter synonymischen Aus-
drucksvarianten vermittelten Werte bezüglich Stilschicht, Stil-
farbung, soziolektale und geografische Dimension;
3) Text- und Gattungsgesetzmäßigkeiten, die sich auf
textgattungsspezifische Merkmale beziehen;
4) der Empfänger (Leser oder Hörer), an den sich der Gebrauch
richtet. Er soll den Text auf der Basis seiner Xferstehensvoraussetzungen
rezipieren können. Diese empfangerbezogene Ausrichtung des Ge-
brauchs nennt man die pragmatische Komponente der Norm;
27
5) Ästhetische und individualistische Eigenschaf-
ten des Textes, die ihrerseits bestimmte Präferenzen bei der Auswahl
der Ausdrucksmöglichkeiten bewirken.
Literaturnachweis
1. Fleischer FK, Michel G. Stilistik der Gegenwartssprache. — Leipzig, 1977.
2. Galperin I. Stylistics. — M., 1971.
3. Kerkhoff E. Kleine deutsche Stilistik. — Bern; München, 1962.
4. Klappenbach R., Steinitz W. Wörterbuch der deutschen Gegenwartsspra-
che. — Berlin, 1980. — Bd. I.
5. Michel G. Einführung in die Methodik der Stiluntersuchung. — Berlin,
1968.
6. Rost W. Deutsche Stilschule. — Hamburg, 1960.
7. Schneider W. Ausdruckswerte der deutschen Sprache. — Darmstadt,
1968.
8. Seidler H. Allgemeine Stilistik. — Göttingen, 1963.
Kapitel 3
STILWERTE UND STILZÜGE
§ 9. Stilwerte
Jede Form von Stil setzt voraus, dass im Text charakteristische Ein-
zelelemente Zusammenwirken, die einen bestimmten Eindruck hervor-
rufen. Der Stil wird als ein einheitliches Formgepräge erlebt.
Dieses Erlebnis beruht auf dem Erfassen aller Stilelemente, aber bereits
bei der Begegnung mit einzelnen Stilmitteln wird die Wahrnehmung,
das Empfinden des Stils angeregt. Die Stilmittel besitzen einen eigenen
Eindruckswert, der sich aus dem Verhältnis dieser Stilmittel zum Textin-
halt und zueinander ergibt. Davon ist der Ausdruckswert zu unterschei-
den, der eine Wirkungsabsicht impliziert.
In ihrem Buch „Theorie und Praxis der linguostilistischen Textin-
terpretation“ schreibt E. Riesel, dass beim Erfassen des Stils die
gesamte sprachstilistische Gestaltung des Textes in seinem inneren
und äußeren Aufbau überblickt werden muss [vgl. Riesel, 1974, 57].
Aber ganz besonders müsste man auf die Stützen der Inhalt-/Form-
Beziehung eingehen, d. h. die Stilelemente, bei denen die Wahl dieser
oder jener sprachstilistischen Gegebenheit motiviert ist. E. Riesel
führt ein Schema der textbildenden Faktoren an, die bei jeder linguo-
stilistischen Interpretation in Betracht gezogen werden müssen. Die
außerlinguistische Spezifik des Textes ruft bestimmte Stilzüge hervor,
wobei die Stilzüge als innere Wesensmerkmale verstanden werden,
28
die unmittelbar aus der gesellschaftlichen Funktion der Aussage er-
wachsen und dabei den Stil des Textes prägen und normen. Diese
Stilzüge ziehen ihrerseits zwangsläufig sprachstilistische Mittel aller
Ebenen zur expliziten Ausformung der Information nach sich. Damit
erlangt der Text einen Ausdruckswert, in dem alle außerlinguistischen
und sprachstilistischen Absichten des Sprechers/Schreibers einge-
schlossen sind. Bei der Übernahme der Mitteilung empfindet der
Empfänger den Eindruckswert, der sich mit dem Ausdruckswert nicht
immer deckt. Der Ausdruckswert wird dabei als erstrebter stilistischer
Effekt aufgefasst. Ohne Zweifel muss der Ausdruckswert eines wis-
senschaftlichen oder amtlichen Textes dessen Eindruckswert entspre-
chen; ihre Divergenz, ihr Auseinandergehen würden Kommuni-
kationsstörungen bewirken. Aber bei publizistischen oder belletristi-
schen Texten bestehen subjektive Auslegungsmöglichkeiten, so dass
der Ausdruckswert und der Eindruckswert auseinander driften kön-
nen. Eine Wiederholung z. B. kann als Herausstreichung einer Aussa-
ge oder eines Teils davon gemeint sein (Ausdruckswert) und empfun-
den werden (Eindruckswert). Hier liegt die Konvergenz von
Ausdruckswert und Eindruckswert vor; ein Archaismus kann als zeit-
liche Koloritzeichnung konzipiert werden, aber als eine ironische
Gebrauchsweise wahrgenommen werden. Dabei handelt es sich um
die Divergenz von Eindruckswert und Ausdruckswert.
Aber auch jedes „nicht abweichende“ Ausdruckselement besitzt im
Zusammenhang mit anderen einen bestimmten Stilwert, eine bestimm-
te Wirkungsqualität.
Der Stilwert ist mit der Null-Expressivität oder der Null-Markierung
vergleichbar, die sich nach unten oder nach oben verschiebt, sobald sich die
Kommunikationsbedingungen abgeivandelt haben.
Der Stilwert ist eine Potenz, die unter bestimmten Bedingungen
aktualisierbar ist. Er unterscheidet sich vom sprecherbezogenen Aus-
druckswert und vom empfängerbezogenen Eindruckswert. Der einfache
Aussagesatz besitzt schon einen Stilwert, aber aktualisiert wird dieser
Stilwert 1) in der Beziehung auf die Gesamtheit eines Textes und 2) in
Opposition (Gegenüberstellung) zu den anderen Satzarten. Die Wortart
„Substantiv“ hat an sich genommen einen bestimmten Stilwert, aus
dem unter bestimmten Bedingungen Ein- und Ausdruckswerte ent-
stehen. Alle Substantivformen können stilprägend werden,
wenn sie fast ausschließlich oder in gehäufter Form auftreten, insbe-
sondere wenn dabei semantisch schwache Verben verwendet und die
adverbialen und attributiven Satzstellen ebenfalls durch Substantive
besetzt werden. Ein solcher substantivischer Stil ist typisch für juristi-
sche und verwaltungs- oder wirtschaftsgebundene Texte, zuweilen auch
für wissenschaftliche Texte oder in bestimmten Textpartien einzelner
Schriftsteller. Ein Textbeleg aus Goethes „Wahlverwandtschaften“:
Nun berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sohnes, der
wachsenden Neigung des jungen Paares, von der Ankunft des Vaters, der ent-
29
schiedenen Weigerung Hilariens. Überall finden sich Erwiderungen Makariens
von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Überzeugung stammen, daß hier
eine sittliche Besserung entstehen müsse.
In diesem Beleg sehen wir eine auffällige Anhäufung der Abstrakta
auf -ung, eine sehr beschränkte Anzahl der Konkreta, semantisch
schwache Verben, deren Funktion mehr darin besteht, die Aussagen rein
syntaktisch auszuformen. Substantive auf -ung sind dazu noch mit ad-
jektivischen und partizipialen Beiwörtern in Vorstellung versehen
(wachsende Neigung, entschiedene Weigerung, gründliche Überzeugung,
sittliche Besserung), was den begrifflichen Kern der Substantive präziser
herausarbeiten lässt und die auktoriale Sicht erschließt. Bei diesem Be-
leg handelt es sich bestimmt um eine der mehreren eigentümlichen Ei-
genschaften des Individualstils von J. W. Goethe.
§ 10. Stilzüge als Zusammenwirken von Stilelementen
Bei Stilelementen handelt es sich, wie schon oben mehrmals heraus-
gestrichen, um fakultative Elemente der Rede. Sie erscheinen auf
Grund ihrer Substituierbarkeit und Kombinierbarkeit als eine spezifi-
sche Variante innerhalb einer Reihe synonymischer Möglichkeiten. Die-
se Elemente bilden die sprachlichen Bausteine des Stils. Aber es ist
wichtig auch die Beziehungen zu ermitteln, die sich zwischen den ein-
zelnen Stilelementen innerhalb der Rede gestalten.
Bei der Kennzeichnung der Beziehungen zwischen den Stilelemen-
ten sollten zwei Seiten berücksichtigt werden: die formale und die funk-
tionale [s. Michel, 1972, 95],
Die formale Seite offenbart sich in der Häufigkeit (Frequenz), in der
Verteilung (Distribution) und in der Verbindung (Kombination) der Stil-
elemente. Die Analyse der Häufigkeit der Stilelemente zielt darauf, den
Häufigkeitswert eines Stilelementes im Verhältnis zu anderen funktional
vergleichbaren Varianten festzustellen. Erfasst wird das rein quanti-
tative Verhältnis der Elemente innerhalb des Ganzen. Verschie-
dene lexikalische, grammatische und fonetische Elemente treten in ei-
nem Text mehrfach auf. Sie weisen im Vergleich zu anderen funktional
ähnlichen Varianten einen besonders hohen Häufigkeitsgrad auf. Diese
dominierenden, stilprägenden Komponenten innerhalb des Textes wer-
den dem Empfänger bewusst.
Neben der Analyse der Häufigkeit ist die Analyse der Verteilung der
Stilelemente von Bedeutung. Die Art der Verteilung ist nicht zufällig
und auch nicht auf ein einzelnes Stilelement beschränkt. Die Analyse
der Verbindung der verschiedenartigen Stilelemente lässt uns dascharak-
terische Zusammenwirken dieser Elemente erkennen. Wenn ein Stilele-
ment in einer ganz bestimmten Häufigkeit, Verteilung und Verbindung
innerhalb der Rede auftritt, bedeutet es, dass das Stilelement einen in-
haltlichen, kommunikativen Anteil daran hat, dem Empfänger be-
30
stimmte Informationswerte zu vermitteln. Der Anteil der inhaltlichen
Variierung in der sprachlichen Darstellung bildet die funktionale Seite
der Stilelemente.
Das einzelne Stilelement besitzt einen spezifischen Stellenwert
innerhalb des Stilganzen, es ist integrierender Bestandteil einer über-
greifenden Ordnung, deshalb kann es in seinem formalen und funk-
tionalen Anteil am gesamten Redestil nur aus der übergreifenden
Gesamtheit aller Elemente heraus verstanden und erklärt werden.
Diese „charakteristische Beziehung der einzelnen Stilelemente in-
nerhalb des Redestils als der Gesamtheit der Elemente nennt man
den Stilwert“ [Michel, 1972, 42], Der Stilwert schließt stets die for-
male und die funktionale Seite ein. Die funktionale Seite wird auch
mit dem Terminus „stilistische Funktion“ der sprachlichen Erschei-
nung bezeichnet.
Wenn man den Stil erfassen und beschreiben will, so geht es da-
rum, die bestimmenden Ordnungsprinzipien für die Gesamtheit der
Stilelemente zu ermitteln. Es gilt festzustellen, welche Besonderhei-
ten in Bezug auf die Häufigkeit, Verteilung und Verbindung der Stil-
elemente dem Text eigentümlich sind und welche funktionalen Be-
sonderheiten damit Zusammenhängen. Diese Eigentümlichkeiten des
Stils ergeben sich aus dem Zusammenwirken verschiedenartiger Stil-
elemente und werden als Stilzüge bezeichnet. Dementsprechend sind
Stilzüge die auf Häufigkeit, Verteilung und Verbindung der Stilele-
mente beruhenden charakteristischen Besonderheiten des Stils. Eine
strenge Systematisierung von Stilzügen erscheint kaum möglich. Die
Vielfalt sprachlicher Äußerungen ist zu groß, und außerdem hat der
Sprecher immer Anspruch auf eine originelle Ausdrucksweise, in der
sich nur weniges wiederholt. Aber beim Erfassen von Stilzügen wäre
es logisch eine folgende Hierarchie von Stilzügen aufzustellen
[vgl. Sowinski, 1973, 326]:
a) generelle Stilzüge (Stilkonstanten) der grundlegenden Funktio-
nalstile: z. B. Eindeutigkeit und Eingängigkeit für Sachprosa und /1m-
schaulichkeit und Bildlichkeit für Belletristik; Expressivität für schön-
geistige Literatur und Zweckmäßigkeit und Sachlichkeit für Sachprosa;
zwanglos-aufgelockert für den Stil der Alltagsrede und offiziell für den
Stil des öffentlichen Verkehrs; emotional mit subjektiver Wertung für
Belletristik und nicht emotional mit objektiver Wertung für den Stil der
Wissenschaft; individuell mit persönlicher Note für Belletristik und ent-
persönlicht für den Stil des öffentlichen Verkehrs; Fiktivität für Bellet-
ristik und Authentizität (Glaubwürdigkeit) für den öffentlichen Verkehr
und Presse u.a. m.;
b) spezielle Stilzüge der Gattungsstile innerhalb der übergreifen-
den Funktionalstile: z. B. subjektiv-einschätzend für Zeitungskom-
mentare und objektiv-neutral (mit Nullwertung) für Zeitungsmeldun-
gen und Kurznachrichten; ruhig für eine Stimmungsnovelle und be-
wegt für ein Drama; volkstümlich-naiv für Balladen und unsinnig-ver-
31
fremdend für die Gedichte der Dadaisten; Lehrhaftigkeit z. B. für wis-
senschaftliche Monografien und Vorträge und Komik und Witz z.B.
für Kinderliteratur, Ironie und Groteske für Feuilleton u.a.m.;
c) originelle Stilzüge des jeweiligen Einzeltextes oder des individu-
ellen Stils: z. B. Knappheit — Breite als Ausdruck der Autorindividuali-
tät; Klarheit — Verschwommenheit} Ironie, Humor, Trivialität, Verwor-
renheit usw.
Die beiden ersten Gruppen könnten die Grundlage einer system-
haften Zusammenfassung von Stilzügen bilden. Die Stilzüge stehen
nicht linear und gleichwertig nebeneinander. Teils gibt es zwischen
ihnen hierarchische Beziehungen (es gibt dominierende und
nicht dominierende Stilzüge), teils bestehen zwischen den Stilzügen
oppositionelle bzw. polare Beziehungen. Zur Veranschauli-
chung unserer Gedankengänge möchten wir an dieser Stelle einige
Beispiele einschließen. Inder Prosa ist die Verwendung des Bei-
wortes am häufigsten durch den Individualstil des Autors be-
stimmt. Bei H.Heine wird z.B. das Adjektivattribut oft zu i ro-
tt isch-satirischen Zwecken gebraucht und dient somit als Ba-
sisstilelement für die Herausbildung des Stilzuges „Ironie“, die oft
mit beißender Satire in eins verschmilzt:
Die eine Dame war die Frau Gemahlin, eine gar große, weitläufige
Dame, ein rotes Quadratmeilengesicht mit Grübchen in den Wangen, die
wie Spucknäpfe für Liebesgötter aussahen, ein langfleischig herabhängendes
Unterkinn, das eine schlechte Fortsetzung des Gesichtes zu sein schien,
und ein hochaufgestapelter Busen, der mit steifen Spitzen und vielzackig
festonierten Kragen wie mit Türmchen und Bastionen umbaut war... („Die
Harzreise“)
Bedeutende Autoren haben es jedoch stets verstanden, durch Bei-
wörter die Ausdruckswirkung zu steigern. Das schmückende
Beiwort wird oft zu einem bleibenden, „stehenden“ Charakteristikum
von Gegenständen und Personen und prägt als solches unter anderem
die deutsche Ballade, das Volksmärchen, die Lyrik, insbeson-
dere zu der Zeit des Romantismus als einer Richtung der dichterischen
Kunst. Hier bringen wir nur einen Textbeleg aus H. Heine:
Es war ein alter König,
Sein Herz war schwer, sein Haupt war grau;
Der arme alte König,
Er nahm eine junge Frau.
Es war ein schöner Page,
Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn;
Er trug die seidne Schleppe
Der jungen Königin.
An diesem Beispiel ließe sich sehen, wie das „schmückende“ Beiwort
(alter König, Herz schwer, Haupt grau, junge Frau, schöner Page, Haupt
32
blond, seidne Schleppe) die Volkstümlichkeit, Trivialität und Naivität als
genremäßigen Stilzug der Ballade mitzuprägen hilft und mit anderen
Stilelementen (z. B. Substantiven und Satzbau) in einwandfreier Har-
monie zusammenwirkt. Dank unterschiedlichen Verwendungsmöglich-
keiten ist Beiwort zu einem der beliebtesten Ausdrucksmittel in der
Werbesprache geworden:
Im „ Schlösse rland Bayern“ haben sich einzigartige Ensembles großer euro-
päischer Architektur mit ihrer künstlerischen Ausstattung erhalten. Oft liegen
sie eingebettet in zauberhafte Parkanlagen und Gärten. Ein wesentliches Anlie-
gen der Schlösserverwaltung ist es, den Besuchern diese Sehenswürdigkeiten
gepflegt und restauriert zu zeigen und zeitgemäß vorzustellen. Ständige Verbes-
serungen in der Präsentation des wertvollen kulturellen Erbes tragen dazu bei,
die historischen Bauwerke mit Leben zu füllen. (Touristikwerbung)
In der Touristikwerbung können wir über goldene Pagoden, goldenes
Zeitalter, staunenswerte Kulturen, sagenhafte Tempelstädte', ein neuartiges,
aufregendes Reiseerlebnis', elegant eingerichtete Kabinen, höchste Sicher-
heitsstandards, exzellenten Service lesen. In der Werbung für ein neues
Buch erfahren wir davon, dass es „eine unübertroffene Übersetzung mit
liebevoller Ausstattung“ ist, verfasst von „einem Meister mit brillantem
analytischem Verstand“, die Fitnesswerbung verrät uns, dass es „der ein-
zige wahre Weg zur Ideallinie ist“, der VW-Werbetext rät uns zu einem
„perfekt abgestimmten Fahrwerk mit einem durchzugsstarken Motor und
dem intelligenten Allrad-Antrieb, der eine optimale Verteilung der Leis-
tung ermöglicht“, zu.
Die Beiwörter in der Werbung sollen ein positives Urteil, eine positi-
ve Wertung nicht nur im Text als Ausdruckswert schaffen, sondern auch
auf den Verbraucher übertragen, ihm (dem Verbraucher) ein positives
Image suggerieren, Handlungsmotivation vermitteln und zur Handlung
(Kauf, Erwerb) anregen. In diesen Beispielen ist das Stilelement „Bei-
wort“ auch mitbeteiligt an der Ausprägung der Stilzüge „Expressivität“
und „subjektive Wertung“, die für die Gattung „Werbung“ dominante
Testqualitäten sind.
Literaturnachweis
1. Faulseit D., Kühn G. Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen
Sprache. — Leipzig, 1965.
2. Fleischer W,, Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —
Leipzig, 1977.
3. Michel G. Einführung in die Methodik der Stiluntersuchung. — Berlin,
1972.
4. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. — M., 1963.
5. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation. —
M., 1974.
6. Sowinski B. Deutsche Stilistik. — Frankfurt/M., 1973.
7. Ullmann St. Grundzüge der Semantik. — Berlin, 1977.
2 Eo tot bi peiia ßß
Kapitel 4
FUNKTIONALE STILE
§ 11. Funktional bedingte Typisierungsmöglichkeiten des Stils
Die Vorstellung darüber, dass der Stil an die Gattung und den Zweck ge-
bunden ist, findet sich schon in den älteren wissenschaftlichen Arbeiten des
18. und 19. Jahrhunderts. In seiner Abhandlung „Über die verschiedenen
Methoden des Übersetzens“ (1813) stellt Friedrich Schleierma-
cher fest, dass es Texte der Wissenschaft und Kunst gibt. Zu den letzteren
zählt er philosophische und poetische Texte. Hier ist das, was gesagt wird,
und wie es sprachlich gefasst wird, auf sprachspezifische Weise verbunden.
Die Sprache ist nicht nur Vehikel von Inhalten, sondern sie ist selber Inhalt
bzw. determiniert diese Inhalte. Unter dem Einfluss der sowjetischen und
tschechischen Linguistik weitete sich diese Vorstellung zum sprachlichen
Modell mehrerer funktionaler Stile aus. Innerhalb der funktionalen Stilistik
wird unter Stil „ein System der Ausdrucksgestaltung, der Verwendungsweise
der sprachlichen Möglichkeiten“ verstanden [Riesel, 1963,11\. Dabei wird
vorausgesetzt, dass in bestimmten Bereichen der Sprachverwendung be-
stimmte charakteristische Stilmerkmale dominieren. Die charakteristischen
„Eigenarten der Sprachverwendung“ sind hier notwendige, wenn auch va-
riable sprachliche Erfordernisse zur Erfüllung bestimmter Ausdrucksfünk-
tionen. Die Sprache wird als menschliche Tätigkeit verstanden, die sich auf
ein bestimmtes Ziel richtet.
Die Kriterien für die Bestimmung von Stiltypen berücksichtigen den
Zusammenhang zwischen der Auswahl sprachlicher Mittel und bestimm-
ten Kommunikationsfaktoren. Dazu gehören der Kommunikationsbe-
reich, der Zweck des Kommunikationsaktes und die Absicht des Kommu-
nikators, der Inhalt der sprachlichen Äußerung sowie Kommunikations-
form (mündlich oder schriftlich) und die Kommunikationsart (dialo-
gisch— monologisch, interpersonal oder Massenkommunikation).
Schließlich sind auch das Verhältnis zwischen Kommunikatoren und das
Verhältnis des Redeabsenders zum Inhalt der Äußerung (emotionale An-
teilnahme, Sachlichkeit, Gleichgültigkeit) zu berücksichtigen.
Die stilbildenden Faktoren sind bei der funktionalen Betrachtungs-
weise hierarchisch angeordnet. Die funktionalen Stiltypen haben funk-
tionalen Charakter, ihrer Klassifizierung müssen primär soziale Fak-
toren zu Grunde gelegt werden, nicht individuelle.
Die russische Germanistin E. R i e s e 1 konstatiert für die deutsche
Sprache fünf verschiedene funktionale Stile: 1) den Stil des öffentlichen
Verkehrs, 2) den Stil der Wissenschaft, 3) den Stil der Publizistik und
Presse, 4) den Stil des Alltagsverkehrs, 5) den Stil der schönen Literatur.
Es ist durchaus möglich, anzunehmen, dass sich auf Grund stilistischer
Untersuchungen noch differenziertere Verhältnisse eigeben, die weitere
34
Gruppierungen möglich machen. Auch innerhalb der genannten Funk-
tionalstile gibt es weitere Differenzierungen. Dabei wäre darauf zu ach-
ten, ob es sich um schriftliche oder mündliche, monologische oder dia-
logische Ausdrucksweisen, um Mitteilungen oder Forderungen und Ap-
pelle handelt usw. In diesem Zusammenhang kann man von drei funk-
tionalbedingten Typisierungsmöglichkeiten des Stils sprechen [vgl. Flei-
scher, Michel, 1977, 240]:
1) die Darstellungsarten;
2) die Gebrauchsformen;
3) die funktionalen Stiltypen.
Mit Gebrauchsformen versucht man Klassen von Texten zu erfassen,
die im Hinblick auf ihre Kommunikationsaufgabe mehr oder weniger
starken schablonisierten Charakter aufweisen, wie z. B. Lebenslauf, Pro-
tokoll, Geschäftsbrief.
Die Darstellungsarten bilden „spezielle Verfahren zur Herstellung
von Texten“ [Sprache und Praxis, 1972, 205], Bei Darstellungsarten
handelt es sich um die Verfahren des Registrierens, Kommentierens, Ar-
gumentierens, Definierens und Referierens. Registrierende Texte
sind danach Bedienungsanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Ver-
sammlungsprotokolle, Aktennotizen. Sie haben die Aufgabe, den Emp-
fänger über den Gegenstand der Darstellung zu informieren.
Beim Kommentieren werden Sachverhalte und ihre Kausalbe-
ziehungen erläutert. Beim Argumentieren geht es um die sprachli-
che Beweisführung. Beim Definieren werden die Begriffe bestimmt
und gegen andere Begriffe abgegrenzt.
Unter Referieren versteht man die Arbeit des Berichterstatters
auf Grund eines schon vorhandenen Textes.
In der Praxis der sprachlichen Kommunikation werden diese Verfah-
ren meist komplex eingesetzt und lassen sich nur an Teilstücken eines
ganzen Textes isolieren.
Die funktionale Stilauffassung betont zwei wichtige Aspekte der Sti-
listik: (1) den Stilcharakter aller sprachlichen Äußerungen und (2) die
Auffassung vom Stil als einer Wirkungsform der Sprache. Die
funktionale Stilistik greift den bereits in der antiken Rhetorik gültigen
Grundsatz auf, dass unterschiedliche Redezwecke auch unterschiedli-
che stilistische Anforderungen bedingen. Die funktionale Stilistik kann
dabei ein ähnliches situativ bedingtes sprachliches Verhalten verschiede-
ner Sprecher feststellen.
§ 12. Kurzer Umriss der funktionalen Stiltypen
Alltagsverkehr
Er kennzeichnet die Kommunikation in der nicht offiziellen
Sphäre des Gesellschaftsverkehrs. Hier kommt besonders deutlich die
Verflechtung von sozialer Schichtung (Arbeiter, Unternehmer, Studen-
35
ten usw.) und funktional stilistischer Differenzierung zum Ausdruck.
Für den Alltagsverkehrgebraucht man oft den Ausdruck „Umgangsspra-
che“. Dabei wird mit der Umgangssprache seit längerem eine breite
Zone zwischen Dialekt einerseits und literatursprachlichem Standard
bezeichnet. Der Stil des Alltagsverkehrs lässt bei grundsätzlicher Ver-
wendung des literatursprachlichen Standards bestimmte Elemente aus
„unteren“ Stilschichten zu. Der Alltagsverkehr weist einen geringeren
Normierungsgrad auf. In diesem Bereich erfolgt die Kommunikation
zumeist unvorbereitet (spontan) und m ü n d 1 i c h, darum kommt
es zu einer ungezwungenen und lockeren Sprechweise. Die Gesamthal-
tung der Sprecher ist entspannt. Die Unterhaltung fordert geringeren
Kraftaufwand, geringere Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung. Man
lässt sich öfters gehen. Dasselbe bezieht sich auch auf den privaten
schriftlichen Verkehr (Briefe an Freunde und Verwandte).
Die Ungezwungenheit und Lockerheit beeinflusst die Auswahl der
Lexik (gucken statt „sehen“, kriegen statt „bekommen“). Da an den
Anstrengungen gespart wird, werden allgemeine Ausdrücke bevorzugt
wie Ding, Sache, Zeug, machen, groß, mies, toll, nett u.Ä. Häufig werden
Formeln verwendet, die den Sprachkontakt aufnehmen und fortsetzen
helfen. Wenn der nächste Gedanke noch nicht ausgereift ist, werden die
verschiedensten Inteijektionen und individuellen Lieblingswörter einge-
setzt. Im Alltagsverkehr hat man keine Scheu vor ständigen Wiederho-
lungen und saloppen Ausdrücken. Am Satzbau fallen Ausrahmungen,
verselbstständigte Satzabschnitte, Weglass einiger Satzglieder auf. Das
Thema wird häufig nicht folgerichtig entwickelt, es entstehen Inhalts-
lücken, die dadurch ausgefullt werden, dass die Kommunikatoren glei-
che oder ähnliche Kognitionsraster haben und der Informationsaus-
tausch stark situationsbezogen ist.
Der Stil der Alltagsrede ist ferner durch eine stärkere Tendenz zu ex-
pressiver Ausdrucksweise gekennzeichnet. In der Öffentlichkeit ist der
Mensch im Allgemeinen zurückhaltend in der Wahl emotional betonter
Sprachmittel und unterdrückt starke Gefühlsregungen. Dazu kommen
noch Wortbildungen, die auf kühne Bilder zurückgehen, z. B. Sauwetter,
Saukerl, Schweineglück, Vergleiche mit individuell-kühner Vergleichsba-
sis — hässlich wie eine Sünde, dumm wie Stroh oder Bierpfropfen.
In grammatischer Hinsicht zeigt sich die Tendenz zur Expressivität
im häufigeren Gebrauch von Ausrufesätzen, in der Bevorzugung expressi-
ver Satzgliedstellung (Betrügen lass ich mich von niemand?).
Bei diesem Funktionalstil hat der Sprecher mehr Möglichkeiten, sei-
ne Individualität zu entfalten. Wollen wir etwas eingehender das nach-
folgende Gespräch auswerten:
Peter Wo hast du dich gestern den ganzen Abend herumgetrieben? Ich
habe dich mehrmals herausgeklickt, aber war nicht durch.
Rolf: Hast auch nicht herankommen können. Ich war bei „Kaiser“ in ei-
ner Gratis-Party, na, weißt du, in so einer Vorführaktion, Bier vom Fass und
Tanz bis in die Puppen.
36
Peter: Hast wohl wieder das Ding mit Undinenaugen mitgeschleppt, nee?
Rolf: Naja, sicher. Kann man denn so eine überhaupt abhängen. Die
bleibt auf alle Ewigkeit kleben. Und Dinge hat die gedreht... Super. Schade,
dass ich schon tankvoll war. Na, verstehst wohl, laues Bier, Hitze zum Umkip-
pen, nach zwei Stunden alles zum Kotzen, auch jene Dinger vom Strand, erin-
nerst du dich noch?
Peter: Sicher. Die mit Zuckerlippchen kommt mir gar nicht aus dem
Sinn. Wie die um uns herumgeflattert ist, genau wie ein Kanarienvogel um ei-
nen Papagei...
Auffällig ist an diesem Gespräch, dass weder das Gesprächsthema
noch die Personen, von denen die Rede ist, sprachlich genau identifizier-
bar sind. Ihre Identifikation ist schon vorher zu Stande gekommen, in den
hintergründigen Informationszusammenhängen, mit denen die beiden
Gesprächspartner ausgestattet sind. Auf der semantischen Oberfläche
sind das Ding, Dinger, „Kaiser“, Strand. Wenn der eine Sprecher voraus-
setzt, dass im Bewusstseinsraster seines Gegenübers „die Gratis-Party“
fehlen kann, greift er zur Erläuterung (so eine Vorführaktion, Bier vom Fass
und Tanz bis in die Puppen). Kontaktaufnahme und Kontaktaufrechter-
haltung werden durch Flickwörter und Inteijektionen gesichert, wie nee,
na ja, sicher, na, verstehst wohl. Ansonsten kann man sich leicht vorstellen,
dass die jungen Leute einen gewissen Grad der Bildung nachweisen kön-
nen, zumindest haben sie in der Schule Balladen gelernt und H. Heine
gelesen (Undinenaugen, kommt mir nicht aus dem Sinn). Die Wortwahl, die
über das Redeverhalten der beiden Partner Aufschluss gibt, beruht in ih-
rem Kern erstens auf umgangssprachlichem Wortgut mit einem leichten
Anhauch des Saloppen. Von „vulgär“ ist keine Spur zu sehen. Das, worü-
ber gesprochen wird, wird zugleich auch expressiv bewertet (laues Bier,
Hitze zum Umkippen, alles zum Kotzen, Zuckerlippchen). Der bildliche Ver-
gleich mit einem Kanarienvogel und dem Papagei zeichnen die individu-
elle Wahrnehmungsart eines der Partner, seine Aufgeschlossenheit gege-
nüber Schönem und Schönheit. Aus syntaktischer Sicht lassen sich in
dem oben angeführten Gespräch syntaktische Einsparungen, Ausklam-
merungen, aufzählende Parzellierungen herausstreichen. Gerade im
funktionalen Stil der Alltagsrede lässt sich sehen, wie der Mechanismus
der Sprache funktioniert, der sich vor jeder Starrheit hütet und stets im
Streben nach Neuem, bisher nicht Genanntem begriffen ist.
Funktionalstil der Wissenschaft
Im engen Rahmen eines Lehrbuches kann es selbstverständlich nur
um einige generelle Grundzüge gehen. Zum Stil der Wissenschaft gehö-
ren das gesamte wissenschaftliche und technische Schrifttum sowie wis-
senschaftliche Vorlesungen und Vorträge. Der wissenschaftliche Text ver-
mittelt die Erkenntnisse. Der Leser muss im Stande sein, den Gedan-
kengang nachzuvollziehen. Während für die Alltagsrede die Situations-
gebundenheit kennzeichnend ist, ist der wissenschaftliche Text von der
37
Situation unabhängig. An Stelle von semantischen und syntaktischen
Einsparungen tritt das Streben nach vollständiger Ausformu-
lierung. Der Vermittlung wissenschaftlicher Sachverhalte dient die
Verwendung der Terminologie. Termini werden durch Definition fixiert.
Das Definieren wie das Kommentieren und das Argumentieren sind für
den wissenschaftlichen Text dominierende Darstellungsarten. Die All-
gemeinverständlichkeit ist hier eingeschränkt, denn der wissenschaftli-
che Text richtet sich an einen ganz bestimmten Adressatenkreis. Der
Verfasser des wissenschaftlichen Textes strebt nach der Darlegung o b-
j e k t i v e r Zusammenhänge; das Subjektive hat zurückzutreten. Die in-
dividuelle Sprachgestaltung sowie expressive, emotional betonte Dar-
stellung muss weit gehend gemieden werden. Das Letztere aber darf
nicht absolut genommen werden, was auch die jüngsten Untersuchun-
gen der wissenschaftlichen Texte belegen. Kaum ein wissenschaftlicher
Text besteht nur aus Termini und Formeln. Bereits C h. B a 11 y schrieb,
dass „ein persönliches und emotionales Element ständig in den Aus-
druck des reinen Gedankens einsickert“ [Eaniin, 2001, 5P0].
Das Prinzip der Ausdrucksvariation ist aber auch hier wirk-
sam. Sehen wir uns den folgenden Text an:
Von herausragender Bedeutung für strategische Entscheidungen ist häufig der
soziokulturelle Bereich. Viele Misserfolge und Fehlinvestitionen haben in einer
mangelhaften Beobachtung und Analyse gerade dieses Bereichs ihre Ursache. Es
besteht die Gefahr, dass der schwer fassbare und meist nicht quantifizierbare
Charakter der hier relevanten Faktoren zu ihrer Vernachlässigung fuhrt.
Von besonderer Bedeutung für das Verstehen der soziokulturellen Umwelt
und ihrer Entwicklung sind demographische Merkmale und die vorherrschen-
den Wertmuster. Insbesondere geht es um die frühzeitige Erkennung eines sich
abzeichnenden Wandels. (H. Steinmann, G.Schreyögg. „Management“)
Es ist nicht schwer zu erkennen, dass der Autor an mehreren Stellen
die Entscheidung darüber treffen musste, welche Lexeme sich besser
dazu eignen, seine Gedankengänge präziser herauszuarbeiten, ohne
dass dabei Wiederholungen entstehen: von herausragender Bedeutung,
von besonderer Bedeutung, der soziokulturelle Bereich, die soziokulturelle
Umwelt. Bei der Wortwahl entscheidet sich der Autor für relevant
(„wichtig, entscheidend“), für Fehlinvestitionen („falsche, fehlerhafte
Investitionen“), für Investitionen („Anlagen“).
Im oben angeführten Textbeleg ist auch die subjektive Modalität des
Autors nicht zu verkennen. Durch von herausragender Bedeutung, von be-
sonderer Bedeutung, insbesondere, fuhrt zur Vernachlässigung ist er davon
überzeugt, dass die von ihm beschriebenen Sachverhalte eben so ausse-
hen, wie er sie ermittelt und erfasst hat. Dabei versucht er auch auf den
Rezipienten in der Richtung einzuwirken, dass der Letztere ihm glaubt
und seine (des Autors) Gedankengänge nachvollzieht.
Die unterschiedlichen Gegenstände von Natur- und Geisteswissen-
schaften bedingen unterschiedliche Aufgabenstellungen, daraus ergeben
38
sich auch Unterschiede im Sprachstil. In den Texten aus den Naturwis-
senschaften sind technische Termini stilbildend und stilprägend. Sie sind
konkreter, als allgemeinwissenschaftliche Termini oder Fachwörter aus
den Geisteswissenschaften, weil hinter ihnen der Gegenstand des techni-
schen Gedankens steht. Der technische Terminus stellt die \ferbindung
mit den Objekten aus der realen Welt über den Begriff her und ist selbst
von einem ganzen System der technischen Normen umgeben, die Typen
und Klassen von Maschinen und Mechanismen bezeichnen. Darin kom-
men öfters zahlen- und buchstabenmäßige Bezeichnungen vor, die die
Nummer des Modells, die Ausmaße des Erzeugnisses, das Gewicht usw.
angeben. Die Verben, die in den technischen Texten vorkommen, sind
häufig desemantisiert, d.h. sind an sich genommen keine selbst-
ständigen Bedeutungsträger (vornehmen, erfolgen, vollziehen, setzen, stel-
len, führen usw.). In technischen Texten ist die Väriativität des sprachli-
chen Ausdrucks zwar wahrscheinlich, aber höchstens niedrig. Die
Modalität des Autors kommt hier gar nicht zum Vorschein.
Stil des öffentlichen Verkehrs (Direktive)
Die Texte aus dem öffentlichen Verkehr befriedigen das unmittelbare
gesellschaftliche Bedürfnis nach verlustloser Kommunikation. Zwischen
den Kommunikationspartnem soll exakte Verständigung zu Stande
kommen. Wissen soll im Text so getreu gespeichert werden, dass der Sinn-
gehalt vom Partner unverzerrt wieder entnommen werden kann. Das Ge-
sagte (Niedergeschriebene) deckt sich mit dem Gemeinten. Kriterien für
die Qualität solcher Texte sind Eindeutigkeit, Vollständig-
keit, begriffliche Schärfe. Es wird ein geringer Aufwand bei der
Herstellung dieser Texte angestrebt. Durch Texte der Direktive werden
\ferhaltensweisen gesteuert. Der Empfänger soll zu einem bestimmten
Verhalten gebracht werden. Die genannten Kriterien galten nicht immer.
So hielt der Kanzleistil des 17./18. Jahrhunderts weitläufige Umschrei-
bungen nüchterner Bekanntgaben für angebracht. Von der einen Seite
herrscht in solchen Texten die Tendenz zur Sprachökonomie vor, von der
anderen Seite müssen sie eingängig sein, d.h. es muss Rücksicht genom-
men werden auf den Empfänger und dessen Aufnahmefähigkeit.
Man unterscheidet die unmittelbare und mittelbare Direktive
[vgl. Fleischer, Michel, 1977, 264—265]. Zur unmittelbaren Direktive
gehören u. a. Gesetze, Verordnungen, Anweisungen, Verträge und sonstige
Bekanntmachungen amtlichen Charakters, ferner Anträge und Gesuche
an Behörden, Gebrauchsanweisungen u. dgl. Es ist klar, dass hier ästheti-
sche Anregungen zurückzutreten haben.
Die individuelle Gestaltungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Die Tex-
te der Direktive sollen nach Eindeutigkeit und Genauigkeit streben, sie
sollten auch verständlich sein, zumindest von dem Kreis der Rezipien-
ten, an den sie sich richten. Das Streben nach Klarheit und Verständ-
lichkeit bewirkt z. B. im Text der Gesetze Fortsetzungsdefinitionen, da
39
die allgemein sprachlichen Bedeutungen der Wörter oft nicht ausrei-
chen, um Eindeutigkeit zu erlangen. In der Fassung des „Steuerrechts“
aus dem Jahre 1975 können wir sehen, wie die Eingängigkeit durch
Fortsetzungsdefinitionen abgesichert wird:
Die Steuerschuld ist eine Schuld, deren Erfüllung der Steuerschuldner dem
Steuergläubiger kraft des Steuerschuldverhältnisses schuldet.
Beteiligte des Steuerschuldverhältnisses sind der Steuergläubiger und der
Steuerschuldner. 1) Steuergläubiger ist diejenige Körperschaft, der die Steuer
oder ein Anteil daran zusteht... 2) Steuerschuldner ist das Rechtssubjekt eines
Steueigesetzes (Steuersubjekt), dem das Steuerobjekt (Steuergegenstand) die-
ses Gesetzes kraft gesetzlicher Anordnung zugerechnet wird.
Bei gesetzlichen Bestimmungen sind nach Möglichkeiten inhaltliche
Lücken und Zweideutigkeiten zu vermeiden, eben deshalb sind die Satz-
baupläne umständlich und detailliert und mehr oder weniger einheit-
lich, was das Ziel der Aussage angeht. Ausrufesätze, Fragesätze, sogar
rhetorische Fragen fallen weg, wenn es darum geht, die Bewusstseinsin-
halte zu vermitteln. Emotionen sowie expressionsbedingte Inversionen
mit dem Ziel der logischen Abhebung, Abgrenzung wären hier fehl am
Platze. Die Gesetze sind keine auktorialen Produkte, in diesem Sinn
sind sie anonym, deshalb tragen sie auch kein auktoriales Gepräge,
wie es z. B. in der Belletristik und Journalistik oft der Fall, wenn nicht zu
sagen, eine Verbindlichkeit ist. Das Unpersönliche dieser Texte hat auch
ihre sprachliche Basis im Vorherrschen der passivischen und statischen
Satzausformungen, im präferenzierten Gebrauch der verbalen Streck-
formen {zur Beurteilung gelangen, in Widerspruch geraten, Widerspruch
einlegen).
Eine besondere Rolle spielen hier die sprachlichen Mittel des Veran-
lassens. In gesetzlichen Bestimmungen werden dazu Modalverben, Ver-
ben der Aufforderung {anordnen, veranlassen, verordnen, verlangen
u.Ä.), bestimmte unpersönliche Konstruktionen {ist unzulässig, erfor-
derlich) sowie die Konstruktion mit haben + zu und sein + zu gebraucht.
Einschlägige Beispiele aus dem Steuergesetz:
1. Dass es nur eine einheitliche Gesetzgebungskompetenz gibt, darf ein
jüngeres) Steuerrecht ein (älteres) privatrechtliches Institut antasten.
Durch das Modalverb „dürfen“ wird das Verhältnis gesteuert zwi-
schen dem „Steuerrecht“ und einem „privatrechtlichen Institut“, und
zwar wird durch „dürfen“ klar gemacht, dass das „privatrechtliche Insti-
tut“ dem allgemein gültigen Steuerrecht unterliegt.
2. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der
Entschädigung regelt...
40
In diesem Beispiel sehen wir deutlich, wie die Verbindlichkeit des
Gesetzes auf sprachlicher Ebene herausgestrichen wird und beinahe
suggestiv auf den Rezipienten einwirken soll. Parallel gebaute Satz-
strukturen mit dem Passiv, ungefähr gleiche Satzlängen, Modalverben
dürfen, sollen sowie die mit „dürfen“ synonymisch wirkende Struktur
ist zulässig ebenso wie die wortwörtliche Wiederholung zum Wohle der
Allgemeinheit steigern die Wirkung der Verbindlichkeit, machen den
Text des Gesetzes wirklich zur Direktive, der es schwer oder gar un-
möglich zu entkommen ist.
Selten gibt es nur eine Möglichkeit, das Gemeinte auszudrücken,
doch praktisch bevorzugen die Texte des öffentlichen Verkehrs bestimm-
te Fügungsweisen, syntaktische Muster, die sich als brauchbar für den
jeweiligen Gegenstand erwiesen haben. Das geschieht nicht zuletzt aus
sprachökonomischen Gründen. Der Textverfasser übernimmt praktisch
nicht nur den sachverhaltsgebundenen Wortschatz, sondern auch syn-
taktische Fügungsweisen als Muster für den Bau seiner Texte. Der Me-
diziner, dem das Muster eingeprägt worden ist: „Der Patient wird kon-
servativ behandelt“ oder „Der Patient wird operativ versoigt“, bleibt
dem Muster treu, wenn er in einer Anweisung an die Krankenschwester
schreibt: „Der Patient wird stationär behandelt.“
Die Wortwahl hat in den Texten der Direktive eine gänzlich andere
Bedeutung als in der Kunstprosa. Die Stilschicht liegt fest: es ist die
mittlere, normalsprachliche Schicht; Stilfärbungen, etwa
„scherzhaft, derb, spöttisch“ dürfen kaum in den Text eindringen; Wie-
dergabe von Stimmungen steht nicht zur Debatte. Aufs Ganze gesehen,
wählt man unter Wörtern mit ausgesprochenem Benennungscharakter.
Das angemessene Wort ist das definierte Eichwort (der Terminus). Und
dieses wird vom Benutzer gar nicht „gewählt“, sondern mit der Sache
erworben. Termini stehen aber stets in einem System, und ihre fachspe-
zifische Bedeutung gewinnen sie aus der Zugehörigkeit zu einem sol-
chen System (Fachwörter der Jura, Wirtschaft usw.).
Texte des funktionalen Stils des öffentlichen Verkehrs zeichnen sich
durch klare sprachliche kompositorische Explizierung der inneren ge-
danklichen Gänge bei der Darstellung der Sachverhalte. Sie sind au-
genfällig „zergliedert“ in Teile, Paragrafen, Artikel, Punkte, in einzel-
ne (oft speziell überschriebene) Kompositionsfragmente bei einem
Vertrag, in voneinander abstehende und dadurch voneinander abgeho-
bene Absätze z. B. in einer Anweisung oder Anordnung. Vertragswerte
schließen eine ganze Anzahl von verbindlichen, stark schablonisierten
Kompositionsteilen ein, die aus einem Vertrag in den anderen hi-
nüberwandem und als Vfertragsmuster bei der Aufsetzung neuer Ver-
tragswerke gelten.
Zu den unweglassbaren inhaltlichen Kompositionssegmenten eines
Vertrags gehören z. B.:
1) Fixierung der Vertragspartner;
2) Identifizierung des Vertragsgegenstandes;
41
3) Festlegung der Termine und Konditionen bei der Umsetzung des
Vertrages;
4) Rechte und Pflichten der Vertragspartner;
5) Verrechnungsordnung;
6) Verantwortlichkeit der Vertragspartner;
7) Konditionen der höheren Gewalten;
8) die in Streitfällen geltenden juristischen Normen und Gesetze;
9) die Bedingungen des In-Kraft-Tretens, Dauer und Bedingungen
der Vertragsgültigkeit;
10) juristische Adressen der Vertragspartner;
11) beglaubigte Unterschriften der Vertragspartner.
Die Explikation der thematisch-kompositorischen Gliederung eines
Angebots würde etwa folgende Gesetzmäßigkeiten ergeben:
ANGEBOT
RESI HAMMERER
TRACHTENMODEN
Landstraße 7
4020 LINZ
Tel. 0043 732 271740
Firma
Gianni Milanese
Via Arno
1-50100 FIRENZE
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum
******** 2005-10-02 Dkfm.B/SI 5.10.2005
BETREFF:
Trachtenkostüme und Walkjanker
Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und übermitteln Ihnen wunschgemäß
unsere Spezialkataloge für Damentrachtenkostüme und Walkjanker sowie
die aktuelle Preisliste für den Export (alle Preisangaben exkl. Mehr-
wertsteuer).
Bei Bestellung bis Jahresende können wir Ihnen die Lieferung bis spätes-
tens Ende August des folgenden Jahres zusagen. Die Lieferung erfolgt
wahlweise per Bahn oder Spedition.
Unsere Zahlungsbedingungen sind netto Kassa innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Rechnung.
In Erwartung Ihres geschätzten Auftrages verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Beilagen:
1 Preisliste
2 Spezialkataloge RESI HAMMERER
Maria Wallner
42
Außer den Texten der unmittelbaren Direktive sind auch Texte der
mittelbaren Direktive zu erwähnen. Dazu gehören u.a. die politische
Rede und der Aufruf: Dabei handelt es sich ganz besonders um die He-
rausbildung von Einstellungen und Überzeugungen, was diese Texte
dem Stil der Publizistik enger verwandt macht, als dem Stil des öffentli-
chen Xbrkehrs.
Stil der Presse und Publizistik
Beim Stil der Presse und Publizistik kann die Problematik kaum er-
schöpfend dargestellt werden, denn die sprachlichen Ausformungen
sind hier äußerst mannigfaltig. Wir müssen uns daher auf journalistische
Texte beschränken, bei denen es sich um solche Formen handelt, wie
Nachricht. Redaktionsartikel, Glosse, Kommentar, Reportage, Replik, In-
terview usw.
Was hält solch unterschiedliche Formen zusammen? Erstens der
Umstand, dass sie für Massmedien gedacht sind und als Massmedien-
texte ihre Verbreitung und Verwendung finden. Zweitens kennzeichnen
sie sich durch eine Wirkungsabsicht, die sie in den Dienst der Mei-
nungsbeeinflussung, der kollektiven Erziehung und
Bildung stellt. Diesem Ziel ist alles von der Stoffauswahl bis zur letz-
ten Detailformulierung untergeordnet. Drittens spiegeln Massmedien-
texte reale Sachverhalte wieder und nicht „fiktive“, ausgedach-
te, eingebildete, nicht Visionen wie Texte der schöngeistigen Literatur.
Sie entstehen als Bewusstseinsreaktion auf ein Ereignis, das für Massen-
denken und Massenhandlungen von Bedeutung ist und sie in gewissem
Grade prägt. Viertens lassen die Massmedientexte die Umwelt nicht als
Anhäufung von Einzelereignissen und Einzeltatsachen erkennen, son-
dern sie (die Umwelt) tendenziell erschließen und eine wün-
schenswerte oder weniger wünschenswerte oder gar unerwünschte Ent-
wicklung prognostizieren. Es verhält sich eben so, dass die Informatio-
nen, die in Massmedientexten vermittelt werden, die Erfahrung des Re-
zipienten bei wiederholter Wahrnehmung (bei wiederholtem Lesen) ver-
tiefen und verfeinern. Wenn ein Bewusstseinskonzept mehrmals aktuali-
siert wird (und das geschieht, wenn Massmedieninformationen regel-
mäßig verfolgt werden), entstehen beim Rezipienten Deutungs- oder
Interpretationsweisen, die schon dazu führen, dass ein Bild, eine Vor-
stellung von dem uns umgebenden Lebensstrom herausgearbeitet wer-
den. Die Erkenntnis der umgebenden Welt komplettiert sich mit jeder
neu gelieferten Massmedieninformation, bindet die Person des Lesers
an einen bestimmten Punkt in der Wahmehmungsweise der Umwelt
und rüstet ihn mit einer gewissen Ideologie aus, d. h. mit der Sicht, Auf-
fassung, Standpunkt, die ihm (dem Leser) im Weiteren helfen sollen,
sich im Informationsfeld zurechtzufinden und alle Informationen den
realen Sachverhalten gegenüberzustellen, um sich selbst, sein Ego, in
der umgebenden Welt zu positionieren, um sich festzulegen mit der Ein-
43
Schätzung dessen, was um ihn herum vor sich geht. Und in diesem Sinn
sind Massmedientexte bestimmt dazu angetan, als ideologisches Rüst-
zeug zu dienen.
Je nachdem, ob und wie die Position des Journalisten zu Tage tritt,
unterscheidet man verschiedene Substile innerhalb des funktionalen
Stils der Presse und Publizistik. An einem Ende der Skala ist der offizi-
ell-informative Substil: der Autor (der Journalist) wahrt hier konsequent
den Schein seiner vollkommenen Abwesenheit und hält sich mit seinen
Wertungen und Deutungen zurück; das Schlusslicht auf der Skala bilden
Kommentare und Feuilletons, wo der Autor gänzlich zum Interpretator
wird und den Leser in der Richtung manipuliert, sich seiner Sehweise
(der Sehweise des Autors) anzuschließen.
Aus sprachlichen Eigentümlichkeiten sind vor allem ideologiegebun-
dene Begriffskonzepte zu erwähnen, die mit der Zeit bei fortschreitender
Erkenntnis der bestehenden Zusammenhänge zwischen einzelnen
Sachverhalten abgewandelt werden und eine andere Sicht erschließen
können. Solche Entwicklung hat z. B. das Begriffskonzept „Terror, Ter-
rorist, Terrorismus“ schon im Verlaufe der militärischen Aktionen in
Tschetschenien durchgemacht. Vor der ersten militärischen Operation
in Tschetschenien, als die Hintergründe zumindest für die westliche
Welt noch im Unklaren lagen, konnte man in Bezug auf die Tschetsche-
nier, die gegen die Regierungstruppen kämpften, solche Benennung an-
treffen, wie „Separatisten, Abtrünnige, Aufständische“. Je klarer es
wurde, dass die Handlungen der tschetschenischen Kämpfer ganz an-
ders beschaffen sind und ein anderes Ziel, als einfach Abtrennung von
Russland verfolgen, desto öfter wurden in den westlichen Medien die
Bezeichnungen „Terroristen, Banditen“ gebraucht. Die Wortwahl un-
terliegt also nicht nur der Entscheidung des Sprechers über die Variation
des Ausdrucks, sondern auch der Sicht, dem Standpunkt, der Auffas-
sung des betreffenden Sachverhalts durch den Autor/Journalisten.
Was die Wortwahl angeht, sind in Massmedientexten alle Wort-
schichten und alle Wortfarbungen im Prinzip zulässig, außer den mar-
ginalen, aber auch die kann man in satirisch zugespitzten Kommentaren
nicht ausschließen.
In informativen und informativ-analytischen Genres der Massmedien
haben sich im Laufe der Zeit spezifische Begriffsfelder herausgebildet, in
denen gesellschaftlich-politische Bewusstseinskon-
zepte abgebildet sind. In den meisten Fällen handelt es sich um keine
politischen oder soziologischen Termini und terminologisierten Bezeich-
nungen. Das sind aber kulturspezifische Benennungssysteme, die um die
wichtigsten gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Konzepte grup-
piert sind. Hier wären z. B. solche Benennungssysteme zu erwähnen, wie:
Wahlen, diplomatische Beziehungen/Verhandlungen, Staatsbesuche,
Massenorganisationen und Parteien, Konfliktsituationen und Kriegs-
handlungen, internationaler Handel, Kooperation auf politischem und
wirtschaftlichem Gebiet und anderes mehr. Diese Begriffsfelder sind zwar
44
allgemein verständlich, enthalten aber auch kulturspezifische Eigentüm-
lichkeiten. Besonders deutlich kommen diese Eigentümlichkeiten in den
so genannten Zeitungsklischees zum Vorschein. Kopf an Kopf rennen
(wenn die Bewerber im Wahlkampf gleiche Aussichten haben), eine Nie-
derlage einstecken/hinnehmen müssen-, ein Wahlbündnis eingehen, einheit-
lich auftreten (bei Wahlen), mit deutlichem Vorsprung siegen waren stets
häufige Klischees, wenn von den Wahlen in westlichen Demokratien die
Rede war und fehlten ganz oder teilweise in den Wahlkonzepten der Län-
der des ehemaligen sozialistischen Lagers. Erst nach der großen histori-
schen Wende der 90er Jahre erfolgte die Annäherung der Konzepte und
somit wurden manche kulturspezifische Eigentümlichkeiten in den Be-
nennungssystemen in Ost und West ausgeglichen.
Das "Vbrhandensein einer ganzen Reihe von schablonisierten Wort-
verbindungen, von Klischees gehört zu den weiteren Besonderheiten der
Wartwahl in Massmedientexten.
Die Klischees werden als eine Abart von Phraseologismen aufgefasst, in
denen die Austauschbarkeit der Teile durch Schablone erschwert ist oder
gar unmöglich wird.
Klischees sind vorgefertigte Formen für den „Guss“ der häufig vor-
kommenden Sachverhalte. Die meisten davon sind nach dem Modell
„Nomen (Substantiv) + Verb“ aufgebaut, z. B.: mit einem Besuch eintref-
fen, zu einem (ergiebigen) Abschluss kommen, eine Wahlkampagne starten,
das Wettrüsten schüren, die Wirtschaft ankurbeln, die Spannungen anhei-
zen', die Beziehungen aufnehmen, pflegen usw.
Die Massmedien sind Bereiche, wo sich verschiedene Kulturareale oft
und ziemlich intensiv berühren. Einer solchen Kulturberührung entspringt
der frequentierte Gebrauch vom Fremdwortgut im funktionalen Stil der
Presse. Um anschaulich und glaubwürdig zu sein, um sein Eingeweihtsein
in die gesamteuropäischen Verhältnisse und Probleme des einigen
Europa(s) nachweisen zu können, gebraucht der Journalist in seinen Mate-
rialien oft Benennungen, die zwar dem Deutschen bisher nicht eigen wa-
ren, im Zuge der Globalisierung aber ins Blut und Fleisch des Deutschen
übergegangen sind. Ihr unbestreitbarer Vorteil liegt darin, dass sie, auf altem
gesamteuropäischem Relikt wortgut (Griechisch und Latein)
beruhend, heute eine störungsfreie gesellschaftspolitische und wirtschafts-
politische Kommunikation begünstigen. „Harmonisierung und Subventio-
nen, Hierarchien und Kohäsion (Kohäsionsfonds), Kompetenzen und
Kooperationen“ sind im gesamteuropäischen Kulturareal unbestreitbar
auch ohne Übersetzung verständlich, während die deutschspezifischen Be-
nennungen öfters sogar einer deutenden Übersetzung bedürfen: z. B. der
Zuschuss, j-n/etw. bezuschussen, Angleichung oder Zuständigkeiten.
An Massmedientexte werden analoge Erfordernisse wie auch an an-
dere Texte gestellt, aber ihre Anordnung kann etwas anders aussehen.
Folgerichtigkeit, Klarheit, Anschaulichkeit sollten da-
bei im Chor der anderen Ansprüche an einen stilgerecht ausgeformten
Text führend sein.
45
Stil der schöngeistigen Literatur (Belletristik)
Der Stil der schöngeistigen Literatur stellt ein äußerst komplexes
Phänomen dar, welches ohne Zusammenarbeit mit dem Literaturwis-
senschaftler kaum zufrieden stellend zu erfassen ist. Ein literarisches
Werk ist unter dem linguistischen Aspekt nicht einheitlich, sondern
mit dem Gesamtsystem der Sprache in all seinen Schichtungen ver-
bunden. Aber es muss etwas geben, was den Stil der schöngeistigen Li-
teratur existenzberechtigt macht. Wenn wir davon ausgehen, dass die
Sprache selbst eine Bedienung ist, so ließe es sich sagen, dass das
Sprachkunstwerk das Bedürfnis der Menschen nach ästhetischem
Genuss befriedigt. Ein sprachliches Kunstwerk ist dazu berufen,
nicht nur das Denken der Menschen, sondern auch den ganzen Reich-
tum ihrer Gefühle auszudrücken. Ein Sprachkunstwerk entspringt
nicht so sehr dem Ratio des Verfassers, viel mehr ist es ein Produkt sei-
ner Seele, seiner Gemütsbewegungen. Im Unterschied zur rationalen
Abbildung durch wissenschaftliche Texte ist der künstlerische Text auf
die sinnliche Abbildung (Emotionen, Wahrnehmungen, Vorstellungen)
gerichtet. Die Welt wird hier nicht mit den Kräften des abstrakten
Denkens erkannt und angeeignet, sondern auf eine künstlerisch bild-
hafte Weise durch Emotionen. Der Künstler kann sich nicht darauf be-
schränken, allein die faktuale Information durch seine Gedanken zum
Objekt der künstlerischen Darbietung zu machen. Xfergleichen wir die
beiden folgenden Texte:
1. Die Deutsche Bundesbahn befindet sich — aus unterschiedlichen Grün-
den — in einer Situation, in der sie ihrer Rolle als unverzichtbares Verkehrsmit-
tel nicht mehr gerecht werden kann.
Die DB hat in den letzten 40 Jahren kontinuierlich Anteile an den insge-
samt wachsenden Verkehrsmärkten eingebüßt. Sowohl im Personen- als auch
im Güterverkehr ist sie mit ihrer heutigen Verkehrsleistung nahezu auf dem Ni-
veau von 1960 stehengeblieben. In der Zwischenzeit hat sich die Verkehrsleis-
tung im Güterverkehr insgesamt mit rund 109 Prozent Wachstum mehr als ver-
doppelt, im Personenverkehr hat sie sich sogar um rund 185 Prozent gesteigert.
(„Almanach der Bundesregierung. Presse und Informationsamt der Bundesregie-
rung“)
2. Wir sitzen alle im gleichen Zug
Und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit.
Wir packen aus. Wir packen ein.
Wir finden keinen Sinn.
Wo werden wir wohl morgen sein?
Der Schaffner sieht zur Tür herein
Und lächelt vor sich hin.
Ein Nachbar schläft. Ein anderer klagt.
Der Dritte redet viel.
Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt,
Kommt niemals an sein Ziel.
Die 1. Klasse ist fast leer.
Ein dicker Mann sitzt stolz
Im roten Plüsch und atmet schwer.
Er ist allein und spürt das sehr.
Die Mehrheit sitzt auf Holz.
(E. Kästner. „Eisenbahngleichnis“)
46
Wie stark die beiden Texte divergieren, sieht man auf den ersten Blick
und nicht nur daran, dass im zweiten Beispiel ein gereimtes Werk ange-
führt wird. Die Sachverhalte des ersten Textes Verkehr, Eisenbahn, Ver-
kehrsmittel, Verkehrsmarkt, Güterverkehr, Personenverkehr, Verkehrsleis-
tung werden als sachliches Informationskonzept dargelegt, welches vom
Autor ebenso sachlich interpretiert wird. Er setzt konsequent seine Mei-
nung durch, dass die deutschen Eisenbahnen an Bedeutung und Leis-
tung einbüßen, und bekräftigt seinen Standpunkt mit Zahlen. Kein Wort
darüber, ob es für die Wirtschaft gut oder schlecht wäre, keine Explikati-
on seiner Stellungnahme, seiner Gefühle. Allein die innere Logik seiner
Gedankengänge, gepaart mit aufschlussreichen zahlenmäßigen Anga-
ben lässt uns vermuten, dass der Autor etwas kritisch eingestellt ist, weil
die DB nicht mehr der Situation gerecht werden kann.
Im zweiten Beispiel ist die Eisenbahn (der Zug) überhaupt kein rea-
ler Sachverhalt mehr. Es ist ein künstlerisches Bild, eine Vision, eine
Metapher für das menschliche Leben. Es gibt hier keine Abbildung der
Realitätsbezüge, alles ist eine Fiktion, alles ist erdacht und umgedeutet.
Auch die Absichten, die im ersten und im zweiten Text umgesetzt wer-
den, sind verschieden. Die künstlerische Intention von E.Kästner be-
steht in der Einwirkung auf die Gefühlswelt der Leser, in der Vermitt-
lung seiner (auktorialen) Auffassung des Lebens, in der Ausprägung sei-
nes Eindrucks vom Leben, dass in seiner künstlerischen Konzeption
eintönig, trostlos, grau, ziellos ist, abgesehen davon, ob man „auf
Plüsch“ oder „auf Holz“ sitzt.
Die beiden oben angeführten Texte (Sachtext und künstlerischer
Text) lassen sich in einen Diskurs einbauen, um adäquat rezipiert und
verstanden zu werden. Für einen Sachtext muss es ein anderer Diskurs
sein, als für einen künstlerischen. Der Diskurs der Sachtexte besteht
aus Informationskonzepten, die vorher in der praktischen Erfahrung
des Lesers angespeichert worden sind. Der Diskurs für einen künstleri-
schen Text setzt voraus, dass der Leser die individuelle sprachliche Ge-
staltung des Verfassers, das künstlerische Bild mit seiner persönlichen
gefühlsmäßigen Erfahrung in Verbindung zu setzen vermag, so dass
seine (des Lesers) Seele „anzuklingen“ beginnt. Sein eigenes „Erleb-
nis“, „Gefühl“, „Empfinden“ werden in der künstlerischen Darbie-
tung wiederaufgenommen, wiederaufgegriffen, antizipiert. Das Ver-
ständnis erwächst also aus dem Einklang dessen, was als künstlerisches
Bild vermittelt wird, und der gefühlsmäßigen Erfahrung, aus der Art
und Weise, wie die Welt bisher erlebt worden ist und jetzt erlebt wird.
In der schöngeistigen Literatur gibt es nur „erlebte Wirklich-
keit“, die zwar gewissen Bezug auf die Realitäten haben kann, aber
nicht unbedingt.
Das Individuum des Künstlers drückt dem Werk seinen Stempel auf,
er schafft individuelle Bilder und gestaltet sie sprachlich individuell. Der
Schriftsteller scheut das Stereotyp, die Schablone, er sucht einen nur
•hm eigenen Ausdruck.
47
Im Vergleich zu den anderen Funktionalstilen steht der künstleri-
schen Literatur die weiteste Auswahl sprachlicher Mittel zur Verfügung,
soweit sie der ästhetischen Funktion untergeordnet sind.
Literaturnachweis
1. Benes E., Viachek J. Stilistik und Soziolinguistik: Beiträge der Prager
Schule zur strukturellen Sprachbetrachtung und Spracherziehung. — Berlin,
1971.
2. Fleischer W.y Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —
Leipzig, 1977.
3. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. — M., 1963.
4. Sprache und Praxis: Lehrbuch für Sprachkommunikation an Ingenieur-
und Fachschulen / Hrsg, von W. Schmidt. — Leipzig, 1972.
5. Eqjuiu UI. OpanuyacKa« cTKJiucTUKa. — M., 2001.
Kapitel 5
DER DEUTSCHE WORTSCHATZ
ZU STILISTISCHEN ZWECKEN
§ 13. Die Bedeutung der Wortwahl
Jeder, der sich mit dem gesprochenen oder dem geschriebenen Wort
an die Allgemeinheit wendet, ist verpflichtet, seine Sprache richtig zu
gebrauchen. Es heißt, er muss die Sprachmittel, die ihm zur Verfügung
stehen, mit den gültigen Sprach- und Stilnormen so einsetzen, dass sei-
ne Mitteilung verstanden wird.
J.W. Goethe wurde einmal gefragt, wie er es angefangen habe, ei-
nen so guten Stil zu schreiben. „Das will ich Ihnen sagen“, soll er ge-
antwortet haben. „Ich habe die Gegenstände ruhig auf mich einwir-
ken lassen und den bezeichnendsten Ausdruck dafür gesucht“ (zit.
nach: „Gepflegtes Deutsch“. Leipzig, 1969. S.67). Den bezeich-
nendsten Ausdruck, das genaueste Wort für eine Sache, einen Ge-
danken suchen — darauf kommt es an, wenn man etwas klar und für
alle verständlich sagen will. Am besten wird das dem gelingen, dessen
Wortschatz sehr groß ist. Drei Zahlenangaben mögen verdeutlichen,
in welchem Verhältnis der Wortschatz eines Einzelnen zu dem Ge-
samtwortgut der deutschen Sprache steht. Goethe gebrauchte in sei-
nen Werken rund 20 000 Wörter. Ein durchschnittlicher gebildeter
Erwachsener kennt 6000 bis 10000 Wörter. Der Gesamtwortbestand
der deutschen Sprache indessen wird auf 300 000 bis 400 000 Wörter
geschätzt. Nicht immer wird von dem Sprecher oder Schreiber der
Versuch unternommen, seine Aussage mit treffenden Wörtern wie-
48
derzugeben. Manchmal genügt es aber häufig vorkommende Wörter
durch sinngenauere Ausdrücke zu ersetzen. Zum Beispiel gehören in
den Texten der Presse und Publizistik solche Wörter wie entwickeln,
orientieren, organisieren, einschätzen, Ebene, Aspekt, Perspektive, ge-
nau, konkret, entscheidend, Schwerpunkt, Frage, Problem, Anliegen zu
den sprachlichen Einheiten, die sich einer sehr hohen Rekurrenz
oder Wiederholbarkeit erfreuen. Welche Ersatzwörter bietet die deut-
sche Sprache z. B. für „entwickeln“? Statt „eine Maschine entwi-
ckeln“ kann man in vielen Fällen sagen: entwerfen, erfinden, ersin-
nen, gestalten, konstruieren, herstellen, bauen, fertigen, herausbringen
oder auch: verbessern, vervollkommnen, überarbeiten — je nachdem,
welche engere Bedeutung mit dem verhältnismäßig weiten Begriff
„entwickeln“ verknüpft werden soll. Eine „lebhafte Diskussion“ soll-
te hin und wieder durch Aussprache, Meinungsaustausch, Meinungs-
streit, Streitgespräch, Erörterung oder Auseinandersetzung ausgewech-
selt werden. Und diese Diskussion braucht sich nicht nur zu entwi-
ckeln, sie kann sich auch entspinnen, anbahnen, erweitern, ausdeh-
nen, ausbreiten, in Gang kommen, beginnen, eingeleitet werden oder
um sich greifen.
Man sagt natürlich richtig, dass beispielsweise Pläne „entwickelt“
werden. Ebenso gut kann man Pläne aber auch entwerfen, anlegen, vor-
bereiten, ausarbeiten, erarbeiten, aufstellen, erstellen usw Ein weiteres
Beispiel. Wfenn es darum geht, den Ablauf eines zeitlich festgelegten Ge-
schehens zu bezeichnen, dann bietet sich dem Schreibenden/Sprechen-
den das W)rt „durchführen“. Dieses Verb ist ein überzeugendes Beispiel
dafür, dass Wortarmut den sprachlichen Ausdruck verkümmern lässt. In
Berichten, Rundschreiben, Bekanntmachungen, Anzeigen werden Aus-
sprachen, Xfersammlungen, Tagungen, Produktionsberatungen, Vorträ-
ge, Lehrgänge, Prüfungen, Ausstellungen, Aufführungen, Sportfeste,
Wettkämpfe, Bauarbeiten usw. durchgeführt. Ist solche Bevorzugung
überhaupt berechtigt? Nein, denn es gibt sehr viele Verben, die das Wort
„durchführen“ nicht nur gut ersetzen, sondern den darzustellenden
Sachverhalt sogar genauer und klarer kennzeichnen. Natürlich ist es
nicht immer falsch, eine Xfersammlung, ein Seminar oder eine Zusam-
menkunft durchzuführen. Die Auswahl würde treffender ausfallen, wenn
solche Veranstaltungen auch mal stattfinden oder abgehalten, anberaumt,
angesetzt werden. Auch Arbeiten aller Art, z.B. Schreibarbeiten, Bauar-
beiten, Instandsetzungen, Ausbesserungen, Reparaturen sollten nicht
nur „durchgefuhrt“, sondern auch ausgeführt, vorgenommen, verrichtet,
erledigt, geleistet, besorgt, vollbracht oder einfach getan werden. Es gibt
sehr viele Möglichkeiten, das Verb „durchfuhren“ zu umgehen. Und es
ist schon an diesen wenigen Beispielen offensichtlich, wie viel abwechs-
lungsreicher der Ausdruck wird, wenn wir nicht immer ein und dasselbe
Verb in einem bestimmten Zusammenhang verwenden.
Als Beispiel für ein Modesubstantiv sei „Anliegen“ genannt. Das
Wort erfreut sich allgemeiner Beliebtheit bei Journalisten, Redakteuren,
49
Kunstkritikern, Wissenschaftlern und Schriftstellern. Die Grundbedeu-
tung des Substantivs das Anliegen ist: „Sache, die ich mir angelegen sein
lasse“ oder „Sache, deren Ausführung jemandem am Herzen liegt“. In
der Gegenwartssprache werden sehr viele Angelegenheiten, Aufgaben,
Bitten, Forderungen und Wünsche mit dem Wort „Anliegen“ bezeich-
net. Hier einige Beispiele, in denen wir Anliegen jeweils durch ein Sub-
stantiv ersetzt haben. Dabei handelt es sich wirklich um Ersatzwörter,
um Synonyme:
1. Die Förderung der Wissenschaft gehört zu den vornehmsten Anliegen
(Aufgaben) der Gesellschaft.
2. Die Sorge dieser Mutter ist unser aller Anliegen (Sorge).
3. Der vorliegende Roman ist eine lehrreiche Lektüre, wenn der Leser
Feuchtwangers Anliegen (Absicht, Konzeption) berücksichtigt.
4. Dieser Sachverhalt gibt Anlass, die persönlichen Neigungen, Interessen
und Anliegen (Wünsche) näher zu betrachten.
5. Zwei Autoren, zwei Gedichte. Beide behandeln sie ein persönliches An-
liegen (Problem), das zugleich ein gesellschaftliches Anliegen (Problem) ist.
6. So ist „Billard um halb zehn“ ein Buch, dass in Anliegen (Vorsatz) und
Gestaltung unsere Aufmerksamkeit verdient.
\6n den Adjektiven erfreut sich „breit“ seit langem großer Beliebt-
heit. Durch allzu häufigen Gebrauch ist es wie konkret, allseitig, ent-
scheidend, wesentlich, perfekt, optimal, attraktiv und echt fast zu einem
stehenden Beiwort geworden. Vor Jahren bezeichnete man im Allgemei-
nen nur jene Dinge als breit, deren räumliche Ausdehnung den Begriff
„Breite“ zuließ: eine breite Straße', ein breiter Graben, Fluss usw. In über-
tragener Bedeutung sprach man von einer „breit angelegten Untersu-
chung“, einer „in die Breite gehenden Darstellung“ und einem „breiten
Lächeln“. Heute jedoch finden wir solche Dinge und Erscheinungen
mit „breit“ näher bestimmt, die mühelos durch andere Adjektive genau-
er gekennzeichnet werden können. Hierfür einige Beispiele:
— ein breites Warensortiment (reichhaltiges, reichliches, ausreichen-
des, umfangreiches, beträchtliches, ansehnliches);
— eine brate Diskussion (ausgedehnte, lange, umfassende, eingehen-
de, ausführliche, ergiebige, lebhafte, fruchtbare).
Wenn unser Wortschatz zusammenschrumpft, verblasst die Anschau-
lichkeit der Rede. Deshalb sollte jeder Schreiber und Redner danach
streben, den treffendsten, eindeutigsten, anschaulichs-
ten Ausdruck für eine Sache zu finden und das allgemeine Wort, die
Schablone, den verwaschenen Begriff zu meiden.
§ 14. Systemhafte Organisation des deutschen Wortschatzes
Die Stilwirkung eines Textes hängt oft gerade von der gruppenmäßi-
gen Herkunft der verwendeten Wörter ab. Deshalb scheint es zweck-
mäßig zu sein, die stilistisch wichtigen Wortschatzgruppierungen, die
50
bevorzugten Anwendungsbereiche des jeweiligen Wortschatzes und die
allgemeinen Stilwirkungen solcher Wörter kennen zu lernen.
1. Bei der Ausgliederung der Wortschatzgruppen gab es und gibt es
bis heute verschiedenartige Kriterien und Herangehen. Die alphabeti-
schen Anreihungen der Wörterbücher verfügen über kein spezielles
Gliederungsprinzip. Nur in Einzelfällen, z. B. bei Zusammensetzun-
gen und Ableitungen wird auf den Zusammenhang einzelner Wortfa-
milien verwiesen, die Wörter mit gleichem Wartstamm umfassen und
so die gleiche Etymologie ausweisen, selbst wenn die Wortartdifferen-
zierung Bedeutungsunterschiede mit sich gebracht hat, z. B. das Verb
„reizen“ und das Partizip „reizend“ oder das Verb „geben“ und das
Substantiv „Gift“.
Eine mehr grammatische Gliederung kann nach der Wortbildung
und den Wortarten erfolgen, z. B. Konkreta, Abstrakta, einfache Bildun-
gen, Ableitungen, Komposita usw.
2. Die häufigste Form der Wartschatzgliederung ist die Differenzie-
rung nach Bedeutungsgruppen. Dabei sind mehrere Ausgangspunkte
möglich:
a) Eine Wortschatzgliederung nach Sachgruppen ist stilistisch sehr er-
giebig, denn in der Regel gibt es für bestimmte Gegenstände und Var-
gänge mehrere Bezeichnungen. Diese Erkenntnisse gewinnen wir aus
jedem Synonymwörterbuch, das bedeutungsähnliche Wörter mit glei-
chem Sachbezug sammelt, oder aus den Wörterbüchern, die nach Be-
griffsbereichen aufgeteilt sind, wie z. B. das Wörterbuch von E. We h r 1 e
und H. Egg e rs „Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen“.
b) Die Sammlung aller Wörter für bestimmte Sach- und Begriffsbe-
reiche hat zur Einsicht über eine feldmäßige Gliederung des Wortschat-
zes geführt. In diesem Sinne ist das Vbrk von J. T r i e r „Der deutsche
Wartschatz im Sinnbezirk des Verstandes“, 1931 in Heidelberg erschie-
nen, als programmatisch für eine große Anzahl von nachfolgenden For-
schungen anzusehen. Innerhalb bestimmter Sinnbezirke ergaben sich
häufig Differenzierungen nach Einzelvorstellungen und Bezeichnun-
gen, die zumeist als Wortfeld bezeichnet werden. Einige Wortfelder sind
reich gegliedert, andere weniger.
Bei konkreter Erforschung der Felder hat sich erwiesen, dass sich
eine große Zahl von Feldern aus Wörtern von unterschiedlichem Stil-
wert zusammensetzt: die Wörter können dabei nullmarkiert sein, d.h.
stilistisch neutral, oder wertend-expressiv, gehoben oder gesenkt, veral-
tend oder veraltet sein. Bei komparativer Analyse der Wortfelder haben
die Forscher herausfinden können, dass die Wrästelung der Felder je
nach Kultur- und Sprachareal ziemlich stark ausgeprägte Differenzie-
rungen ausweist, d.h. die Felder sind kulturspezifisch aufgebaut
und gegliedert. Als Beispiel könnte man das Wortfeld der Farbenbe-
zeichnungen anführen: im Russischen werden manche Farbenbezeich-
nungen mit einem Lexem bezeichnet, im Deutschen muss hier ein
Kompositum gebildet werden: blau, dunkelblau, hellblau — cuhuü, meM-
51
ho-cuhuü, ceemjio-cuHuü (zojiyßoü); grün, salatgrün — 3ejieHt>tü, cajiamo-
ebiü usw.
c) Die bei Dornseiff angeführten Gruppen [vgl. Domseiff, 1965,
55] sind alphabetisch nach grammatischen Wortklassen geordnet: jede
substantivische, adjektivische oder verbale Wortreihe vereinigt Wörter,
die untereinander begrifflich verbunden sind. Das Wortfeld „Bewegung“
z. B. schließt etwa hundert Verben in sich ein. Bummeln trägt z. B. den
Vermerk „literarisch-umgangssprachlich“ und bedeutet „langsam, ge-
mächlich, ziellos spazierengehen“ [s. Riesel, 1963, 55]; doppeln ist ein
mundartliches Wort für tippeln, d.h. „mit kleinen Schritten gehen“; ei-
len bedeutet „hastig, schnell gehen“. Im vielgliedrigen, semantisch und
stilistisch verschiedenartigen Feld gibt es einzelne Wörter, die unterei-
nander synonym sind, z. B. bummeln—schlendern oder strolchen—stro-
mern—tippeln. „Strolchen—stromern—tippeln“ sind ehemalige Argo-
tismen, heute umgangssprachlich, in der Bedeutung „ziellos wandern,
vagabundieren“ (ebenda).
d) E. R i e s e 1 schlägt vor, innerhalb des Feldes thematische Gruppen
auszusondern, z. B. gehen und laufen. Innerhalb der thematischen
Gruppe „gehen“ lassen sich thematische Reihen unterscheiden, in de-
nen das allgemeine und farblose Verb „gehen“ näher bestimmt und ver-
anschaulicht ist. Die thematischen Reihen drücken verwandte, aber
dennoch nicht gleiche Begriffe aus, z. B. „langsam gehen“, „schnell ge-
hen“, „unbemerkt gehen“, „auf und ab gehen“.
Innerhalb jeder thematischen Reihe lassen sich synonymische Reihen
aufstellen, die Wörter mit gleicher oder etwas schattierter Bedeutung
„unter verschiedener Einstellung und verschiedener stilistischer Be-
leuchtung“ erfassen [Riesel, 1963, 59]. So enthält z.B. die thematische
Reihe „langsam gehen“ folgende synonymische Reihen:
1) „gemächlich, ohne Ziel gehen“: schlendern, bummeln, flanieren-,
2) „langsam gehen wegen körperlicher Behinderung“: humpeln, hin-
ken, hatschen (umgangssprachlich — bei „wehem Fuß“);
3) „langsam gehen aus Schlaffheit“: schlurfen, latschen, watscheln,
hatschen.
Eine richtige Wortwahl bedeutet, dass der Reichtum an thematischen
und synonymischen Reihen zweckentsprechend ausgenutzt
wird. Ein einziges treffendes Wort ersetzt oft eine umständliche Erklä-
rung, dadurch wird die Sparsamkeit des Ausdrucks erzielt.
In der letzten Zeit erscheinen immer öfter Forschungen und For-
schungsergebnisse, die ein kognitives Herangehen an die sprachlichen
Gegebenheiten prägt. Die Wissenschaftler sind zur Einsicht gelangt,
dass die Bedeutung des Wortes seinem Wesen nach ein lexikalisches
Konzept ist und von unseren allgemeinen und spezifischen Kenntnis-
sen über den Gegenstand oder die Erscheinung abhängt. Das lexikali-
sche Konzept „Auto“ hängt z. B. von unserer Kenntnis verschiedener
Modelle, des sozialen Status eines Modells, des Stellenwertes des Au-
tos innerhalb der anderen Verkehrsmittel, verschiedenartiger Situatio-
52
nen, welche mit dem Auto verbunden sind, z. B. Panne, Verkehrsunfall,
technische Überprüfung und Wartung ab. Solche Kenntnisse dienen als
Basis für die \brstellung darüber, was ein typisches Auto darstellt und
wie die mit diesem Wort bezeichneten Objekte bestimmt werden müs-
sen. Sie (die Kenntnisse) lassen auch die Äußerung verstehen, der Art
wie: Lauter Probleme mit diesem Auto'. Verschiedene Leute divergieren
natürlich in ihren Kenntnissen, Xörstellungen und praktischen Erfah-
rungen. Die Kenntnisse und Vorstellungen eines Automechanikers
müssen sich von denen eines einfachen Fußgängers oder Autofahrers
unterscheiden.
Aber für die Aufschlüsselung des lexikalischen Konzepts eines VXbrtes
sind gewisse Hintergrundinformationen erforderlich, die in
die Struktur der allgemein üblichen und in bestimmtem Maße verallge-
meinerten Kenntnisse hineingehören. Eben dieses Kenntnisgefüge soll
nach der Meinung der Kognitivisten ein Bestandteil kulturell gewichti-
ger Erfahrungen der Träger einer bestimmten Sprache sein. Für die An-
hänger der kognitiven Lehre ist der Kontext/Kotext, vor dessen Hinter-
grund die Bedeutung erschließbar ist, äußerlich, extern in Bezug auf das
System der Sprache. Bedeutungen stellen kognitive Strukturen dar, die
in die Modelle von Kenntnissen, Vorstellungen und Erfahrungen einge-
schlossen sind. Die Frage darüber, wie diese Strukturen verbalisiert sind,
ob es ein Wort ist oder eine Wortfügung oder eine phraseologische Ein-
heit, ist nicht relevant. Zum Beispiel wird die Bedeutung des Wortes
„die Eins“ erst dann verständlich, wenn der Kontext allgemeine Verstel-
lungen enthält über die Benotungssysteme an den Lehranstalten eines
bestimmten Landes. Der Ausländer, der mit solchem System nicht ver-
traut ist, wird auch keine Basis haben für das richtige Verstehen dieses
Wortes. Die Wörter Jahr, Monat, Tag, Nacht usw. können bedeutungs-
mäßig nur im Rahmen des Konzeptes „Zeit“ erschlossen werden, wobei
in verschiedenen Kulturarealen das erwähnte Konzept auf der Oberflä-
che der Sprache, d. h. wortschatzmäßig unterschiedliche Bezeichnungen
integriert. Im Russischen gibt es z. B. cymKu, im Deutschen fehlt dazu
eine spezialisierte sprachliche Bezeichnung. Im Russischen bezieht sich
das Wort „die Nase“ entweder auf das Konzept „Gesicht“ oder auch auf
das Konzept „Schiff“, im Deutschen aber ist der zweite Bezug nicht üb-
lich.
Die Bedeutungen der Wörter korrespondieren mit bestimmten
kognitiven Kontexten, Kenntnisstrukturen oder Kenntnisblöcken,
die ihrerseits das Verstehen der Wörter sichern. Die kognitiven Kon-
texte werden terminologisch verschieden bezeichnet: kognitiver Be-
reich, mentaler Raum oder Frame. Das kognitive Herangehen ermög-
licht eine andere praktische oder theoretische Behandlung der tradi-
tionellen lexisch-semantischen und lexisch-stilistischen Gruppierun-
gen und Felder. Sie werden nicht nur und nicht primär als sprachli-
che Phänomene ausgewertet, sondern auf die Kenntnis- und Erfah-
rungsbasis der Sprachträger bezogen. Das macht die kognitiven For-
53
schungen zu einem bedeutenden und zuverlässigen Instrument beim
komparativen Studium kultur- und sprachspezifischer Unterschiede
und Gemeinsamkeiten. Es steht ohne Zweifel fest, das z. B. in ver-
schiedenen Kulturen solche Konzepte wie: „Wahrheit, Lüge, Schick-
sal, das Böse, das Gute, Schönheit, Freiheit, Persönlichkeit, Liebe,
Mitleid“ usw. sprachlich unterschiedlich strukturiert sind, aber auch
bei verschiedenen Sprachträgern handelt es sich um differenziertes
Beherrschen oder Nichtbeherrschen einzelner Oberflächenstrukturen
oder Bezeichnungsstrukturen, je nachdem, über welche Erfahrungs-
und Kenntniskonzepte der Sprechende/Schreibende verfügt.
§15. Synonymisches Verhältnis als Basis der Wortwahl
In der traditionellen Linguistik werden Synonyme als sinngleiche
oder sinnverwandte Wörter definiert. Bei der Bedeutungsgleichheit
sind die Lexeme in ihren semantischen Strukturen vollkommen gleich.
In diesem Fall stimmen die Substanz und Struktur, d. h. der Aufbau
aus Bedeutungen bzw. Semen bei zwei oder mehr Lexemen überein.
Die beiden Spracheinheiten beziehen sich auf dieselbe Erscheinung
der Wirklichkeit und können theoretisch daher uneingeschränkt in der
gleichen Textumgebung einander ersetzen. In diesem Fall spricht man
von den so genannten absoluten Synonymen, z.B. Moment—Augen-
blick, gesellschaftlich—sozial, wichtig—relevant, obschon—obgleich—
obzwar. Solche Synonyme sind aber in jeder Sprache keine typische
Erscheinung.
Im Deutschen gibt es sehr viele synonymische Dubletten vom Typ Te-
lefon-Fernsprecher. Ihre Anzahl ist beträchtlich. Viele haben sich dank
der puristischen Tätigkeit in der Geschichte der deutschen Sprache
durchgesetzt. Aber auch sie sind nur bedingt austauschbar. Mit der
Zeit driften die meisten Paare auseinander, entwickeln ihre eigenen,
spezifischen wortbildenden Potenzen, werden in verschiedenen kotex-
tualen Umgebungen aktualisiert. Man wird heute ans Telefon verlangt,
gerufen; zum Telefon kann man laufen, gehen, greifen; zu Hause oder
im Büro hat man Telefon, aber man ist beim Fernsprechamt tätig, bedient
eine Femsprechanlage, erwartet Information von der Fernsprechaus-
kunft.
„Perron, Billet, Coupe, Couvert“ werden im südlichen Sprach-
raum (in Österreich, in Bayern) immer noch mit großer Xörliebe ge-
braucht, insbesondere von den älteren Leuten, die zu der bildungstra-
genden Schicht gehören. Dieser Gebrauch macht ihre Redeweise
„apart“, durch die Feinheit des sprachlichen Ausdrucks auffällig. Im
Leben werden „Tragödien“ erlebt, im Theater kann dasselbe auch als
„Trauerspiel“ erlebt werden, im „Stadtzentrum“ kann man bummeln,
aber ein wichtiger Gedanke steht im „Mittelpunkt“ der auktorialen
Darbietung; in einem „Lied“ handelt es sich vorwiegend um Persönli-
54
ches, in einem „Song“ um Sozialpolitisches, aus einer „Forschung“ er-
geben sich „Resultate“ (nicht: „Ergebnisse“), ein „Experiment“ setzt
sich in der Regel aus einer Reihe von „Versuchen“ zusammen, „Fiasko“
erleiden am meisten künstlerische Naturen und Manager, wenn sie sich
in ihren weit gehenden Plänen als \fersager erweisen, den „Misserfolg“
können auch alle anderen (Sterblichen) ab und zu haben. „Devisen“
oder „Valuta“ beziehen sich vorwiegend auf Erlöse in fremder „Wäh-
rung“, während die eigene Währung ihre Stabilität bewahren muss, über
die die Zentralbank wacht. Mit einem Wort sind die Paare des Typs Mo-
ment-Augenblick in ihrem Gebrauch auseinander gegangen, was nicht
immer ihren Sembestand wesentlich berührt hat.
Für Synonyme ist nicht die Bedeutungsidentität, sondern die Be-
deutungsbeziehung der Ähnlichkeit relevant. „Gerade diese Synonymie
ist eine natürliche Entwicklung einer natürlichen Sprache“ [Stepano-
va, Öernyseva, 1986, 213]. Die Bedeutungsbeziehung der Ähnlichkeit
sieht folgenderweise aus: zwei Lexeme sind im substanziellen und
strukturellen Aufbau aus Bedeutungselementen (Semen) einander
ähnlich, d.h. sie gleichen sich in bestimmten wesentlichen Semen und
unterscheiden sich nur in sekundären Elementen (Semen), die
verschieden beschaffen sein können. Sie können semantisch konkreti-
sierend, regional, stilistisch wertend sein, sie können das Lexem auf
den normativen Gebrauch beziehen und sogar auf eine bestimmte al-
tersmäßige und bildungsgradabhängige Gruppe von Sprachträgem
hinweisen.
Die synonymische Beziehung besteht streng genommen nicht zwi-
schen Wörtern, sondern zwischen den Semen. Man kann z. B. nicht
ohne weiteres Zimmer oder Stube als Synonyme von „Raum“ bezeich-
nen. „Raum“ hat mindestens drei Sememe mit jeweils verschiedenen
Synonymen: „Raum“ kann auf „Zimmer, Kammer, Stube“ bezogen
werden, kann aber zugleich als „Gegend“ und „Umgebung“ gedeutet
werden oder als „Weltall, All, Kosmos“. Das ist insbesondere bei stark
polysemen Xferben zu beachten und diese Erscheinung wird in den Wör-
terbüchern expliziert: erhalten hat — in Entsprechung zum jeweiligen
Semaufbau — „bekommen, bewahren, unterhalten, versorgen“ als Sy-
nonyme. Synonyme können sich, wie schon oben erwähnt, in den se-
kundären semantischen Merkmalen unterscheiden z. B. Angst und Lam-
penfieber. „Lampenfieber“ ist eine starke nervöse Erregung, gewöhnlich
vor öffentlichem Auftreten. „Lampenfieber“ hat also im Unterschied zu
„Angst“ ein spezielles semantisches Merkmal mehr.
Nehmen wir noch ein Beispiel, wo nähere Sinnverwandtschaft vor-
liegt. Im Roman von Thomas Mann „Joseph und seine Brüder“ findet
sich folgende Stelle:
Auch er trug goldene Ohrringe, die durch das Haar drangen, während Tuijs
alter Kopf mit einem breiten Stirnband in schwarz und weißer Emaille bekränzt
war, Blütenblätter darstellend, — ein kunstreich gearbeitetes Schmuckwerk,
dem man ein minder hinfälliges Haupt zum Träger gewünscht hätte. Denn wir
55
hegen eine Eifersucht auf schöne Dinge im Namen der frischen Jugend und
gönnen sie heimlich dem Haupte nicht, das schon mehr ein Schädel ist.
Durch den abwechselnden Gebrauch von „Kopf1, „Haupt“, „Schä-
del“ werden Wortwiederholungen gemieden, weil ihre stilistische Quali-
tät meisterhaft aktiviert wird. „Kopf“ ist stilistisch ungefärbt und stellt
eine normative übliche Begriffsbezeichnung dar. Das sinnverwandte
„Haupt“ ist in der Regel mit etwas Großem, Erhabenem verknüpft: das
Haupt des Löwen', den Lorbeerkranz aufs Haupt setzen. Es entsteht eine
stilistische Kontrastwirkung, wenn das Wort „Haupt“ mit dem bedeu-
tungsmäßig abwertenden Adjektiv „hinfällig“ und dem abwertend ge-
färbten Wort „Schädel“ in Verbindung gesetzt wird. In diesem Beispiel
liegt der Wortunterschied vorwiegend nicht auf bedeutungsmäßiger, son-
dern hauptsächlich auf stilistischer Ebene.
Die Auswahl unter sinnverwandten Wörtern hat also eine bedeu-
tungsmäßige Seite {lieben — verehren — hochschätzen) und eine
stilistische Seite {Antlitz — gewählt, Fresse — grob). Die bedeu-
tungsmäßige und stilistische Qualität eines Wortes bilden in vielen Fäl-
len eine untrennbare Einheit. Das sinnverwandte Wort „Gram“ für
„Leid“ spiegelt in erster Linie einen Unterschied in der Bedeutung wi-
der: „Gram“ ist ein besonders tiefes, verzehrendes Leid. Zugleich hat
das Wort „Gram“ eine gewähltere stilistische Färbung.
Hinweise auf die Stilqualität beim isoliert betrachteten Wort sind im-
mer nur als Möglichkeiten aufzufassen. Eine genaue Bestimmung der
Stilqualität eines Wortes ist erst möglich, wenn es in einen Sinnzusam-
menhang eingebaut wird: erst im Kontext entfaltet das Wort die po-
tenzielle stilistische Qualität. Der Kontext kann zum einen die stilisti-
schen Differenzen relativieren und zum anderen Synonyme herausbrin-
gen, die außerhalb des Kontextes nur eine mehr oder weniger entfernte
semantische Gemeinsamkeit haben. „Antlitz“ (gewählt) und „Fresse“
(grob) zeigen im Sprachgebrauch eine gewisse stilistische Variationsbrei-
te. „Die Gewähltheit des Wortes „Antlitz“ wird in der stilistisch un-
gleichartigen Fügung Ich haue der eine ins Antlitz relativiert; die Grob-
heit des Wortes „Fresse“ wird etwas abgedämpft in familiären Fügungen
wie: Er hat eine hübsche Fresse-, Ach, du meine Fresse\“ [Faulseit, Kühn,
1968, 23].
Allgemein gültige, gemeinsprachliche Synonyme beruhen auf real
existierender, außersprachlicher Grundlage. Sie sind begrifflich oder sti-
listisch abgeschattet. Anders steht es mit den kontextualen Synonymen,
deren Synonymie erst im Großzusammenhang entsteht. Es han-
delt sich hier um Wörter von verschiedener logisch gegenständlicher Be-
deutung, um Wörter, die isoliert betrachtet, nicht einmal thematisch
verbunden sein müssen. Sie beziehen sich aber im konkreten Großzu-
sammenhang auf ein und denselben Gegenstand der Rede und sind ge-
genseitig austauschbar. Besonders verbreitet sind bildhafte kontextuale
Synonyme auf metaphorischer oder metonymischer Grundlage. In
H. Heines „Zero“ lesen wir:
56
Alle Liebesgötter jauchzen
Mir im Herzen, und Fanfare
Blasen sie und rufen: „Heil!
Heil der Königin Pomare\“
Jene nicht von Otahaiti —
Missionarisiert ist jene —
Die ich meine, die ist wild,
Eine ungezähmte Schöne.
Majestät in jedem Schritte,
Jede Beugung Huld und Gnade,
Eine Fürstin jeder Zoll
Von der Hüfte bis zur Wade...
Sie tanzt mich rasend — ich werde toll —
Sprich, Weib, was ich dir schenken soll?
Alle fett gedruckten Bezeichnungen beziehen sich auf ein Denotat,
die berühmte Tänzerin Pomare aus Paris. Durch die richtige Wahl kon-
textualer Synonyme kann die Einstellung des Sprechers zum Gegen-
stand der Rede zum Ausdruck gebracht werden.
Die gemeinsamen semantischen Merkmale erlauben die Zusam-
menstellung der Synonyme zu Synonymreihen. „Die Bestandteile ei-
ner solchen Reihe sind durch weit gehende aber nicht vollständige
Übereinstimmung der Bedeutungsmerkmale gekennzeichnet und ha-
ben einen gleichen außersprachlichen Bezugspunkt“ [Fleischer, Mi-
chel, 1977, 74].
Als Dominante der Reihe lässt sich das Synonym mit den wenigs-
ten speziellen Merkmalen herausheben. So wäre in den folgenden
Synonymreihen jeweils das erste Wort als Dominante zu betrachten:
dick — korpulent, beleibt, stark, vollschlank, füllig, mollig, rundlich;
schlagen — hauen, puffen, boxen, stoßen, prügeln, peitschen, ohrfei-
gen, pochen, klopfen, hämmern, dreschen;
schnell — flink, geschwind, eilig, behände, hurtig, schleunig, hastig,
rasend;
langsam — schwerfällig, träge, gemächlich, bedächtig;
leuchten — glänzen, strahlen, funkeln, blitzen, blenden, scheinen,
glühen, schimmern, glimmen, dämmern;
froh — freudig, fröhlich, lustig, heiter, vergnügt, übermütig, ausgelas-
sen;
traurig — trübe, betrübt, trübsinnig, trübselig, griesgrämig, freudlos,
gedrückt, niedergeschlagen, düster, mürrisch, schwermütig, miesmutig,
verdrießlich;
klug — gescheit, verständig, vernünftig, weise, fähig, gewandt, ge-
witzt;
dumm — töricht, beschränkt, einfältig, gehemmt, stur.
Die stilistische Funktionen der Synonyme ergeben sich daraus, dass
eine Polarität entsteht zwischen dem gleichen Denotatsbezug ei-
57
nerseits und den Unterschieden in der Hervorhebung semantischer
Merkmale des Denotats sowie in einschränkenden Markierungen ande-
rerseits.
Die Synonyme haben etwas Gemeinsames und etwas, was sie unter-
scheidet. Der gemeinsame Denotatsbezug ermöglicht das sprachästheti-
sche Bedürfnis nach Ausdrucksvariation zu befriedigen. Die ständige
Wiederholung des gleichen Ausdrucks ermüdet und erweckt den An-
schein, als stünde dem Verfasser des Textes der ganze Reichtum der
sprachlichen Mittel nicht zur Verfügung.
Eine typische stilistische Funktion der Synonyme ist die Verwendung
als verhüllender Ausdruck, als Euphemismus. An Stelle von „dick“ sagt
man „vollschlank“ oder „mollig“.
Synonyme werden oft zum Zweck der Ausdrucksverstärkung wieder-
holt. Es entsteht eine expressive, affektisch betonte Äußerung: Natür-
lich, selbstverständlich hast du recht’, Wundervoll ist heute das Wetter, ein-
fach prächtig.
Die Synonyme ermöglichen die Variierung der Gesichtspunkte, unter
denen ein Gegenstand, eine Erscheinung vom Sprecher oder Schreiber
betrachtet wird. Es können verschiedene Seiten des Gegenstandes ver-
anschaulicht werden, der Ausdruck gewinnt an Lebendigkeit und Präzi-
sion, z. B. Er weinte tränenlos, trostlos, lautlos oder: Das war ein Parade-
marsch, ein vorbildlicher, makelloser Parademarsch, der Marsch von
Preußens Ruhm und Ehre, Preußens Gloria (Beispiele aus den Werken
von W. Borchert).
Die Synonyme können nebeneinander gesetzt werden, um den Un-
terschied zwischen ihnen besonders deutlich auszuleuchten und eine Art
Kontrastwirkung zu erreichen, z. B. Nimm dir einmal Zeit, um nicht nur
zu gucken, sondern auch wirklich zu schauen’, Das ist doch kein Leben,
sondern eine schäbige Existenz.
Die Reihung textgebundener Synonyme erscheint auch als glossie-
rende Synonymie. In diesem Fall dient die synonymische Variation der
Erläuterung eines Ausdrucks, z. B.: Der endgültige gesamteuropäische
Zusammenschluss setzt die Harmonisierung, d. h. Angleichung der beste-
henden rechtlichen Normen voraus.
Die weit verzweigte Synonymie ist ein Kennzeichen dafür, in wel-
chem Grade die nationale Sprache mit all ihren Stilen, Substilen, Syste-
men und Subsystemen entwickelt ist. Eine Einzelsprache ist kein homo-
genes, sondern ein äußerst heterogenes Gebilde. Es gibt eine Viel-
zahl von „Sprachen in der Sprache“, mit denen sich die Sprecher einer
Sprache auf ihre „Welt“ beziehen, die ganz unterschiedlich gesehen und
interpretiert werden kann.
Um die Begriffe L. Weisgerbers zu verwenden: Es gibt nicht die eine
sprachliche Weltansicht, das eine Weltbild einer Sprache, sondern—in-
nerhalb einer Sprache und Sprachgemeinschaft — verschiedene Weltbil-
der. Der Sprachträger sieht die Realität innerhalb seiner Vorstellung von
der Welt.
58
§ 16. Erstarrte phraseologische Wendungen als stilistische
Verwertung der Synonymie
1.1.Cemyseva definiert erstarrte phraseologische Wendungen als „feste
Wortkomplexe syntaktischer Strukturtypen mit singulärer Verknüpfung der
Komponenten, deren Bedeutung durch eine vollständige oder teilweise se-
mantische Transformation des Konstituentenbestandes entsteht“ [Stepano-
va, Cemyseva, 1986, 178].
Als sprachliche Benennungen dienen sie nicht zur rationellen Be-
nennung des Referenten (Begriffs), sondern zur expressiv wertenden,
konnotativen. In dieser Benennung kommt die Stellungnahme des be-
nennenden Subjekts zum Ausdruck. Die Phraseologismen zeichnen sich
durch einen bestimmten Grad der subjektiven Bedeutsamkeit der
objektiven Erscheinungen aus. Die Phraseologismen dienen vor allem
zur Benennung von subjektiv bedeutsamen physischen, psychischen und
sozialen Situationen und Zuständen des Menschen. Die zahlenmäßig
bedeutendsten phraseologischen Gruppen sind „Aspekte der menschli-
chen Psyche sowie der zwischenmenschlichen Beziehungen: Lob und
Tadel, Glück und Unglück, Liebe und Hass, Erfolg und Misserfolg,
Niederlage, Bloßstellung, Tod, Krankheit, Zwietracht, Dummheit, Zer-
störung, Schwierigkeiten, Betrug, Trübsinn, Zorn, Hilfe u.a.“ [Stepa-
nova, Cemyseva, 1986, 179]. Die phraseologischen Felder und Grup-
pen veräußerlichen kognitive Konzepte, die für mehrere, wenn nicht zu
sagen für alle Kulturen typisch sind. Aber die Benennungen selbst, sowie
ihre sprachliche Beschaffenheit können kulturspezifisch gradu-
iert sein. Wie eng sich dabei europäische Kulturen, und zwar die deut-
sche und russische berühren, zeigt die Tabelle aus der Doktormonogra-
fie von A. D. Reichstein [s. PanxiirreiiH, 1981, 97]:
Thematische Gruppe Gewichtung in Russisch Gewichtung in Deutsch
Antike 0,3% 0,5%
Erde, Elemente, Natur 4,5% 4,2%
Familie 1,2% 0,6%
Farben 1% 0,3%
Fischerei und Jagd 0,6% 0,3%
Gesundheit, Krankheit, Tod 1,6% 1,7%
Haus und Wbhneinrichtung 3,9% 2,2%
Kleidung 2,0% 1,7%
Der menschliche Körper 14,7% 22,8%
59
OKOHHÜHUe
Thematische Gruppe Gewichtung in Russisch Gewichtung in Deutsch
Landwirtschaft 0,8% 0,4%
Nahrung und Gericht 2,7% 2,3%
Orts- und Ländernamen 0,35% 0,4%
Personen und Völkemamen 0,8% 0,8%
Pflanzen 1,0% 1,5%
Rechtsprechung und Gerichtwesen 0,8% 0,4%
Reise und Verkehr 2,0% 1,8%
Religion 2,9% 5,8%
Ritter, Soldaten, Krieg 2,1% 1,5%
Schifffahrt 0,8% 0,2%
Schule und Wissenschaft 1,9% 0,7%
Tiere 6,2% 5,0%
Wfetter 1,1% 0,6%
Wirtschaft und Handel 2,4% 2,2%
Zahlen und Mathematik 1,2% 1,7%
Zeit 1,5% 2,0%
Allgemeine Ausdrücke 37,2% 34,3%
Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass die Unterschiede die mate-
riellen Existenzbedingungen sowie die Geschichte eines Volkes betref-
fen. Im Russischen sind auch mehr Phraseologismen verbreitet, die
z. B. das Substantiv dytua als Komponente einschließen. Die phraseo-
logischen Systeme der beiden Sprachen beruhen im Wesentlichen auf
semantisch verwandten Benennungsbereichen und sind folg-
lich vom Standpunkt ihres Ursprungs und der bildlichen Basis in ge-
wissem Maße identisch.
Das eindeutige Übergewicht der negativ wertenden Phraseologismen
scheint eine Universalie zu sein. Die subjektiv wertende phraseologische
Nomination ist eine indirekte Nomination: das Objekt der Aussage
wird durch die Merkmale der anderen Referenten charakterisiert. Die
Begriffskonzepte werden auf ganze Situation bezogen, daraus resultiert
die bildliche Motiviertheit der Bedeutung.
60
Phraseologische Wendungen können, eben weil sie mentale Konzepte
veräußerlichen, untereinander synonym sein: das Gras wachsen hören —
die Mücken an der Wand husten hören — die Flöte niesen hören. Sie sind
aber fast immer mit einem Einzelwort synonym, weil die Einzelbenen-
nung in den meisten Fällen verallgemeinernd das mentale Konzept
selbst sprachlich bezeichnet. Die phraseologischen Wendungen sind in
ihrer Bildhaftigkeit mehr oder weniger expressiv, daher unterliegen sie in
ihrem Gebrauch bestimmten Verwendungsbeschränkungen. In sachli-
chen Texten sind sie z. B. im Allgemeinen fehl am Platze. Wendungen
dieser Art begegnen wir vor allem in bestimmten Genres der Belletristik,
aber nicht in der Lyrik. Phraseologische Wendungen sind in allen Wer-
ken der schönen Literatur neben Lexemen ein unentbehrliches
Baumaterial der Texte. Aber ihre Frequenz ist verschieden, was nicht
zuletzt auf den Individualstil des Autors sowie den Gedankengehalt des
Werkes und auktoriale Absicht zurückgefiihrt werden kann.
Nicht alle Subklassen der Phraseologismen sind nach ihrer textbil-
denden Bedeutsamkeit gleich. Unter den verbreitetsten sind phraseolo-
gische Einheiten zu nennen und zwar die verbalen phraseologischen Ein-
heiten des Typs „Grillen fangen“ und die Paarformeln oder Zwillings-
formeln. Sie werden in der Autoren- und Figurensprache gebraucht. Ne-
ben zahlreichen anderen sprachlichen Mitteln werden sie zum Charak-
teristikum sowohl der handelnden Personen als auch zur Schilderung
der wichtigsten, das Leitmotiv der Werke bestimmenden Handlungen
und Situationen verwendet. So werden z. B. im Roman W. Steinbergs
„Pferdewechsel“ die immer wieder kehrenden Phraseologismen goldene
Hände und zwei Unke Hände haben jeweils zur positiven und negativen
Charakteristik der handelnden Personen gebraucht:
Der einzige Schatten, ein lichter Schatten nur, aber doch ein Schatten in
ihrem Leben, war das Wesen des Sohnes Thomas, ganz unterschiedlich von
dem ihres Mannes; der hatte keine goldenen Hände, der hatte zwei linke Hän-
de, wie Peter Legion erst mit freundlichem Spott, später mit ärgerlicher Unge-
duld feststellte.
(zit. nach: Stepanova, CernySeva, 1986, 220)
Phraseologische Wendungen können, gerade weil sie bei der Wahr-
nehmung Bilder entstehen lassen und einprägsamer wirken, als einfache
Lexeme grundlegende Momente der Fabelabwicklung markieren, wie
z. B. in der Kurzgeschichte von H. Böll „Nicht nur zur Weihnachtszeit“.
Die Einleitung der Geschichte lautet: „In unserer Verwandtschaft ma-
chen sich Verfallserscheinungen bemerkbar“. Schon früh ging der Vetter
des Ich-Erzählers „auf Bahnen“, die dem Onkel Kummer bereiteten.
Der Onkel warnte frühzeitig davor, dass der Vetter „Unfug treibt“, aber
trotzdem „sind die Dinge in einer Wfeise ins Kraut geschossen“, dass alle
Verwandten ratlos dastanden. Der andere Vetter des Erzählers, „ein
Mensch für den ich jederzeit meine Hand ins Feuer gelegt hätte“, nä-
herte sich der kommunistischen Partei, was in den Augen der Xferwandt-
61
schäft auch ein Merkmal des Verfalls war. Einzig die Tante Milla „erfreut
sich bester Gesundheit“, ist „wohl und heiter“. Ihre „Frische und Mun-
terheit“ beginnen die Verwandten langsam aufzuregen, nachdem ihnen
ihr Wbhleigehen lange Zeit so sehr „am Herzen lag“. Am 2. Februar, um
Mariä Lichtmess, zu der Zeit, wo man in Deutschland die Christbäume
„auf den Kehricht wirft“, geschah etwas Schreckliches, da stürzte der
Christbaum zusammen mit den Zweigen, für die die Tante eine beson-
dere Vörliebe hatte.
Der Konstituentenbestand der phraseologischen Wendungen kann
okkasionelle Modifikationen aufweisen. Die am meisten verbreitete Mo-
difikation ergibt sich aus der Austauschbarkeit von lexikalischen Konsti-
tuenten. Die modifizierten Phraseologismen erhalten dadurch eine etwas
andere bildliche Motiviertheit und stehen zur Basiseinheit im Verhältnis
der Synonymie. Textbezogene austauschbare Konstituenten der Phra-
seologismen bilden ein charakteristisches Merkmal der Inhaltsdarbie-
tung in solchen Genres der Presse wie Feuilleton, Glosse, Skizze, Pam-
phlet, Kommentar u.Ä. Austauschbare Komponenten der Phraseologis-
men können z. B. in einem Feuilleton als tragende Stütze des Mei-
nungsbildes des Autors auftreten und somit zum inhaltlichen Faden des
Textganzen werden. In diesem Fall übernehmen sie eine textprägende
stilistische Funktion. Im Feuilleton aus „Süddeutsche Zeitung“ (2003,
Ne 49) unter dem Titel „Die britische Friedensbewegung marschiert,
aber wohin?“ ist es gerade der Fall: Tony Blair marschiert im Gegensatz
zu seinem eigenen Volk „im Takt einer amerikanischen Trommel“ und
singt die Lieder der dort regierenden Kriegstreiber. „Offenbar werden
gleichzeitig mehrere Lieder gespielt“ (Modifikation zu: j-s Lied singen)
und dazu kann man eigentlich nicht marschieren (Modifikation zu: im
Takt zu j-s Trommel marschieren).
Im Zeitungskommentar zu den Geschehnissen in Dänemark kann
man in derselben Zeitung lesen, dass der dänische Kulturminister „ins sel-
be Horn wie der Premierminister stieß, als er den Kulturkampf ausrief, von
dessen Ausgang Dänemarks Zukunft abhinge“. Nach einer kurzen Pause in
seinen Aktivitäten „gießt er wieder Wässer auf die Mühlen der rechtspo-
pulistischen Dansk Folkeparti, deren Chefideologen seit langem eine Kultur-
revolution von rechts predigten“. Ein Kreuzzügler wie Blair will der däni-
sche Premierminister werden. Ökonomisch hat Dänemark aus der Unter-
stützung der Position von Blair in der Irakfrage nicht viel zu gewinnen,
„die Mitgliedschaft in der,Koalition der Willigen“1 muss „ihre Rendite erst
noch abwerfen“. Der Premierminister arbeitet an der Entsozialdemokrati-
sierung Dänemarks: „das Gestrüpp der subventionsgewährenden Experten-
ausschüsse hat sich gelichtet“. Weniger weit reicht der Einfluss des Pre-
mierministers „bei den anderen beiden Kanten des Bermuda-Dreiecks“'.
der Zeitung „,Politiken' und dem Gyldendal-Verlag“. Aus beiden hier an-
geführten Beispielen kommt deutlich heraus, wie die phraseologischen
Wendungen die Fabel Zusammenhalten und die Aufmerksamkeit des Le-
sers auf die wichtigsten inhaltlichen Momente lenken.
62
§ 17. Stilistische Werte der Zwillingsformeln
Die Zwillingsformeln sind aus stilistischer Sicht nicht weniger ergie-
big, als erstarrte phraseologische Wendungen. Zwillingsformeln sind
Wortpaare, die einen Begriff tautologisch ausdrücken {blass und bleich,
Saus und Braus). Die nahe stehenden Wörter stammen zumeist aus be-
grifflich verwandten Feldern, z. B. kreuz und quer, bei Nacht und Nebel.
Eine Zwillingsformel kann auch aus antonymischen Komponenten be-
stehen, z. B. auf und ab, hin und wieder, bergauf-bergab, abwärts-auf-
wärts usw.
Die Komponenten der Zwillingsformeln sind miteinander durch Al-
literation, Assonanz oder durch Endreim verbunden. Alliteration ist eine
alte nationale Eigentümlichkeit der germanischen Dichtung [vgl. Rie-
sel, 1963, 346] und bedeutet den Gleichklang der anlautenden Konso-
nanten, z. B. mit Kind und Kegel, klipp und klar. Unter Assonanz, die im
Deutschen seltener gebraucht wird, versteht man den Gleichklang der
inlautenden Vokale, gewöhnlich bei Verschiedenheit der Konsonanten,
z. B. von echtem Schrott und Kom, in Acht und Bann usw. Der Endreim
entsteht bei der Wiederholung des Wortausganges, z. B. in Saus und
Braus. Eine besondere Wirkung der Zwillingsformeln wird gerade da-
durch erreicht, dass sie auf Lautinstrumentierung beruhen, die sug-
gestiv wirkt. Alliteration, Assonanz und Endreim werden als akusti-
sche Signale empfunden und prägen sich wie gelungene Werbeslogans
oder Schlagerzeilen ein. Besonders alliterierte Zwillingsformeln dienen
als „lautliches Kursiv“ [s. Riesel, 1963, 347], indem sie inhalt-
lich oder gefühlsmäßig eine wichtige Stelle herausstreichen.
I. Zwillingsformeln in Kunst und Sachprosa. Die Zwillingsformeln
sind die ältesten deutschen Modelle der Phraseologisierung, sie sind
auch der russischen Sprache nicht fremd, weil sie, erstens, auf Gemein-
samkeiten in begrifflich-mentalen Konzepten der beiden Kulturen be-
ruhen und, zweitens, Suggestivität der ursprünglichen Rede und Rede-
weisen bewirken. Nicht zufällig werden die gleichen Verfahren der sug-
gestiven (einflößenden) Manipulierung oder Beeinflussung in heutigen
Werbetechniken gebraucht. Und wenn man bedenkt, dass das wort-
künstlerische Schaffen, die Dichtung, nicht im geschriebenen, sondern
im gesungenen Wort ihren Anfang hat, kann man sich leicht massenwei-
sen Gebrauch der Zwillingsformeln in altertümlichen Gattungen der
Dichtung, z. B. in der Ballade, vorstellen sowie in dichterischen Wer-
ken, die im Einklang mit der Konzeption des Autors „altertümelnd“ wir-
ken sollen. In der Ballade übernehmen die Zwillingsformeln auch noch
eine Funktion, und zwar die der Schaffung der inneren Spannung, die im
dramatischen Konflikt gipfelt. In der Ballade „Herr Olaf* lesen wir:
Herr Olaf reitet spät und weit; Ein Hemd von Seide, so weiß und fein; Soll
Seuch und Krankheit folgen dir; Wie ist dein Farbe, blaß und bleich; Hör an, mein
Sohn, so lieb und traut; Zu Proben da mein Pferd und Hund.
63
Aus kultursprachlicher Sicht wäre auch die Übersetzung der Ballade
und der darin vorkommenden Zwillingsformeln ins Russische interes-
sant. Der Übersetzer der Ballade L. Ginsburg hat den Stellenwert der
Zwillingsformeln für den kompositorischen Aufbau sowie für den ange-
spannten inneren Rhythmus des dramatischen Werkes zu bewahren ver-
sucht, indem er pragmatisch und kompositorisch äquivalente Zwillings-
formeln im Russischen findet, aber wegen sprachkultureller Unterschie-
de, die auch im Werdegang dieser Gattung in der russischen und deut-
schen Tradition ihren Niederschlag finden, gelingt es ihm nicht immer.
Aber da die Zwillingsformeln in diesem Fall gattungsprägende Funktion
übernehmen, d. h. a priori die Gesamttextexpressivität steigern, strebt
der Übersetzer danach, die expressive Farbgebung und Herausstrei-
chung um jeden Preis zu erhalten. Wenn die Zwillingsformel keiner
strukturell äquivalenten Übersetzung unterliegt, führt er ein Zusatzele-
ment ein, das eine Komponente der Zwillingsformel ersetzt und da-
durch die Gesamtexpressivität erhalten bleibt:
— «Pbmapb Onaip edem nosdno no cmpane ceoeü» — im Original: „spät und
weif'",
— «H uiejiKoeyio pyGauucy Hydmü 6eM3Ht>i» — im Original: „weiß und fein“',
— «3a moßoü nycmb xodnm cjiedoM HeMoyb u 6eda» — im Original: „Soll
Seuch und Krankheit folgen dir“;
— «Vmo c mo6oK>? Onwezo mu Mepmeeya öjiedneü?» — im Original: „Hör
an, mein Sohn, sag an mir gleich, wie ist dein Farbe, blaß und bleich'.“
In der Ballade über „Herrn Olaf4 treten die Zwillingsformeln unter
anderem auch als Techniken auf, den Zweizeiler je nach der Anzahl der
Silben auszugleichen und ausgewogen zu machen, was der Ge-
samtballade als einem gereimten Werk eine besondere rhythmi-
sche Gliederung verleiht. Eben der Ausgewogenheit der einzel-
nen Zeilen halber stehen die Zwillingsformeln am Ende der Zeile und
schließen sie intonatorisch ab:
„Herr Olaf reitet spät und weit,
Zu bieten auf seine Hochzeitleut“.
„Ein Hemd von Seide, so weiß und fein,
Meine Mutter bleicht’s mit Mondenschein“.
Bekanntlich hat H. Heine in seiner Dichtung nicht nur ältere, im Usus
schon vorhandene Zwillingsformeln gebraucht, sondern auch ganz neue
Paare modelliert: „geherzt und geküsst“, „schön und blühend“, „trompe-
ten und pauken“, „fiedeln und blasen“, „schäumen und rauschen“,
„Flüstern und Pfeifen“, „Säufzen und Sausen“, „Wind und Wellen“,
„Stern und Fackel (seiner Zeit)“, „(heiteres) Wissen, (holdes) Können“
usw. Mit vollem Recht kann behauptet werden, dass die Zwillingsformeln
eine der beliebtesten textualen Techniken im gesamten dichterischen
Werk von H. Heine sind. Ganze Textpassagen werden dank den Zwillings-
formeln strukturell-kompositorisch zusammengehalten und aus stilisti-
scher Sicht expressiv geprägt. In „Hebräischen Melodien“ lesen wir:
64
Auch die Kunst der Poesie,
Heitres Wissen, holdes Können,
Welches wir in Deutschland heißen
Tat sich auf dem Sinn des Knaben.
Ja, er ward ein großer Dichter,
Stern und Fackel seiner Zeit,
Seines Volkes Licht und Leuchte,
Eine wunderbare, große
Feuersäule des Gesanges.
Das bedeutendste Poem von H. Heine „Deutschland. Ein Winter-
märchen“ ist ebenfalls von Zwillingsformeln, die wie oben schon er-
wähnt eine durchgehende Texttechnik bei H. Heine ist, durchdrungen:
Ich habe sie immer so liebgehabt,
Die lieben, guten Westfalen,
Ein Volk, so fest, so sicher, so treu
Ganz ohne Gleißen und Prahlen.
„Dummheit und Bosheit buhlten hier
Gleich Hunden auf freier Gasse;
Die Enkelbrut erkennt man noch heut
An ihrem Glaubenshasse.“
Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau
die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz.
Willst du Geld und Ehre haben,
mußt du dich gehörig ducken.
In Heines „Wintermärchen“ kommt auch eine weitere stilistische
Funktion der Zwillingsformeln zur Geltung: sie (Zwillingsformeln) be-
teiligen sich aktiv an der sprachlichen Ausformung des Bissigen, des Sati-
rischen, des innerlich Widersprüchlichen. Eben darin bestand das dichte-
rische Pathos sowie die dichterische Konzeption des Autors.
Die Zwillingsformeln haben mit dem Weggang der „großen“ deut-
schen Dichtung nicht abgelebt. Aktiv setzen sie sich heute in ganz ge-
genteiligen, nicht dichterischen Gattungen der Sachprosa durch,
z. B. bei Wirtschaft und Finanzen:“Hoch und Tief“ (bei der Beschrei-
bung der Währungsdynamik), „Steuern und Abgaben“, „Angebot und
Nachfrage“, „Transferzahlungen und Finanzhilfen“, „Zuständigkeiten
und Befugnisse“, „Aufgaben und Befugnisse“, „Aufwand und Ergeb-
nis“, „Aufwand und Kosten“, „Hausse und Baisse“ (Vorgänge auf der
Börse), „Aufwand und Leistung“, „Aufwand und Format“ (einer Xbran-
staltung), „Kontinuität und Konsistenz“, „Reform und Erweite-
rung“(der EU), „Leistung und Gegenleistung“ usw. Bestimmt wirken
diese Paarformeln nicht expressiv im Sinne der gefühlsmäßigen Beto-
nung eines Redefragments, aber sie ermöglichen es, eine gedankliche
logische Pointierung zu schaffen, und in diesem Sinne dienen sie dem
Ziel der logischen Hervorhebung, d. h. der logischen Expressivität. Viele
3
BoraTbipeiia
65
solcher Paarformeln beruhen auf antonymischem Verhältnis. Darin
drückt sich der universale sprachliche Mechanismus aus, nicht nur das
Gleiche, sondern auch das Gegenteilige zu erfassen. Die mentalen
Konzepte schließen als Basis beim Aufbau und Aufbewahren der logisch
sprachlichen Paradigmen nicht nur die Gleichheit oder Ähnlichkeit der
realen Sachverhalte ein, sondern auch ihre Gegenteiligkeit.
II. Zwillingsformeln in der Alltagsrede. Nachdem wir die Gewichtig-
keit der Zwillingsformeln in Kunst- und Sachprosa mehr oder weniger
überzeugend nachgewiesen haben, entsteht rechtmäßig die Frage: Und
wie ist es mit den Zwillingsformeln z. B. in der Alltagsrede bestellt? Ihr
Gebrauch in der Alltagsrede hängt eindeutig mit dem Wissenshorizont
des Sprechenden zusammen, mit seinem sprachlichen Rüstzeug, mit
dem, inwieweit er mit diesem Teil des Gesamtwortschatzes vertraut ist.
Dem literarisch geschulten Sprachträger, der sich außerdem noch ziem-
lich regelmäßig in die Lektüre der populären Magazine, Fachzeitschrif-
ten und Zeitungen vertieft, wird wohl dieser Teil des Wbrtschatzes nicht
entgangen sein. Er kann dann die Zwillingsformeln in seinen Alltagsusus
einführen. Das bezieht sich besonders auf dichterische Paarformeln,
aber auch nicht nur. Der sprachbewusste Redeproduzent bleibt sich des
hohen künstlerischen Ursprungs der Zwillingsformeln stets bewusst und
gebraucht sie häufig mit Hinweis auf die Quelle, die aber nicht angege-
ben wird. Sie werden oft zitatenartig ausgestaltet, als Allusion, Andeu-
tung auf das Kulturgut der Nation, das sich der Sprecher angeeignet hat
im Fortgang seiner sprachlichen und literarischen Entwicklung. Eben
aus diesem Grund werden die künstlerischen Zwillingsformeln in der
Alltagsrede oft mit „sozusagen“ versehen, was sie als verschönende
„Einsprengsel“ in ganz übliche Redeweisen qualifizieren lässt: Ich hab’
heute Nacht arbeiten müssen, mit Ausdauer und Beharrlichkeit sozusagen
oder: Du siehst heute sozusagen schön und blühend aus. Der vollkommen
bewusste Gebrauch der Zwillingsformeln erlaubt es dem Sprachträger
sie inhaltlich und strukturell abzuwandeln, so dass oft ein wortspieleri-
scher Sinn entsteht: Ich habe die Prüfung mit Müh, aber ohne Not bestan-
den oder: Sein Unterfangen setzte er zwar mit Wissen, aber ohne Können
durch.
Auch erstarrte phraseologische Wendungen unterliegen verschieden-
artigen Abwandlungen unter dem Druck der textualen Faktoren und Be-
dingungen. Die abgewandelten Phraseologismen sind ganz besonders
dazu angetan, einen Text aufzulockern, die persönliche Note des Autors
und seine persönliche Sicht zu erschließen, die Fixiertheit des Textes auf
eine fachliche oder politische Darstellung der Sachverhalte dem Leser
näher zu bringen und dadurch eine Art Expressivität auch da zu schaf-
fen, wo diese Expressivität zu keinen systemspezifischen Zügen der
Textausprägung gehört. Die haüfigste Modifikation des Phraseologismus
ist dabei Heraustrennung eines Lexems aus dem Gesamtphraseologis-
mus und seine Verselbstständigung im weiteren Kontext. Sehr oft wer-
den die Phraseologismen selbst bei solch einer Herauslösung zu k o m-
66
positorischen Verfahren. Sie dienen z.B. als Anknüpfung der in-
haltlichen kompositorischen Fabel, wie es in den nachfolgenden Text-
fragmenten aus der Fachzeitung „Finanz und Wirtschaft“ der Fall ist:
Wo Rauch ist, ist auch Feuer, lautet eine Börsenweisheit zur Frage, ob an
einem Gerücht etwas Wahres dran ist oder nicht. Sehr viel Rauch gibt es derzeit
am deutschen Aktienmarkt im Segment Banken und Versicherungen.
Das Vfersprechen, zumindest die Firmenkultur nach der Fusion unabänder-
lich zu lassen, war als Köder gedacht, den die Sträubenden schlucken sollten...
Der Köder aber scheint vergeblich ausgeworfen zu sein.
Die Steuersenkungen erwiesen sich aber als vollkommen unausreichend,
um den Mittelstand auf den Leim zu locken. Aus der Sicht der mittelständischen
Unternehmer soll eben der Leim anders beschaffen sein. Das ganze unterneh-
merische Umfeld sollte anders als heute strukturiert sein.
Der Werkstoff Satraplatin gegen Prostatakrebs soll im dritten Quartal dieses
Jahres in die Phase drei der klinischen Studien eintreten. Der Vorstand rechnet
schon 2004/2005 mit signifikanten Einnahmen. Aber die Rechnung muss nicht
unbedingt aufgehen, denn die Sparte „Pharma“ stellt für das ganze Unterneh-
men einen Klotz am Bein dar... Es wird aber immer intensiver daran gedacht,
diesen Klotz zu veräußern.
Aus den angeführten Beispielen eigibt sich auch eine weitere Funkti-
on der phraseologischen Abwandlung. Die Einzelteile der einst einheit-
lichen Phraseologismen können satz- und absatzverflechtende Funktion
übernehmen, d. h. Sätze bzw. Absätze inhaltlich und kompositorisch zu-
sammenfügen.
Die Verselbstständigung eines Bestandteils des Phraseologismus ist
nicht das einzige Modifikationsverfahren im phraseologischen Wortgut.
Als ein weiteres Verfahren wäre die Substitution der Elemente zu erwäh-
nen. Zum Beispiel kann die Komponente mit phraseologisch gebunde-
ner Bedeutung durch ihr lexikalisches Analog mit primärer,
nicht übertragener Bedeutung ersetzt werden. Sehr oft dient solch eine
Substitution als stilistisches Verfahren zur Schaffung einer ironisch-sati-
rischen Färbung. So wird aus dagegen ist kein Kraut gewachsen — „dage-
gen ist kein Mittel gewachsen“; aus die Spreu vom Weizen sondern ergibt
sich „die Spreu vom Wichtigen sondern (trennen)“; aus die Perlen vor die
Säue werfen wird — „seine Gedanken vor die Säue werfen“. Ziemlich oft
kommt es zu phraseologischen Substitutionen durch territorial
markierte Elemente, z. B. „Flappe, Sabbel, Gusche halten“, oder:
„doof (dumm) aus den Plünnen (Kleidern, Wäsche) gucken“; durch
fremdsprachige Elemente, z.B. „die krummen Wege (Touren)
lieben, „Unsinn (Nonsens) reden“, „sein Sparschwein (sein Portmonee)
schlachten“, d.h. „seine Ersparnisse angreifen“.
Die Substitutionselemente können eine stilistische Opposi-
tion bilden, wobei die stilistischen Färbungen von „literarisch-um-
gangssprachlich“ bis hin zu „grob“ und „vulgär“ abgestuft werden kön-
nen, z.B. „Unsinn (Kohl, Blech, Stuss) reden“, „Schwein (Mordsdusel)
haben“, „seine schmutzige (dreckige, versaute) Wäsche in der Öffent-
67
lichkeit waschen“, „sich den Mund {das Maul, den Schnabel) verbren-
nen“. Die Modifikation der Phraseologismen kann den Sinn, die Se-
mantik abschatten, z. B. kann aus einem Körnchen Wahrheit — „ein gan-
zes Pfund Wahrheit“ werden, alles ist in bester Butter wandelt sich zu „al-
les ist in Margarine“ ab, aber „in Butter“ ist doch viel besser als „in Mar-
garine“, wo alles nicht mehr ganz intakt, aber immer noch erträglich,
passabel ist. Bekannt ist die vom Maler Max Liebermann geprägte phra-
seologische Wendung „von der Wand in den Mund leben“. In den
schweren Jahren der „großen Depression“ nach dem Ersten Weltkrieg
war der Künstler gezwungen seine Bilder gegen Brot und Kartoffeln zu
tauschen, so dass er vollkommen Recht hatte, als er nach dem schon
existierenden phraseologischen Modell ein neues schuf durch die Sub-
stitution des Lexems „die Hand“ {von der Hand in den Mund leben).
Je gebräuchlicher ein Phraseologismus ist und je höher seine Wieder-
holbarkeit im Gebrauch ist, desto häufiger gestaltet sich seine Modifika-
tion, die ihrerseits eine textuale Auflockerung schafft und die Redewei-
sen auf den Sprecher/Schreiber bezieht, der in seiner individuellen Re-
demanier erschlossen wird. Mach’s gut\ ist weniger individuell geprägt,
als „Mach’s immer besser“. „Trübung macht den Kleister“ ist eine
klangliche Abwandlung aus Übung macht den Meister, aber die gegen-
ständliche Bedeutung der beiden Phraseologismen weist nicht einmal
eine weitläufige Verwandtschaft auf.
Mit „Kleister“ wird eine dicke Suppe gemeint, die mit Mehl abge-
schmeckt wird und deshalb ein Gegenteil zur „klaren Suppe“ ist, die der
Autor des neuen, nach dem schon vorhandenen Muster geprägten Phra-
seologismus viel lieber essen würde. Bei okkasionellen phraseologischen
Bildungen ist es immerhin wichtig, den Bindefaden zum ursprünglichen
Muster nicht zu verlieren. Erst unter dieser Bedingung wird der Phra-
seologismus wirksam und steigert sogar seinen Eindruckswert. So lesen
wir in einer Novelle von A. Zweig:
Die ganze Truppe hatte die Nase voll, kein Mann
War bereit, wegen Belgien in den Dreck zu beißen.
Denn von Gras war in unserer Gegend nicht die Rede.
(zit. nach: JIcbkuh, 1973, 147)
Das ursprüngliche phraseologische Modell kann auch erweitert wer-
den, was zumeist den Effekt des Komischen, Ironischen bewirkt: Mit
Paucken und Trompeten ist er in der Prüfung durchgefallen ist eine ge-
wohnte Redenweise, die aber in Mit Paucken und Trompeten und einer
Blaskapelle ist er durchgefallen zu einer individuellen Prägung mit gestei-
gertem Ausdruckswert wird.
Das Wortspiel als stilistisches \fcrfahren beruht auf einer Kollision,
auf einem Zusammenstoß zwischen der primären, nicht übertragenen,
direkten Bedeutung der Lexeme in einer Äußerung und der übertrage-
nen idiomatischen Bedeutung der gleichen Wörter im Bestand des Phra-
seologismus. Die Doppelbödigkeit des ganzen Ausdrucks geht dabei
68
darauf zurück, dass zugleich die beiden Bedeutungen — übertragene
und direkte — wahrgenommen werden, z.B.: „Und was macht Hel-
ge?“— „Sie zeigt Zähne.“ — „Ja, sie kann darauf stolz sein, ihrChloro-
dontgebiss ist wirklich schön.“ — „Ich meine doch ihre Patzigkeit“.
H. Heine machte intensiv Gebrauch davon, dass er eine stilistische Kol-
lision zwischen freier ungebundener Bedeutung der Wörter im Kontext
und deren gebundener phraseologischer Bedeutung innerhalb eines
Phraseologismus schuf, z. B.: „Wenn er spricht, trifft er immer den Nagel
auf den Kopf und seine vernagelten Feinde auf die Köpfe“.
Phraseologische Wortfügungen sind an sich genommen komplette
kognitive Modelle, Abbilder und Ergebnisse der menschlichen Erkennt-
nisprozesse. Der „lange Weg der Erkenntnis“ schlägt sich in der „Weis-
heit“ des Phraseologismus nieder. Aber dieser Weg, dieses Modell ist
schon längst eingezeichnet in das Hirn und Mentalität des Sprechenden.
Das ist das, was er in seinem mentalen Gedächtnis von der Generation
seiner Eltern und Ureltem überliefert bekam, und somit sind phraseolo-
gische Modelle ein überlieferbares Sprach- und Kulturgut. Die
Sprache ist nicht das Phänomen, welches außerhalb des menschlichen
Verstandes und der menschlichen Gefühle als ein Vokabular oder ein
Wortschatz liegt. Sie ist drin, im menschlichen Gehirn, in menschlichen
Emotionen. Sie ist da, um die Wfclt der eigenen Wahrnehmung anzupas-
sen, sie zu subjektivieren, auf sein eigenes „Ego“ zu beziehen. Die Ab-
wandlung der Modelle und assoziativer Verbindungen zwischen den vor-
handenen sprachlichen Gegebenheiten ermöglicht eine individuelle,
„massgeschneiderte“ Erkenntnis der Welt, eben deshalb ist der Mensch
auch immer bestrebt, das Usuelle, Übliche, Gewohnte auf seine persön-
liche, individuelle Art abzuwandeln und somit sich selbst als Schöpfer
und Subjekt der Kognition zur Geltung zu bringen. Jedes stilistisch be-
deutsame Mittel oder Verfahren stellt dabei ein Ergebnis der Kognition,
der Erkenntnis dar, bei der der Mensch sowie gewohnte Bahnen als auch
ungewohnte, individuelle einschlägt, um seine individuelle Beschaffen-
heit herauszustreichen.
§ 18. Stilistische Werte einfacher phraseologischer Wendungen
Unter einfachen phraseologischen Wendungen wird in der Regel eine re-
lativ feste Zusammenfügung von Verb und Substantiv verstanden, wobei das
Zeitwort meist abgeblasst und desemantisiert ist.
In vielen Fällen treten diese Wendungen nur als erweiterte Um-
schreibung eines Zeitwortes auf und werden oft als Streckformen (des
Verbs) bezeichnet, da neben ihnen mehr oder weniger synonym oft ein
einfaches \ferb gebraucht werden kann, als dessen „gestreckte“ erweiter-
te Form die Wendung aufgefasst wird: etw. bezweifeln — in Zweifel stel-
len-, etw. ausdrücken — etw. zum Ausdruck bringen-, etw. kommt zum Aus-
druck. Die Vferben, die in diesen Wendungen gebraucht werden, nennt
69
man oft die Funktionsverben, da die wesentliche semantische Funktion
sich auf das Substantiv verlagert hat. Die Verben aber dienen vorwiegend
dazu, syntaktisch-morphologische Merkmale zu tragen (Tempus, Mo-
dus, Prädikatsbeziehung). Diese Wendungen sind im Unterschied zu
den oben erwähnten Phraseologismen nicht expressiv, können also keine
Bewusstseinsbilder durch die Sprache veräußerlichen. Trotzdem kommt
ihnen eine Menge von sprachstilistischen Funktionen zu, auch wenn
manchmal behauptet wird, dass „das überflüssig Gedehnte oft,mangel-
haft“ sei“ [Kleine Enzyklopädie, 1970,1028}.
Erstens schließen sie eine Lücke im Arsenal der sprachlichen Aus-
drucksmittel, wenn es ein entsprechendes Einzelwort überhaupt nicht
gibt, z. B. zur Geltung kommen, bringen', in Übereinstimmung bringen.
Zweitens bestehen zwischen dem Einzelwort und solchen Wendungen
meist semantische und distributionelle Unterschiede. Zu den wichtigs-
ten stilistischen Ausnutzungsmöglichkeiten dieser Wendungen gehö-
ren:
1. Differenzierung der Aktionsart. Das einfache Vferb ist meist durativ
und bezeichnet den Vorgang in seinem Verlauf, ohne Akzent auf Anfang
oder Ende. Die Streckform dagegen pointiert entweder den Anfang oder
das Ende der Handlung, z.B.: die Konferenz wird abgeschlossen — die
Konferenz kommt zu ihrem Abschluss', der Vertrag wird unterzeichnet — der
Vertrag gelangt (kommt) zu seiner Unterzeichnung’, eine Verabredung tref-
fen — sich mit jemandem verabreden', Protest einlegen — gegen etwas pro-
testieren usw. Die Perfektivität, d. h. Abgeschlossenheit der Handlung
wird im Deutschen durch verschiedene grammatische und lexikalische
Mittel ausgedrückt, sie (die Mittel) sind aber vielfältig und nicht ein-
heitlich im Gegensatz zum Russischen, wo diese Kategorie systemhaft
durch Präfixe und Suffixe sprachlich realisiert wird, z. B. cnomwcamb-
ca— cnomKHymbcn, eupaMcamb— eupasumb usw. Die Abgeschlossenheit
der Handlung als Konzept ist aber sehr oft notwendig zur Präzisierung
und inhaltlichen Abschattung der Aussage. Das hat die Streckformen er-
forderlich und in vielen Fällen sogar unentbehrlich gemacht.
2. Rationalisierende Raffung [vgl. Fleischer, Michel, 1977, 79}. In
vielen Fällen ermöglichen die Streckformen eine kürzere und r a-
t i o n e 11 e r e Ausdrucksweise als das einfache Verb, z. B.: Er wollte sich
und seine Meinung zur Geltung bringen — Er wollte, dass er und seine Mei-
nung etwas gelten. Das wichtigste Moment der Rationalisierung besteht
darin, dass die Aussage auf syntaktisch einfachere Weise ausgeformt
wird. Die rationalisierende Raffung geht oft auch darauf zurück, dass an
ein desemantisiertes Verb mehrere vollsemantische Substantive ange-
reiht werden können: erteilen kann man einen Befehl, einen Xferweis,
eine Rüge, eine Anordnung, Unterricht, eine Konsultation usw.; treffen
kann man Maßnahmen, Vorkehrungen, Verabredung, Vereinbarungen;
nehmen kommt in Verbindung mit „Notiz, Rache, Abschied, Bezug“
usw. vor. Es ergeben sich somit Ketten von analogen Modellen, von vor-
gefertigten Mustern, welche je nach Bedarf mit semantisch vollwertigen
70
Substantiven ausgefüllt werden können und die Redeproduktion der-
maßen automatisieren, dass auf der Suche nach dem „treffenden“ Wort
der Kraftaufwand des Sprechenden minimiert wird. Sehr oft ist die Ein-
sparung der Bemühung bei der sprachlichen Ausformung des Gedan-
kens von großer Bedeutung, z.B. in den informativen Massmedien-
texten, wo sehr oft die Kürze des Textes zu einem entscheidenden
Faktor wird, damit die Information überhaupt durchgegeben wird. Den
Produzenten von Kurztextinformationen, also, den Journalisten, soll in
vielen Fällen die Mühe erspart bleiben, nach einem passenden und
schöneren Ausdruck zu suchen. Es kommt ja hier auf Zeit und Kürze an,
deshalb ist es vollkommen rechtmäßig, wenn sie zu einer bewährten
Schablone greifen, zu einem Modell, das zwar die Freiheit bei der Wahl
ausschließt, aber um so mehr die Produktion der Rede erleichtert und
die Reaktion darauf weniger variabel macht. Eben deshalb hat sich die
verbale Streckform dort durchgesetzt, wo die Schablone nicht verpönt,
sondern umgekehrt vollkommen berechtigt ist: in informativen Mass-
mediengenres, bei Gesetzgebung, im Gerichtswesen. Selbstverständlich
muss die Schabionisierung der Rede vernünftige Ausmaße haben. Die
Kommunikation darf dabei nicht beeinträchtigt werden, auch dürfen
keine unerwünschten Nebeneffekte aufkommen, z. B. die des Komi-
schen, des zu sehr Steifen. Aber manchmal werden die Anhäufung der
Schablonen und ihre Steigerung bewusst angestrebt, z.B. in Parodi-
en. H.V. Hofmannsthal karikiert mit ihrer Hilfe in seinem Lustspiel
„Der Schwierige“ die gespreizte Konversation einer Soiree. Erlässt eine
Figur so sprechen:
Dürfte ich fragen, welche meiner Arbeiten den Vorzug gehabt hat, Ihre Auf-
merksamkeit zu erwecken? Ich würde großes Gewicht darauf legen, mit Graf
Brüll in einer wirkungsvollen Weise bekannt gemacht zu werden.
(zit. nach: Fleischer, Michel, 1977, 81)
3. Stilistische Variabilität des sprachlichen Ausdrucks zur Erhöhung
der Expressivität und zur rhythmischen Gestaltung der Aussage^ In der
stilgerechten Ausgestaltung der Rede gilt praktisch als Faustregel, dass
die Wiederholungen, wenn sie keine besonderen stilistischen Effekte be-
wirken sollen, nach Möglichkeiten vermieden werden. Die Streckfor-
men des Verbs dienen oft dazu, eine Variationsmöglichkeit für ein einfa-
ches Verb anzubieten und dadurch die sprachliche Darlegung abwechs-
lungsreicher zu machen, insbesondere da, wo die schwerfälligen Passiv-
konstruktionen ersetzt werden müssen, z.B.: Die Bücher sollen ab mor-
gen verkauft werden — Die Bücher kommen ab morgen zum Verkauf, Ich
weiß nicht, ob diese Hinweise in Zukunft werden beachtet werden — Ich
weiß nicht, ob diese Hinweise Beachtung finden werden.
Für die rhythmische Gestaltung eines Satzes ist es im Deut-
schen üblich, den Spannungsbogen zwischen dem Xbrbum finitum und
den infiniten Teilen des Prädikats aufrechtzuerhalten, denn am anderen
Ende des Kommunikationsdrahts steht der „geduldige“ Rezipient und
71
wartet, wann der Deutsche „aus dem Ozean“ seiner Wörter mit „der
trennbaren Vorsilbe“ in Mund herauskommt. So jedenfalls sah diese Be-
sonderheit der rhythmisch-grammatischen Ausgestaltung der deutschen
Sätze der berühmte Mark Twain. Und er scheint Recht gehabt zu haben
aus der Sicht, dass es praktisch unmöglich, jedenfalls nicht schön ist, in
einen lexisch ausgebauten Satz nur ein Verb an die zweite Stelle zu plat-
zieren und weiter über die Wellen der Substantive zu schwimmen, ohne
dass dabei ein „Ufer“ markiert wird. Wenn man so schwimmt, wird ge-
gen den Wohlklang, gegen die Rhythmik des Satzes verstoßen. Um den
Satz in seiner rhythmischen Eigenart nicht zu zerstören, kommt dem
einfachen \fcrb oft seine Streckform zu Hilfe. Vergleichen wir zwei Aus-
formungen eines Satzes aus W. Goethes „Wilhelm Meisters Lehijahre“:
1. Besonders unglaublich wirken die Gewölbe und Keller, die verfallenen
Schlösser, das Moos und die hohen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zi-
geunerszenen und das heimliche Gericht.
2. Besonders taten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das
Moos und die hohen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zigeunerszenen
und das heimliche Gericht eine ganz unglaubliche Wirkung.
(zit. nach: Fleischer, Michel, 1977, 81)
Das Substantiv „Wirkung“ erhält am Satzende einen weit stärkeren
Nachdruck als das finite Verb „wirken“ an zweiter Stelle im Satz und
lässt den Rezipienten auf das Ende des Satzes gespannt sein.
§19. Stilistische Leistungen der Homonymie
Das Wesen der Homonymie besteht darin, dass mit einer Form ver-
schiedene Bedeutungen verknüpft sind. Im gegebenen Kontext wird
aber in der Regel nur eine Bedeutung aktualisiert. Welche Bedeutung
gemeint ist, enthüllt sich oft erst durch die Kombination der Wörter.
Homonyme werden oft zur Erzielung besonderer Wirkungen ausge-
nützt, z. B. zur bewussten Doppelbödigkeit. Bei der Doppelbödigkeit las-
sen die verwendeten Konstruktionen die Aktualisierung verschiede-
ner Bedeutungsvarianten zu. Auf der Doppelbödigkeit beruht z. B. der
Wortwitz.
Bei der linearen Entfaltung der Rede kommt es darauf an, dass jedes
nachfolgende Element mit einem gewissen Grad der Sicherheit erwartet
wird. Der Kontext aus vorangehenden Elementen der Rede impliziert das
Erscheinen des nachfolgenden Elements. Die Implikation sieht so aus:
Wenn A — dann B; wenn B — dann C usw. Die lineare Entfaltung der
Rede ist nicht das Einzige, was das nächstfolgende Element positioniert.
Von Bedeutung sind auch supralinearen Faktoren bei der Entfaltung
der Rede, z. B. die Faktoren des Sinnes, der Intention, der Zielsetzung.
Die supralinearen Faktoren sind im Stande, die gewohnte Implikation
zu zerreißen, sie in ein Gegenteil zu verwandeln. Es entstehen Störun-
72
gen im gewöhnlichen Wahrnehmungsprogramm, aber diese Störungen
sind an sich genommen keine Fehler oder Abweichungen vom normalen
Gebrauch. Sie selber lassen einen neuen Sinn, einen Suprasinn entste-
hen, der die unerwartete Aktualisierung und den Verfremdungseffekt bei
der Wahrnehmung berechtigt und begründet macht.
Die Quellen der homonymischen Wortwitze können dabei verschie-
den sein: der Volksmund mit seinen wortschöpferischen Ansätzen, die
an satirischen und komischen Effekten ausgerichteten Genres der Presse
und Publizistik sowie Einzelautoren, für die Wortspiele nicht nur ein
kompositorisch-technisches Textverfahren sind, sondern die Widerspie-
gelung ihres konzeptualen Verhaltens zu den Sachverhalten, die sie in
ihrem Werk darstellen. H.Heine, in dessen Wbrtkunstwerken das Stre-
ben nach Verfremdungseffekten bekanntlich den Einsatz von verschie-
denartigen Teiltechniken bewirkte, schuf unter anderem viele Wort-
spiele auf homonymischer Basis:
Die Tore jedoch, die ließen
Mein Liebchen entwischen gar still;
Ein Tor ist immer willig,
Wfenn eine Torin will.
In Göttingen blüht die Wissenschaft
doch bringt sie keine Früchte.
Ich kam dort durch in stockfinstrer Nacht,
sah nirgendwo ein Lichte {aufgeklärter Mensch — N.B.).
Außerordentlich bekannt sind die Aphorismen von I.Gossel, die zu-
meist auf Homonymie bauen:
Ist die Ferse deiner Füße
bös, so hinkst du, armer Wicht;
sind die Füße deiner Verse
schlecht, so hinkt nur dein Gedicht.
Ein gescheiter Mensch, sagt man, sieht aufgeweckt aus, und doch sieht der
Mensch am dümmsten aus, wenn er gerade aufgeweckt ist.
(zit. nach: JleBKMH, 1973, 99—100)
Der Doppelsinn als stilistisches Verfahren setzt voraus, dass in den
Kontext bewusst die Möglichkeit falscher Auslegung eingebaut wird.
Besonders liebt den Doppelsinn die Volksdichtung iv\ ihrer
schriftlichen und mündlichen Form. Die Scherze und Streiche des
Volksbuchhelden Eulenspiegel beruhen zum großen Teil auf Missverste-
hen, d. h. auf dem Spiel mit Homonymen:
\ör einem Lebensmittelgeschäft hing eine Tafel „Bratheringe — lose“. Da
kam ein Wanderer des Weges und fragte: „Was ist denn der Hauptgewinn?“
„Ich weiß nicht,“ sagte der alte Donnerhack zum alten Baudenbacher,
„mein Magen will gar nicht mehr so recht. Früher da habe ich Eisenbahnschie-
nen fressen können.“ Da kam ein Wanderer des Weges und flüsterte Baudenba-
cher ins Ohr: „Er hat natürlich nur die Weichen gefressen.“
73
Auf Doppelsinn beruht die überwiegende Mehrzahl volkstümli-
cher Scherzfragen und Rätsel:
Sie ein Wasser, er ein Wasser. Sie oft wild, er meist mild.
Sie am Strand, er im Land.
Die am Feuer, das am Wasser, beide schützen, beide nützen. Die mit Wis-
set, das vor Wasser.
(jqoA\.SEp‘aip)
Der, ein Mann mit großem Wissen, die wird unser Ohr genießen.
atp ljap)
Zuletzt muss gesagt werden, dass der offizielle Stil in allen seinen
Abarten, sowie der wissenschaftliche Stil, falls er nicht satirisch-pole-
misch gefärbt ist, den Doppelsinn und die Doppelbödigkeit ablehnen,
denn ihre funktionale Spezifik ist unvereinbar mit dem expressiven Aus-
druckswert dieses Stilmittels.
§ 20. Stilistische Leistungen der Antonymie
Die Erscheinung selbst hat in der Linguistik verschiedene deskripti-
ve (beschreibende) Definitionen. Vereinfacht versteht man unter An-
tonymen Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung. Aber im strengen
Sinne ist die Antonymie die Relation zwischen zwei Lexemen mit dem
ihnen eigenen Sembestand. Bei der Antonymie ist das eine Sem die ge-
naue Umkehrung oder der extreme Gegensatz des anderen. Der Ge-
gensatz hat die symmetrische Form der Opposition oder der Polarität,
d. h. er besteht nur zwischen diesen beiden Semen und von dem einen
ist jeweils eindeutig auf das andere zu schließen: exklusiv—inklusiv,
materiell—immateriell. In der außersprachlichen Realität bestehen sol-
che paarigen Oppositionen gar nicht so oft, deshalb ist es schwierig all-
gemein gültige innersprachliche Kriterien zur Bestimmung von An-
tonymenpartnern zu finden. Die Entscheidung darüber, ob die Um-
kehrung der Bedeutung vorliegt, bleibt oft vage. So werden beispiels-
weise realitätsbedingte Lexempaare wie „männlich—weiblich“ meist
als Antonyme bezeichnet, doch es gibt keinen Maßstab, nach dem ein
Unterschied im Grad der Gegensätzlichkeit zu bestimmen wäre zwi-
schen dem genannten Paar und anderen Substitutionspartnern, etwa
„männlich, kindlich, sächlich“. Sogar bei solchen logisch-wissen-
schaftlichen Polaritäten wie „plus—minus“ oder „positiv— negativ“ ist
die Bedingung der alleinigen extremen und symmetrischen Opposition
vorhanden. Kann z.B. „plus“ „null“ entgegengesetzt werden? Kann
„positiv“ ein Gegensatz zu „neutral“ z. B. bei medizinischen Analysen
und Testproben sein? Ähnliches gilt auch für den Fall der Substitution
74
durch sprachliche Negationsformen. Der Weg ist kurz bedeutet bedeu-
tungsähnlich Der Weg ist nicht lang.
Aber ein „nicht langer Weg“ kann außer „kurz“ auch „nicht sehr
lang“, „mittellang“ oder „nicht lang, sondern steil“ sein. Eben deshalb
wird die Antonymität in der modernen Sprachforschung immer öfter als
Bedeutungskontrast oder als gegenseitiger Bedeu-
tungsausschluss aufgefasst. Für den Bedeutungsausschluss werden
auch die Termini „Inkompatibilität“, „Unverträglichkeit“ und „Unver-
einbarkeit“ gebraucht. In „Lexikologie der deutschen Gegenwartsspra-
che“ von M. D. Stepanova und 1.1. Öernyseva werden drei Arten der An-
tonymität, des Gegensatzes herausgegliedert: kontradiktorischer Gegen-
satz (Sein—Nichtsein, Armut—Reichtum), konträrer Gegensatz (Maxi-
mum—Minimum, nehmen—geben) und komplementärer Gegensatz
(männlich—weiblich, ledig—verheiratet). Der kontradiktorische Gegensatz
stellt eine logische Negation des gegensätzlichen Begriffs dar. Konträre
Gegensätze sind zwei Begriffe, die innerhalb eines bestimmten Bewer-
tungs- oder Bezugssystems als Artbegriffe existieren. Der komplementäre
Gegensatz unterstellt, dass die Negation eines Begriffs die Behauptung
eines anderen Begriffs voraussetzt: wenn nicht ledig, dann — verheiratet.
Die komplementäre und konträre Antonymie sind für eine treffende
Wortwahl von außerordentlicher Bedeutung. Im Begriffskonzept „Wald“
ist „licht“ (ein lichter Wald) dem Wort „dicht“ entgegengesetzt, aber
„ein lichter Tag“ ist ein begrifflicher Gegensatz zum „trüben Tag“.
„Tiefe Stimme“ ist das Gegenteil von „hoher Stimme“, „dürre Hand“
hat als Antonym „volle, fleischige Hand“, „dürre Blätter“ sind aber
„ausgetrocknete, verwelkte Blätter“. Im Bezugssystem „Finanzierung“
bildet „private Hand“ einen konträren Gegensatz zu „öffentliche
Hand“, bei Bewertung der unternehmerischen Tätigkeit gehen „Auf-
wand“ und „Kosten“ ein antonymisches Verhältnis ein.
Im grammatischen Inventar der deutschen Sprache sind reguläre
grammatische Mittel enthalten, die einen Begriff in sein Gegenteil ver-
kehren, vor allem gehören dazu Präfixe und Suffixe, z. B.: mieten — ver-
mieten, achten — verachten, gefallen — missfallen, flechten — entflechten,
einflihren — ausführen, Vorwort — Nachwort, Vorteil — Nachteil, ge-
schäftsfähig — geschäftsunfähig, Realität — Irrealität, logisch — alogisch,
erfolglos — erfolgreich, steuerpflichtig — steuerfrei, sauerstoffhaltig — sau-
erstofffrei usw. Mit Suffixen und Präfixen werden meist kontradiktori-
sche Gegensatzpaare gebildet, wobei Suffixe selbst wortbildende an-
tonymische Oppositionen bilden können: frei — haltig, los — voll,
reich — arm, widrig — mäßigusw. Antonymie kann nicht nur binare Op-
positionen prägen, sondern auch drei- und mehrgliedrige, je
nach Bezugssystem, in dem sie (Antonymie) behandelt wird: weiß-
schwarz—gelb (Menschenrassen), maskulinum—neutrum—femininum
(grammatisches Geschlecht), oberdeutsch — mitteldeutsch—nieder-
deutsch (territoriale Schichtung der Sprache), Breite—Länge—Höhe
(räumliche Dimension).
75
Die Antonymie kann regulären vorhersagbaren Charakter tragen,
insbesondere wenn sie mit wortbildenden Mitteln ausgeformt wird oder
wenn das Bezugssystem dem Sprechenden samt den antonymischen Be-
zeichnungen gut vertraut ist. Die antonymischen Oppositionen können
auch als Aktualisierungen im Kontext und durch den Kontext
geprägt werden. Sehr oft treffen wir solche Aktualisierungen in
Sprichwörtern und sp richwo rt artigen Redensarten, wo
das eindeutige Streben nach Reim einer der Faktoren ist, unter dessen
Druck Gegensatzpaare entstehen: Viele zum Rat, wenige zur Tat', Gold,
das stumm ist, macht gerade, was krumm ist; Des einen Tod, des anderen
Brot; Willst du den Genuss, so nimm auch den Verdruss, Hausse und
Baisse; Auf- und Abstieg; Brot und Künste; achten und verachten usw.
Und doch bleiben die eigentlichen Domäne der Gegensätzlichkeit
jeder Art Belletristik und Juornalistik, wo Gegensatzpaare
eine besondere stilistische Figur oder Verfahren ausgestalten, und zwar
die Antithese. Bei H. Heine ist die Antithese ein durchgehendes wort-
künstlerisches Verfahren, welches dem Autor ermöglicht, seine Gedan-
ken in komprimierter Form, prägnant, klar und sogar pathetisch auszu-
formen. Die antithetischen Aufzählungen steigern den stilistischen Aus-
druckswert und verstärken die pragmatische Ausrichtung des sprachli-
chen Ausdrucks. Hier einige Beispiele:
1. Man findet im englischen Volke eine Einheit der Gesinnung, die eben
darin besteht, daß es sich als ein Volk fühlt... Daher die geheime Übereinstim-
mung des ganzen Lebens und Webens in England, das uns beim ersten Anblick
nur ein Schauplatz der Verwirrung und Widersprüche dünken will, Überreich-
tum und Misere, Orthodoxie und Glauben, Freiheit und Knechtschaft, Grau-
samkeit und Milde, Ehrlichkeit und Gaunerei, diese Gegensätze in ihren toll-
sten Extremen.
2. Der Tod, das ist die kühle Nacht
Das Leben ist der schrille Tag.
Mein Herz, mein Herz ist traurig
Doch lustig leuchtet der Mai.
Die Gegensätzlichkeit von H. Heine kann nicht nur traditionell ro-
mantisch wirken („aus meinen großen Schmerzen mache ich die klei-
nen Lieder“), sondern auch bissig werden, wenn etwas oder jemand zur
Zielscheibe seines Spottes werden, wie es z. B. in „Deutschland. Ein
Wintermärchen“ häufig der Fall ist:
Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wässer.
Er (der Zollverein — N.A.) gibt die äußere Einheit uns,
Die sogenannt materielle;
Die geistige Einheit gibt uns die Zensur,
Die wahrhaft ideelle —...
76
§21. Das einheimische Wort unter dem Andrang
des Fremdländischen
In den älteren Stilistiken ist dem Fremdwort sehr viel Beachtung ge-
schenkt worden. Meistens aber wurde das Fremdwortgut unter dem
Aspekt des Stilwidrigen betrachtet. Die Stillehrbücher rieten dazu vom
Fremdwort Abstand zu nehmen und an dessen Stelle heimische Wörter
der deutschen Sprache zu verwenden. Dieser Ratschlag hat eine jahr-
hundertealte Tradition. Die Fremdwortfeindlichkeit, der sprachliche
Purismus, war nicht nur ein stilistisches, sondern stets ein politisch-
ideologisches Problem.
Die gemeinsame Sprache wird bei allen Völkern als Grundlage der
nationalen Sprache empfunden, obwohl es auch mehrsprachige Natio-
nen gibt, z. B. Schweizer, Belgier. In allen Sprachen finden sich aber
auch Wörter aus anderen Sprachen, die mit den entsprechenden Sachen
und Vorstellungen übernommen worden sind. Die Übernahme erfolgt
sowie auf Basis direkter Kontakte zwischen verschiedenen Kul-
turen als auch auf Grund übersetzerischer Tätigkeit, die
heutzutage enorme Ausmaße erreicht hat. Der Umfang der in Buchform
publizierten und im Buchhandel erhältlichen Übersetzungen ist beein-
druckend: von den 70 643 im Jahre 1994 in der Bundesrepublik
Deutschland produzierten Buchtiteln sind 10 206 (14,4 %) Übersetzun-
gen. Diese und weitere aufschlussreiche statistische Angaben zur Über-
setzungsproduktion finden sich in der Publikation „Buch und Buchhan-
del in Zahlen“, die jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels herausgegeben wird. So werden in der erwähnten Publikation zu-
nächst die 10 Länder aufgefuhrt, die am meisten Übersetzungen produ-
zieren. Deutschland belegt unter den übersetzerisch aktivsten Ländern
mit 11 173 Buchtiteln im Jahr eindeutig den ersten Platz. Die Publikati-
on gibt auch Aufschluss über die Herkunftssprachen, aus denen am
meisten übersetzt wird. Als Herkunftssprache hat das Englische ein großes
Übergewicht: 71,4% aller Übersetzungen stammen aus dem Englischen
als Herkunftssprache, 10,6 % aus dem Französischen, 2,9 % aus dem Ita-
lienischen, 2,2 % aus dem Spanischen und 2 % aus dem Russischen. Die
übersetzerischen Aktivitäten mit Englisch als Herkunftssprache entfalten
sich in verschiedenen Sachgebieten, führend sind dabei Sprach- und Lite-
raturwissenschaft, Belletristik, Philosophie, Psychologie, Sozialwissen-
schaften, angewandte Wissenschaften wie Medizin und Technik. Es wird
ohne weiteres verständlich, dass die eng vernetzten übersetzerischen Kon-
takte eine ganze Menge von Fremdwortübemahmen bewirken, viele von
denen mit der Zeit mehr oder weniger gelungen verdeutscht werden und
in den Usus aufgenommen werden.
Zu den chronologisch frühesten Fremdwortübemahmen gehören die
Übernahmen aus dem Italienischen im Zeitraum vom 14. bis zum 16.
Jahrhundert. In dieser Zeit rückt Italien auf weltweit führende Positio-
77
nen in Wirtschaft, Handel, Kultur und Kunst auf. Von größter Bedeu-
tung waren damals die Handelsbeziehungen zwischen Süddeutschland
und Norditalien. Mit regen Handelsgeschäften sind nicht mehr als
fremd empfundene Wörter verbunden, wie Bank, Konto, Tara, Kasse,
Kredit, Risiko, Kapital, Bilanz, Kontor, Bankrott usw. In der Epoche der
Aufklärung nehmen ihren Ursprung sehr viele Übernahmen aus der la-
teinischen Sprache, die zu der Zeit die Sprache der Kirche und Wissen-
schaften war, z. B.: Text, Traktat, Glosse, Philosophie, Logik, Materie,
Komet, Orient, Essenz, Mixtur, arretieren, protestieren, appellieren, Advo-
kat, Dekret, Kaution, Akademie, Aula, Auditorium, Examen, Doktor, Rek-
tor, Professor, Student usw.
In der Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert haben die Wortübemah-
men aus dem Französischen den fortschrittlichen Zeitgeist des deutschen
Bürgertums geprägt. Das wirtschaftlich und politisch rückständige
Deutschland stand dem zentralisierten und starken Frankreich gegenü-
ber, in dem Wirtschaft, Kultur, Literatur und Kunst gediehen. Für
Deutschland stellte Frankreich ein fast unerschwingliches Ideal, ein
Muster für Nachahmung dar. Im 17. und 18. Jahrhundert setzte in
Deutschland die so genannte A-la-mode-Zeit ein, wobei die französische
Sprache nicht nur die Sprache der deutschen Akademien, Diplomaten
und des Adels wurde, sondern auch die Sprache des aufgeklärten Bür-
gertums. Die Fremdwortübernahmen jener Zeit waren verbunden mit
Mode, Alltag, höfischem Leben, z. B.: Dame, galant, elegant, Krawatte,
Perücke, Möbel, Kommode, Karaffe, Likör usw. Viele Begriffe jener Zeit
wurden aus dem Französischen kalkiert: Vorhut — avantgarde, Redens-
art — fason de parier, Schöngeist — bei esprit, Freigeist — esprit libre,
Flugblatt — feuille volante, Fortschritt — progress.
In der Epoche der großen Revolutionen 1789 und 1848 wurden aus
dem Französischen viele Wörter aus dem gesellschaftspolitischen Be-
reich übernommen. Die meisten Übernahmen dieser Zeit gehören zu
den so genannten Internationalismen lateinischen und
griechischen Ursprungs, die in den neueren Umständen oft
umgedeutet oder auf Grund des klassischen Wortguts neu geschaffen
waren. Dazu gehören Monarchie, Demokratie, Republik, Klasse, Revolu-
tion, Reaktion, Bürokratie, Konstitution, Anarchist, Monarchist u.a.m.
Zu dieser Zeitperiode werden auch einige Lehnübersetzungen zugerech-
net, z. B.: Tagesordnung — ordre dujour, Staatsbürger— citoyen, öffentli-
che Meinung — opinion publique, auf der Höhe sein — etre ä la hauteur
usw. Die französische revolutionäre Bewegung der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts bereichert die deutsche Sprache um solche französischen
Wörter, wie Sozialismus, Sozialdemokrat, Kommunismus, Proletariat,
Bourgeoisie, Klassenkampf u.a.m. Später gewinnen diese Bezeichnungen
internationalen Charakter und werden weltweit gebraucht.
Bis zum 18. Jahrhundert hat Englisch nur geringen Einfluss auf das
Deutsche ausgeübt. Der Andrang des Englischen beginnt erst im 18.
Jahrhundert spürbar zu werden. Die Übernahmen aus dem Englischen er-
78
fassen den Bereich der staatlichen und rechtlichen Tätigkeit, Literatur,
Kunst, Mode. Dazu gehören z. B. Parlament, Bill, Debatte, Boykott,
Meeting, Ballade, Humor, Klub, Tatsache, Dandy, Pullover, Plaid, Beef-
steak, Rumpsteak, Pudding, Keks usw. Im 19. Jahrhundert überwiegen
Fremdwörter aus Sport, Handel, Technik und Industrie, z. B.: Jockey,
Trainer, Start, Match, Champion, Artist, Clown, Tunnel, Lokomotive, Lift,
Koks, Konzern, Scheck, Banknote, Lombard, Export, Import u. a. m.
Das ganze 20. Jahrhundert steht im Zeichen der angelsächsischen
Einflüsse nicht nur auf das Deutsche, sondern auch auf andere Spra-
chen. Das Englische hat sich flächendeckend im Internet durchgesetzt.
Man wendet sich z. B. an alle im Chatroom: „Help\ Hab den Real-Audio-
Player runtergeladen, Version 5.0, jetzt gibt es Puff mit dem Expander.
Flippe aus\“ Ein netter Geist aus Basel eilt gleich zur Hilfe: „Easy, Spi-
ded. Checken wir doch. Beim Downloaden gibt’s immer Problems. Was ge-
nau hast du gemacht!“
Modernes Medium, flinke Sprache — so kommunizieren junge Leu-
te. Die deutsche Sprache fiebert wie nie zuvor. „Der Wortschatz explo-
diert förmlich“, sagt Matthias We r m k e, Leiter der Dudenredakti-
on. Täglich schaffen Werbetexter frische Begriffe, die „in“ sind, weil sie
englisch tönen. Wir leben im Informationszeitalter: Wirtschaft, Wissen-
schaft und Medien vernetzen sich international. Ständig werden neue
Ideen ins Land gebracht und mit ihnen frische „Sprachfetzen“. Die Welt
ist „kleiner“ geworden, deswegen nehmen die nationalen Sprachen,
auch das Deutsche, mehr Neues aus den anderen Sprachen auf. Der
Sprache Amerikas stehen riesige Einfallstore ins Deutsche offen: Pop,
Film, Internet, Technik, Wirtschaft, Wissenschaft, Werbung. Während
die ältere Generation die „Cakes“ noch zu „Keksen“ verdeutschte,
schlucken die Jüngeren die „Cornflakes“ im Original und machen sie
nicht zu „Kornfleksen“.
Vielen gilt die „Fremdwortinvasion“ aus Amerika als Ärgernis. Der
Berner Germanistikprofessor Helmut Thomke klagt über die da-
mit verbundene ungeheure Kommerzialisierung der Kultur. Das Mann-
heimer Institut für deutsche Sprache veröffentlichte eine Umfrage, wo-
nach 57 Prozent der Deutschen eine solche Sprachentwicklung Besoig-
nis erregend finden. Die unter Managern viel gelesene Zeitschrift „Wirt-
schaftswoche“ tut sich auch besorgt, weil die Wirtschafisprcsse weltweit
stark angloamerikanisch geprägt ist. „Das Bild der deut-
schen Wirtschaft im Ausland ist zu blass“ schreibt die Zeitschrift in ei-
nem Beitrag. In den asiatischen Boommärkten und den Wachstumsre-
gionen Lateinamerikas komme die Darstellung deutscher Unternehmen
und Marken zu kurz. Ein Grund dafür sei die Vorherrschaft britischer
und vor allem US-amerikanischer Titel, Sender und Nachrichtenagen-
turen. Das Bild, das sich die Menschen von der Welt machen, werde von
»Reuters“ und „Associated Press“, „CNN“, „Time“, „Newsweek“,
„Wall Street Journal“, „Financial Times“ und „Economist“ geprägt.
Rein Wunder, dass immer mehr deutsche Manager Nachteile im inter-
79
nationalen Wettbewerb befürchten. Das Ansehen des Standortes
Deutschland sei durch die weltliche Verbreitung der angelsächsischen
Presse schlechter als in der Realität. So gilt Technologie und Manage-
ment „made in Germany“ in den Vereinigten Staaten als veraltet. Frü-
her ein Symbol des Kolonialismus ist Englisch heute die Sprache der
Wirtschaft von Seoul bis zur indonesischen Stadt Bandung.
Gegen die Übermacht des Englischen arbeiten unter anderem 151
Goethe-Institute in 78 Ländern. Außerhalb Deutschlands sprechen
noch rund fünf Millionen Schweizer und acht Millionen Österreicher
Deutsch. Weitere 40 Millionen Menschen, vor allem in Luxemburg,
Belgien, Holland, Ungarn, Tschechien und Russland können sich auf
Deutsch verständigen. Nach neuesten Angaben des Auswärtigen Amtes
lernen weltweit knapp 20 Millionen Schüler und Studenten Deutsch —
allein 13,5 Millionen in Osteuropa und den GUS-Ländern. Aber auch
dieser mächtige Andrang des Deutschen kommt gegen Englisch nicht
auf. Laut Duden-Redaktion gäbe es dabei kaum Grund zur Sorge. Im-
mer noch zwei Drittel der Fremdwörter kämen aus dem Griechischen
und Lateinischen. Nur knapp vier Prozent des Gebrauchswortschatzes
haben englische Wurzeln. „Das Deutsche ist wie eine Stadt“, verkündet
das Goethe-Institut in seinem Lehrblatt „Markt“. „Die hat feste Fun-
damente, ist voller alter Häuser. In allen Quartieren wird wild gebaut,
nichts erinnert da an Niedergang: frische Unübersichtlichkeit herrscht.“
Linguisten wissen: das lief schon immer so und soll auch so sein.
Die Sprache fungiert als ein S t a t u s s y m b o 1 und schafft das Ge-
fühl der Zugehörigkeit. Die Eltern hören ihre Kinder und klagen: „Das
verstehen wir nicht.“ Dabei ist gerade das der Sinn der Sache. Dass sich
die Kids mit einem Deutsch-Englisch-Mix abgrenzen, hat klare Ursa-
chen: Popkultur und Werbung. In der aktuellen Schweizer CD-Hitpara-
de sind 32 der 50 Top auf Englisch gesungen. Drei Viertel aller Kinobe-
suche galten 1997 angelsächsischen Filmen. Die Werber hängen sich
gern das Hollywood-Image an und machen den Staubsauger zum „Po-
wer-Cleaner“, adeln die Unterhose zur „Lifestyle-Underwear“. Mit der
englischen Verkleidung soll eine höhere Qualität suggeriert werden,
so lautet die einheitliche Meinung der Werbetexter. Der angesehenste
Schweizer Werbetexter Robert Stalder meint: „Wenn man sich
ein bisschen Weltoffenheitsglanz verleihen will, geht das heute mit engli-
schen Ausdrücken ganz gut.“ Das Englische schafft heute Prestige, das
öffentliche Ansehen. Das ist etwa so, wie es mit den französischen Ein-
sprengseln zu den Zeiten von „Buddenbrooks“ der Fall war, als die adli-
gen und bürgerlichen Kreise ihre Konversation mit französischen Wör-
tern ergänzt haben.
Kommunikativ gesehen, kann es sich bei solchem Gebrauch um den
Versuch der gruppengebundenen Verständigung handeln, an der
kein anderer teilhaben soll, also um eine Art Chiffresprache, wie sie in
manchen Jargonsprachen anzutreffen ist. In sozial höheren Schichten
könnte es sich dagegen um eine Manier handeln, gebildet zu wirken.
80
Das Fremdwort imponiert, es imponiert umso mehr, je weniger es
verstanden wird. Durch die Verwendung von Fremdwörtern entsteht die
Vortäuschung, wie man sie so oft an Einzelpersonen trifft, die auf
diese Weise den Anschein erwecken wollen, eine höhere Bildung oder
einen höheren sozialen Status zu besitzen, als ihnen eigen ist. Heinrich
Mann hat bekanntlich diese Versuche in seinen satirischen Romanen
wiederholt bloßgestellt. Theodor Fontane greift solche Charakterisie-
rungen in der Zeichnung der zur Frau Kommerzienrat aufgestiegenen
Krämerstochter Jenny Treibei auf. Das folgende Beispiel zeigt, wie der
Autor gleichzeitig das Fremdwort als Ausdrucksvariante des heimischen
Wortes nutzt:
„Du siehst, daß ich eine Alteration gehabt habe, und die Form, in die du
deine Teilnahme kleidest, ist die der geschmacklosen Vergleiche. Was meiner
Erregung zugrunde liegt, scheint deine Neugier nicht sonderlich zu wecken.“
Der Glaube, Gesellschaft lasse sich per Sprache steuern, lebt fort.
Wörter dienen zum Reizen, doch sie können auch als Tranquilizer
auftreten. Eine Regel des Businessdeutsch lautet: Sage das Negative po-
sitiv. Und möglichst auf Englisch. So kommt „Downsizing“ und „Lean
Production“ statt „Arbeitsplatzabbau“ zu Stande. Die gewohnte „Kos-
teneinsparung“ ist heute nur noch mit „Outsourcing“ möglich, „On-
linebanking“ geht nur über das Internet.
Aber das Xbrtuschungsvermögen des Englischen scheint heute nicht
mehr ausreichend zu wirken. So werden im Fachbereich der Unterneh-
mensführung längst bekannte Internationalismen bemüht, zu englischen
Neuprägungen zu werden, indem sie grammatisch den englischen Struk-
turen angepasst werden. Kontrolle als Managerfunktion wird zu „Cont-
rolling“, die Ansammlung und Xfcrnetzung von die Arbeit inspirierenden
Bildern heißt im heutigen Managerdeutsch „Bildmapping“. Aber nichts
für ungut. Das Englische im Management und Marketing lässt sozusa-
gen „Kosten“ sparen und erschließt oft in einem Wort das, was im Deut-
schen viel mehr sprachlichen Aufwand verlangen würde. Der Insider
spart sich die Kosten der wortreicheren Erläuterung, indem er den eng-
lischen Fachausdruck direkt übernimmt. Er läuft dabei keine Gefahr
missverstanden zu werden, denn seine Ausführungen gelten zumeist nur
den Eingeweihten, nicht den Fremden. So werden solche Begriffe
auf Englisch in Managementkonzepte und Managerredeweisen einge-
flochten wie: Brainstorming (Verfahren, um durch Sammeln von sponta-
nen Einfällen die beste Lösung des Problems zu finden), Branding
(Marktaktivitäten, die sich auf die Wahl des Markennamens und die
Gestaltung des Markenzeichens beziehen), Business Prozess Reenginee-
ring (kurzfristige Umgestaltung von Geschäftsprozessen), Cashflow (der
in einer Periode erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss), Coaching
(Personalentwicklungskonzept zur Förderung von Nachwuchsfuhrungs-
kräften), Corporate Identity (Erscheinungsbild des Unternehmens nach
innen und draußen), Faktory outlets (Fabrikverkauf, wobei Markenware
81
zu niedrigeren Preisen als im Handel an den Endverbraucher verkauft
wird), Follow-up (Nachfragereaktion, um die Wirkung beim Kunden
festzustellen) u. a. m.
Klar ist eins, man kann heute nicht mehr jedes Fremdwort meiden und
zu verdeutschen suchen. Dafür ist das moderne Leben mit seinen Infor-
mationen und Produktenaustausch zu sehr auf internationale Verständi-
gung, auch im Wortschatz angewiesen. Für zahlreiche neue Vorstellungen
werden neue, zumeist fremde Wörter übernommen, die keine deutsche
Entsprechung haben. Die stilistische Bedeutung des Fremdwortes bleibt
uneingeschränkt bestehen. Das sehen wohl auch die bekanntesten Ro-
manciers des auslaufenden 20. Jahrhunderts ein, die in ihrem dichteri-
schen Werk eine neue, global vernetzte Welt darstellen, in der der Mensch
die Welt offen und ungestört als eine ihm gehörige empfindet und keine
Scheu weder vor Grenzen noch vor sprachlichen Barrieren hat. Wenn z. B.
Johannes Mario Simmel in seinem Roman „Alle Menschen werden Brü-
der“ die Atmosphäre der Weltoffenheit schildern will, schreckt er nicht
zurück, ganze Dialoge oder Einzelrepliken auf Englisch wiederzugeben:
Ich bedanke mich wieder.
— Don’t mention it. Can I give you a lift?
— You are driving in the other direction.
— So what? I can turn around. Das fehlte noch.
— I’d really rather walk. Thanks again.
— That’s all right, sagte er, kletterte in seinen Chevy und fuhr weiter. Dort
bog er nach rechts.
Je enger Europa und die ganze Welt zusammenwachsen, desto unnö-
tiger wird es, Zusatzhindernisse in Form von Sprachbarrieren durchzu-
halten. Mit der Öffnung der Welt öffnen sich auch die Sprachen, sie wir-
ken zusammen, ohne dass die Reinhaltungsversuche der Sprachpuristen
alten und neuen Schlages dieses in beide Richtungen fruchtbare Zusam-
menwirken beeinträchtigen können.
Literaturnachweis
1. Agricola E. Semantische Relationen im Text und im System. — Halle,
1972.
2. Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. — Leipzig, 1970. — Bd. 2.
3. Domseiff F. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. — Berlin, 1965.
4. Faulsett D., Kühn G. Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen
Sprache. — Leipzig, 1968.
5. Fleischer W,, Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —
Leipzig, 1977.
6. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. — M., 1963.
7. Stepanova M.D., Cemyseva LI, Lexikologie der deutschen Gegenwarts-
sprache. — M., 1986.
8. Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. — Hei-
delberg, 1931.
82
9. Wehrte E., Eggers H. Deutscher Wortschatz. — Frankfurt/M., 1968.
10. JleeKUH B.R. CöopHHK ynpaxueHHM no jickcmkojiofhh HCMeiiKoro
03biKa. — M.» 1973.
11. PaüxtumeÜH A.ß. Tckctli jickijwh no 4>pa3eojiornn coBpeMCHHoro hc-
neUKoro «3biKa: Bonpocbi (JjpaseojiornqecKOM ceMaHTHKH. — M., 1981.
Kapitel 6
WORTSCHATZ MIT BESONDEREM
GELTUNGSBEREICH
§ 22. Stilistische Werte des allgemeinen Wortschatzes
Den meisten Sprechern steht ein verhältnismäßig kleiner Teil des rie-
sigen Wortschatzes der deutschen Sprache zur Verfügung. Dabei handelt
es sich in der Regel um den Wortschatz, der zur zwischenmenschlichen
Kommunikation notwendig ist, sowie um kleinere Wortschatzbereiche,
die nur bestimmten Personen, Gruppen, Schichten u. dgl. eigen sind.
Den zuerst genannten bezeichnet man als allgemeinen Wortschatz, weil
er von den meisten Mitgliedern der Sprachgemeinschaft verwendet oder
nur verstanden wird. Der zuletzt genannte wird dagegen als besonderer
Wortschatz bezeichnet. Es ist aber in vielen Fällen nur schwer möglich
die beiden Wortschatzbereiche ganz genau voneinander abzugrenzen,
denn das wichtigste Differenzierungskriterium bleibt der allgemeine Be-
kanntheitsgrad, der immerhin individuell zugeschnitten ist.
Das Vorhandensein eines allgemeinen Wortschatzes ermöglicht eine
sprachliche Verständigung und damit menschliches Zusammenleben.
Der besondere Wortschatz hingegen ermöglicht den gruppenmäßigen
Erfahrungsaustausch und aktiviert bestimmte Vorstellungen und Gefüh-
le. Mit den Elementen der einzelnen Wortschatzbereiche sind Stilwir-
kungen verbunden. Die letzteren bestehen sowohl in der Erreichung be-
stimmter S t i 1 z ü ge, z. B. größerer Anschaulichkeit, Klarheit o.Ä., als
auch im Auftreten einer bestimmten S t i 1 fä rbung, z.B. des lokalen
Kolorits, des zeitlichen Kolorits. Der deutsche Wortschatz lässt sich
nach den Gebrauchsweisen der Wörter in verschiedener Weise gliedern.
Die größte Gruppe bilden die am häufigsten verwendeten Wörter, die
der nur kommunikativen Verwendung bei gefühlsmäßig neutra-
1 e r Haltung vorbehalten sind. Diese Wörter erscheinen vor allem im
schriftsprachlichen Gebrauch in Massmedien, Sachbuchveröffentli-
chungen, im Wirtschaftsverkehr und in allgemein bildenden Texten. Sie
sind auch in der mündlichen Ausdrucksweise des öffentlichen Verkehrs
sowie in der Verkehrssprache der bildungstragenden Bevölkerungs-
schichten anzutreffen. Die Wörter aus dem allgemeinen Wortschatz
können je nach der Verwendungsweise und dem Textinhalt in ihrem Stil-
83
wert schwanken. Die Breite ihrer Verwendungsmöglichkeiten lässt es zu,
dass diese Wörter auch in Texten der Dichtung oder der Werbung begeg-
nen können, soweit es dabei nicht auf besondere semantische oder stilis-
tische Wirkungen ankommt. Dieser Teilbereich des allgemeinen Wort-
schatzes wird als normalsprachliche Schicht bezeichnet.
Als Teil der normalsprachlichen Schicht kann in bestimmten Gren-
zen auch der Wortschatz der Umgangssprache angesehen weiden, wenn
er nicht zu sehr von den Mundarten dominiert wird. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die jeweilige Umgangssprache, die als r e g i o n a 1 modi-
fizierte Ausdrucksweise der Hoch- und Schriftsprache verstanden
wird, in der Aussprache stärker mundartlich geprägt ist oder nicht. Al-
lerdings finden sich in der Umgangssprache immer wieder Wörter, die in
der normalsprachlichen Schicht nicht auftauchen. Solche Wörter der
Umgangssprache können den jeweiligen Texten ein bestimmtes Lo-
kalkolorit verleihen, die Texte bestimmten Landschaften zuordnen,
wo diese Wörter heimisch sind, z. B. Knödel, Janker, Leberkäse oder
Jänner im Bayerischen. Andere lassen ein sozial geprägtes Ko-
lorit in den hochsprachlichen Texten zu Stande kommen, das auf die
Sprache einfacher Menschen oder bestimmter Berufe verweist. Hier
aber streifen wir den Bereich des besonderen Wortschatzes. Der allge-
meine Wortschatz bildet ein heterogenes mehrschichtiges System, in das
sich noch weitere Schichten einreihen lassen, die oberhalb und unter-
halb der normalsprachlichen und der gehobenen umgangssprachlichen
Schicht liegen.
Die Grenzen zwischen den verschiedenen Schichten sind nicht
immer klar festlegbar und oft von der individuellen Einschätzung des
Sprechers oder Hörers abhängig. Das gleiche Wort kann in verschie-
denen Kontexten zuweilen einen unterschiedlichen Stilwert aufwei-
sen und unterschiedlichen Schichten angehören. Zum Beispiel kennt
das Verb „aufbauen“ mehrere normalsprachliche Verwen-
dungsweisen und Bedeutungen: „ein Haus bauen“, „etwas wieder-
aufbauen“, „Teile zusammenfugen“, „sich auf Gesichertes stützen“.
Daneben wirkt das Verb „aufbauen“ gehoben in solchen Verwen-
dungsweisen, wie Die Wolkenberge haben sich aufgebaut. „Aufbauen“
kann auch als metaphorisch-salopp empfunden werden,
wenn es in der Bedeutung „sich aufstellen“ gebraucht wird, z.B. Er
hat sich plötzlich vor mir aufgebaut. Solche stilistischen Unterschiede
sind oft das Ergebnis des Normenwandels, des so genannten Umnor-
mungsprozesses, der zu den Wandlungen in der Wortverwendung so-
wie im Stilwert führt. Das Wort „X\feib“ z.B. galt früher als normal-
sprachliche Bezeichnung für „Frau“, während „Frau“ ursprünglich
„eine adlige Dame“ bedeutete. Nachdem sich die Bezeichnung
„Frau“ für das ganze weibliche Geschlecht durchgesetzt hatte,
rutschte „das Weib“ in die salopp umgangssprachliche, ja sogar in die
vulgär sprachliche Stilschicht ab. Die Bedeutungsverschlechterung
führte zur stilistischen Umnormung.
84
§ 23. Der Fachwortschatz und seine stilistische Verwertung
Der Ursprung der Fachsprachen ist ohne Zweifel in der Arbeitstei-
lung zu suchen. Als die ältesten Fachsprachen werden die Sprache des
Bauern und des Fischers angesehen. Greifbar werden die deutschen
Fachsprachen erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, das uns zahlrei-
che schriftliche Zeugnisse überliefert hat. Heute unterliegen die alten
Fachsprachen einem starken Wandel, da die Technik das handwerkliche
Berufsbild entscheidend verändert hat. Mit Beginn der industriellen
Fertigung kann z. B. der Handwerker auf seinem Sektor meist nur noch
Teilarbeiten ökonomisch sinnvoll durchführen. Die deutschen Berufsfi-
scher beispielsweise stellen nicht mehr ihre Arbeitsgeräte selbst her und
erzeugen auch nicht mehr die Rohstoffe dazu. Sie bedienen sich der in-
dustriellen Produktion der Netzfabrik und des Schiffsbaus, um ihr Ar-
beitsgerät herstellen zu lassen [vgl. Fluck, 1996, 29]. Diese Reduktion
der traditionellen Aibeitswelt führte in einzelnen Berufszweigen zur Auf-
gabe der handwerklichen Produktion und damit auch zum Untergang
einzelner Fachsprachen. Fachsprachen aus theoretisch-fachlichen Berei-
chen sind ebenfalls seit dem Mittelalter in zahlreichen Texten überliefert,
z.B. in Texten aus dem Gebiet der Chemie, Medizin, Philosophie,
Rechtskunde und der „Kriegskunst“. Mit diesen Fachsprachen schufen
die Fachleute des Mittelalters die Voraussetzungen dafür, dass das Deut-
sche zueiner Sprache der Wissenschaft werden konnte.
Im Mittelalter und in der anschließenden Zeit waren die Fachgebiete
für den Einzelnen noch überschaubar, ihr Zusammenhang erkenntlich.
Mit den technischen Neuerungen und den immer rapider sich entwi-
ckelnden Naturwissenschaften, die im 18./19. Jahrhundert die industri-
elle Revolution auslösten, begann eine Auflösung der bis dahin einheit-
lichen Arbeitswelt und eine Spezialisierung innerhalb verschiedener
Wissenschaftsgebiete. Die Einrichtung von neuen Fächern und Diszipli-
nen führte zu einer Flut von praktischen und theoretischen Fachschrif-
ten und einem starken Wachstums- und Differenzierungsprozess unter
den Fachsprachen.
Im 20. Jahrhundert haben sich die wissenschaftlich-technischen
Fachsprachen explosionsartig zersplittert und erweitert. In der Chemie,
deren Gesamtwortschatz über 100000 Bezeichnungen zählt, wird allein
bei Handels- und Industriebezeichnungen ein monatlicher Zuwachs von
etwa 100 Bezeichnungen veranschlagt [s. Fluck, 1996, 32], Den Linguis-
ten gelang es in wenigen Jahren Material für Dutzende umfangreicher
Fachwörterbücher zu sammeln. Auf den Gebieten Datenverarbeitung
und Informatik wurden neue technische Felder sprachlich erschlossen.
Die Fachsprachen werden in immer stärkerem Maße internationalisiert
und kompliziert. Ihr Ausmaß und ihr Einfluss auf unser Denken und
Sprechen nimmt ständig zu. In wenigen Jahren haben sich mit der Dif-
ferenzierung einzelner Fachbereiche deren Terminologien verdreifacht.
Will der Einzelne am fortschreitenden Erkenntnisprozess teilhaben,
85
wird er immer mehr neue Wörter, Begriffe und Termini beherrschen
müssen. Von besonderer Wichtigkeit sind in den Fachsprachen die Fach-
wörter. Sie tragen die Aussage und konstituieren eigentlich die Fach-
sprachen. Ihre formale Seite, die Ausdrucksseite, deckt sich oft mit der
Formseite gemeinsprachlicher Wörter. Der Unterschied zwischen Fach-
wort und gemeinsprachlichem Wort liegt auf der Bedeutungsebene der
Inhaltsseite: dort wird für das systemgebundene Fachwort ein Bedeu-
tungsinhalt realisiert, der sich von der gemeinschaftlichen Bedeutung
grundsätzlich unterscheidet. Von Termini spricht man heute in einem
engeren und weiteren Sinn. Als Termini im weiteren Sinne werden Fach-
ausdrücke oder spezialisierte Bezeichnungen aufgefasst, wenn sie in ei-
nem Sachgebiet eindeutig bestimmbare Dinge bezeichnen. Mit dieser
Auffassung werden praktisch alle Fachwörter zu Termini erklärt. Der
Terminus im engeren Sinne hat die Aufgabe „einen im betreffenden Fach
exakt definierten Begriff oder Gegenstand eindeutig und e i n n a-
m ig zu bezeichnen“ (Benes, 1971, 750], Dieses Ideal ist aber durch die
Polysemie vieler Fachausdrücke nicht in jedem Fall zu erreichen. Des-
halb wird in vielen Fachbereichen versucht, durch Normung (Standardi-
sierung) eigene Terminologien aufzubauen und weiter zu entwickeln.
Dabei werden terminologische Systeme gebildet, bei denen die Bezeich-
nungsstruktur der logischen Begriffssystematik entspricht. Als Beispiel
führen wir nur ein terminologisches Feld an [vgl. Fluck, 1996, 46’]:
-Lager-
-Rollen-
-Kegel- Zylinder-
-Kugel-
I
Rillen-
Lager
Rollenlager
Kugellager
Kegelrollenlager
Zylinderlager
Rillenkugellager
Bei diesen terminologischen Feldern schränkt jeder weiter unten ste-
hende Begriff (Unterbegriff) den darüber stehenden Oberbegriff ein.
Der Praktiker sieht jedoch oft zuerst auf die Ausdrucksökonomie und
erst danach auf die Systemgebundenheit. Für ihn heißt „die Verbindung
mittels Widerstandspunktschweißens“ kurz „Verpunkten“. Und das
Wort „verpunkten“ findet demnach Zugang zu Fachzeitschriften. So er-
scheint neben den systembezogenen Fachwörtern eine große Anzahl
„unsystematischer“ Fachwörter. Neben exakt definierten Termini exis-
tieren zahlreiche Halbtermini oder terminologisierte Fachwörter.
Es gibt fast keine sprachlichen Merkmale, die für alle Fachsprachen
gültig wären. Jedes Fachgebiet besitzt seine sprachlichen Besonderhei-
ten. Trotzdem scheint es zweckmäßig zu sein die fachtechnischen Inge-
nieursprachen und die Fachsprachen der Basiswissenschaften voneinan-
der abzugrenzen, auf denen die menschliche Erkenntnis sowie der Wer-
degang dieser Erkenntnis beruhen. Solche Fachsprachen bedienen die
86
allgemein menschlichen Tätigkeitsbereiche, haben sich in der menschli-
chen Gemeinschaft schon längst etabliert, prägen und konstituieren
ganze Funktionalstile oder nur ihre Teilbereiche oder Genres, wie z. B.
die Sprache der Politik oder die des Rechts, bereicherten und bereichern
den allgemeinen Wortbestand der Sprache. Sie (diese Fachsprachen)
sind keine rein terminologischen Systeme mehr, sie haben ihre eigenen
Existenzformen im Schriftlichen und Mündlichen herausgebracht, sie
sind wie alle sprachlichen Systeme ganz besonders egozentrisch gewor-
den in dem Sinne, weil sie immer stärker in das individuelle Be-
zugsfeld des Sprechers oder des Hörers eingeschlossen werden und des-
sen Sicht, Emotionen und Reaktionen reflektieren, d.h. gefühls-
mäßige Elemente einschließen und nicht nur Fachterminologien. Ei-
nen Beleg dafür, wie sie (die Fachsprachen) sich zu einem eigenständi-
gen Denk- und Sichtsystem entwickeln können, liefert z. B. die Börsen-
sprache als gattungsmäßige Existenzform der vielschichtigen Fachspra-
che der Wirtschaft.
Die Wirtschaftssprache als solche ist verzweigt und übergreift die
Grenzen eines einheitlichen Systems. Sie zerfällt auf der einen Seite in
fachterminologische Teilbereiche je nach Fachrichtung (Mana-
gement, Marketing, Handel, Vertrieb, Büroverkehr, Steuern usw.), auf
der anderen Seite durchdringt sie alle Bereiche des menschlichen Le-
bens und Tuns und hält Einzug in fast alle schriftlichen und mündlichen
Formen der sprachlichen Existenz. Ein solches Phänomen in einem
Lehrbuch zu erfassen, wäre deshalb weder möglich noch ratsam.
Die Fachsprache des Börsenwesens hat sich z. B. auf eine spezifische
Weise — mündlich und schriftlich — konstituiert. An den Geld- oder
Warenbörsen wurden die Geschäfte zunächst mündlich geschlossen, an-
schließend wurde dann über die Xfereinbarungen eine Schlussnote ausge-
stellt. Im Mittelpunkt des Börsengeschäftes steht bis heute der Börsen-
kurs und seine Notierungen. In den Kursen spiegelt sich die aktuelle
Marktlage. Die Kurse werden in den Börsenberichten der Fachzeit-
schriften und auf den Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen abgedruckt
und von Fachleuten kommentiert. Ein Beispiel aus der „Frankfurter
Allgemeine“:
Von der besseren Stimmung könnten nach Einschätzung von Händlern
besonders Technologiewerte profitieren. Hier hätten die Titel des Netzwerk-
ausrüsters Applied Materials, die derzeit bei 19,46 Dollar notieren, noch Kurs-
potenzial. Auch die Aktien des weltgrößten Chipherstellers Intel, die bei
29,61 Dollar notieren, könnten auf mehr als 30 Dollar steigen. Die Papiere des
SAP-Konkurrenten Siebei Systems legten Ende der vergangenen Woche um 4,3
Prozent auf 11,00 Dollar zu und nähern sich damit dem 52-Wochen-Hoch von
12,23 Dollar. Das Unternehmen hatte auf Basis vorläufiger Berechnungen ei-
nen Gewinn im dritten Quartal entsprechend der Markterwartungen von drei
Cent pro Aktie genannt. Durch außergewöhnliche Kosten für Umstrukturie-
rungen ergebe sich jedoch ein Verlust. Der Umsatz wird voraussichtlich zwi-
schen 320 und 322 Millionen Dollar liegen.
87
Die Börsensprache erweist sich in diesen Vferöffentlichungen als eine
Kombination von Firmennamen, Kurszahlen, Abkürzungen und Fach-
termini. Die Sprache ist so hoch verdichtet, dass sie oft nur für Einge-
weihte, die Börsianer selbst, verständlich ist. Die Anhäufung von Fach-
termini wie Technologiewert, Titel, Aktie, Umsatz, Kosten setzt weitrei-
chende Sachkenntnis voraus. Der Außenstehende steht vor einer ver-
schleierten Wirklichkeit, die in den Börsenberichten durch ergänzende
metaphorische Bezeichnungen noch verdeckter und undurchlässiger
wird. Die Metaphorik der Börsenberichte kommt überwiegend aus den
zwischenmenschlichen Bereichen, solchen wie körperliche Ver-
fassu ng (sich erholen, sich bessern, beruhigen, schwach liegen, bessere
Stimmung, schlecht oder gut gelaunt sein, einen Zusammenbruch erleiden),
aus dem Bereich des Kampfes (sich durchsetzen, nachgeben, in die
Knie zwingen, sich behaupten, unterlegen sein, überlegen sein) oder des
Sports (zu den Spitzenreitern zählen, das Kopf-an-Kopf-Rennen, Favo-
rit sein) und aus dem Bereich der Bewegung (fallen, klettern, stürzen,
abrutschen, aufrücken, abrücken, anziehen, zurückgehen, das Hoch, das
Tief, sich nähern). Aus dem Bereich menschlicher Stimmung
werden zur Charakterisierung der Börsenlage solche Bezeichnungen
übertragen wie: freundlich, lustlos, ruhig, verstimmt, düster, betrübt. Die
meisten dieser metaphorisch gebrauchten Fachwörter vermitteln den
Eindruck von Bewegung und Dynamik. Die Ursachen dieser Bewegung
vermittelt die Sprache aber nicht; nach ihr geschieht alles gewisser-
maßen von selbst. Zu dieser Verstellung trägt der häufige Gebrauch re-
flexiver \ferben (sich abschwächen, sich behaupten, sich bessern, sich zei-
gen, sich halten) ganz besonders bei. Für die Börsensprache ist die Ver-
tauschung von Subjekt und Objekt, d. h. die Personifizierung der Objekte
kennzeichnend: „Die Märkte schlossen lustlos“, „Der Markt öffnete
freudlos“, „Öffentliche Anleihen konnten sich befestigen“. Das Wesen
der Börsenmetaphorik ergibt sich daraus, dass das Ergebnis menschli-
chen Handelns hier als handelndes Subjekt erscheint.
Selbstverständlich ist der Rahmen eines Lehrbuches zu eng, um alle
Fachsprachen wenn auch so kurz umreißen zu können, aber der Fachbe-
reich „Politik“ sowie der der Linguistik dürfen bei unseren Betrachtun-
gen nicht fehlen. Der Fachbereich „Politik“ umfasst so viele Teilgebiete,
dass man kaum von der Existenz einer einheitlichen politischen Fach-
sprache sprechen kann.
Die politische Terminologie und ihre Verwendungsweise sind stark
vom jeweiligen Gesellschaftssystem und dadurch vom Standort und Po-
sition des Beobachters abhängig, dieser Umstand erschwert die Suche
nach Abgrenzungskriterien gegenüber anderen Fachsprachen oder ge-
genüber der Gemeinsprache. Aus zahlreichen Arbeiten zur politischen
Sprache im geteilten Deutschland wird ersichtlich, wie stark die politi-
sche Terminologie an das jeweilige Ideologie- und Gesellschaftssystem
gebunden ist. Es genügt nur einen flüchtigen Blick auf den Duden West
(1961) und Duden Ost (1957) zu werfen, um sich davon zu überzeugen,
88
dass der ideologische Gehalt vieler Kernbegriffe der Sprache
der Politik je nach dem Blickfeld des Benutzers wesentlich modifiziert
werden kann. Im Duden West wird die Bourgeoisie als „wohlhabender
Bürgerstand“ definiert mit wagem Hinweis darauf, dass es auch „durch
Wohlleben entartetes Bürgertum“ sein kann. Der Duden Ost schreckt
nicht zurück die Bourgeoisie als „herrschende Klasse in der kapitalisti-
schen Gesellschaft“ abzustempeln [s. Dieckmann, 1972, 82],
Zu den wesentlichen Kriterien der Abgrenzung der politischen Spra-
che von den anderen Fachsprachen wird neben der oben erwähnten
Ideologiegebundenheit auch ihr Wirkungskreis gezählt. Die poli-
tische Fachsprache wirkt über den eigentlichen Benutzerkreis, d. h. den
Kreis von Fachleuten, weit hinaus und reicht bis in den Kreis der Betrof-
fenen, der politisch null engagierten Bürger. Die Auswahl der sprachli-
chen Mittel hängt in diesem Fachbereich viel mehr von der Funktion
der Sprache und vom Ziel der Aussage ab. Es besteht ein erheblicher
Unterschied, ob zum Beispiel eine politische Kommunikation unter
Fachleuten des Finanzministeriums, innerhalb einer Partei oder zwi-
schen einem Politiker und seinen Wählern stattfindet.
Will man die Sprache der Politik grob einteilen, erhält man nach
W. Dieckmann eine Dreiteilung in eine Ideologiesprache und eine
Verwaltungssprache [vgl. Dieckmann, 1972, 47— 50], Die Ideologie-
sprache besteht aus den Bezeichnungen für die politische Doktrin; die
Institutionssprache aus den Bezeichnungen für die einzelnen Institutio-
nen und Organisationen, ihre interne Gliederung, die Aufgaben, die sie
erfüllen, und die Prozesse, in denen sie funktionieren; die Fachsprache
des „verwalteten Sachgebiets aus den politischen Sprachformen, die sich
mit der staatlichen \ferwaltung der verschiedenen Sachgebiete ergeben“
[s. Dieckmann, 1972, 50].
Zur Systematisierung von Untersuchungen der Texte und sprachli-
cher Ausdrücke im Bereich der Politik wird von Han s-R. F1 u c k fol-
gende Übersicht gegeben [vgl. Fluck, 1996, 78]:
Funktionsbereich intim schriftlich öffentlich intim mündlich öffentlich
Verwaltung und Organisation Aktenvermerk Erlasse etc. Verhandlung —
Gesetzgebung und Verträge — normative Texte Verhandlung —
Propaganda (poli- tische Meinungs- bildung) — Publizistik etc. — Rede, Diskussion
Politikwissenschaft — Texte — Lehre (Rede und Diskussion)
89
Der dritte Funktionsbereich, die Propaganda, rückt am häufigsten in
den Blickpunkt der Forschung. Die öffentliche Sprache der Politik wird
durch ihren rhetorischen Charakter bestimmt. Denn ein Redner,
der im Bundestag, auf einer Wahlversammlung oder in einem Fernseh-
interview zu Wort kommt, muss versuchen, seine Vorstellungen und
Meinungen als die richtigen, einzig gültigen darzulegen. Dazu
bedient er sich der Mittel der R h e t o r i k: er wirkt viel verheißend, in-
dem er mit ideologiegebundenen und inhaltlich vagen Begriffen spielt
wie Gleichheit, Globalisierung, Öffnung, Transparenz, Gemeinwohl und
Armutsbekämpfung. Er gebraucht appellative Wendungen in
der Hoffnung engeren Kontakt herstellen zu können und seinen Ein-
fluss zu verstärken, z. B.: ff7r Europäer, Unser Anliegen ist gemeinsam',
Wir tun auch weiter unser Bestes und unternehmen gemeinsame Anstren-
gungen usw. In der politischen Auseinandersetzung werden Einwände
der Gegenseite vorweggenommen, die eigenen Vorzüge werden stärker
herausgehoben. Die Information, die die eine Seite vermittelt, wird für
die andere zur Propaganda. Während für die vermittelnde Seite die Xör-
züge der Globalisierung, solche wie der uneingeschränkte Transfer von
Waren, Arbeitskräften und Dienstleistungen', die Öffnung der nationalen
Grenzen und Märkte oder Zugang zu Hochtechnologien eindeutige Verzü-
ge sind, befurchtet die Empfängerseite, dass sich für sie aus diesen Vor-
zügen Nachteile ergeben in Form von Diskriminierung, Entrechtung,
Verdrängung und Vernachlässigung. In jedem Fall ist die politische Spra-
che auf die Zustimmung der öffentlichen Meinung gerichtet. Die Exis-
tenz mehrerer Parteien, und nicht nur in der Bundesrepublik, macht es
notwendig eine möglichst breite Zustimmung zu finden. Deshalb hat der
Informationsgehalt der sprachlichen Äußerungen vor dem Affektiven
und Überzeugendem zurückzutreten. Das Publikum, das durch die
Sprache der Politik angesprochen wird, ist nicht homogen, deshalb muss
die sprachliche Äußerung von der einen Seite aus lexikalischen Einhei-
ten von größtmöglicher Allgemeinheit bestehen und da-
rüber hinaus eine starke affektive Komponente besitzen. Diese
Doppelfunktion der sprachlichen Einheiten bildet wohl das herausra-
gendste Spezifikum der Fachsprache der Politik. Und eben sie hat in der
letzten Zeit die Linguisten dazu veranlasst, sich verstärkt der Wirksam-
keit der politischen Sprache zuzuwenden.
Die Sprache in der Linguistik ist eine wissenschaftliche Fachsprache.
Aber auch sie wirkt teilbereichübergreifend, denn sie ermöglicht es über
die Sprache als Instrument der menschlichen Kommunikation zu spre-
chen. Eine solche Sprache, die die Kommunikation über eine Objekt-
sprache erlaubt, heißt Metasprache. Das Spezifikum dieser Sprache liegt
vor allem in ihrer Terminologie. Unverkennbar ist die Internatio-
nalisierung der linguistischen Fachsprache, die so weit fortgeschrit-
ten ist, dass es zwischen Sprachinteressierten und Linguisten oft zu
schwer überwindlichen Sprachbarrieren kommt. Zu den Kommunikati-
onsschwierigkeiten führt nicht allein der Umstand, dass die linguistische
90
Terminologie mit zahllosen Neubildungen und Fremdwörtern übersät-
tigt ist. Hier herrscht auch noch die Tendenz zu individueller Ter-
minologie und zur Um-und Neudefinition bereits bestehender
Termini [vgl. Fluck, 1996, 81]. Die Sprachforscher von gestern begnüg-
ten sich mit einer geringeren Anzahl von eng spezialisierten Fachwör-
tern und drückten ihre Verstellungen und Gedanken über das Funktio-
nieren und den inneren und äußeren Aufbau der sprachlichen Einheiten
im allgemein gültigen und allgemein verständlichen Deutsch aus, in
dem sie auch öfters zu veranschaulichenden Metaphern gegriffen haben,
um die Funktionsweisen der Sprache herauszustreichen. Bei W. Hum-
boldt zum Beispiel bietet die Sprache der Linguistik eine spannende
Geschichte an mit bildhaften Ausdrücken durchsetzt wie beherrschen,
besiegen, einen Kreis um sich ziehen usw.
Die linguistische Terminologie von heute ist neutraler bei der Bewer-
tung und präziser im Informationsgehalt. Aber oft verliert sie an Allge-
meinverständlichkeit und behindert den Transfer der Erkenntnisse und
Ergebnisse. Die semantischen Merkmale werden z. B. nebeneinander als
„semantische Atome“, „Komponenten“, „Seme oder Bedeutungspri-
mitive“ verwendet. Diese Vielfalt im Fachwortschatz tritt als Störung auf
dem Wege zur Erkenntnis auf und wirkt verwirrend auf jeden, der sich
auf einen „Dschungeltrip“ durch die Sprachforschung begibt. Auf der
anderen Seite musste diese terminologische Vielfalt entstehen, weil die
heutige Sprachwissenschaft durch die zunehmende Verbindung mit
Nachbardisziplinen um- und neuorientiert wurde. Ohne sprachlichen
Zuwachs wäre eine solche Neuorientierung nie möglich gewesen.
So entstanden die gemischten Terminologien in solchen linguistischen
Teilbereichen wie Soziolinguistik, Psycholinguistik, Neurolinguistik
und kognitive Linguistik. In der Sprache der Linguistik wurden mehr-
mals \brsuche unternommen aus dem Zustand der sprachlichen Verwor-
renheit durch Formalisierung herauszubrechen. Mathematische For-
meln und Symbole z. B. bei der Konstituenten-Analyse sollten dazu ver-
helfen Objektivität und Präzision zu steigern und die Forschungsergeb-
nisse auf eine höhere Abstraktionsstufe zu heben, damit sie gewichtiger
und glaubwürdiger aussehen. Aber wenn man statt „Satz“ das Symbol S
einführt und P statt „Prädikat“ einsetzt, wird stillschweigend vorausge-
setzt, dass das Wesen dieser Phänomene von vornherein genügend er-
fasst, ermittelt und allen Empfängern gut vertraut ist, was nicht immer
der Fall war und ist. Zum Zweiten konnten die Formalisierungen linguis-
tischer Grundbegriffe nicht davon befreien, die Benennungen zu erklä-
renden Zwecken in Wortgestalt zu kleiden. Es kostete einen doppelten
Kräfte- und Zeitaufwand die Formalisierungen zu entschlüsseln. Eine
Fülle von wetteifernden linguistischen Schulen, der Aufbau von „priva-
ten“ Fachterminologien, die oft von einem oder einigen Sprachfor-
schern intern „geschmiedet“ werden, sowie der unverkennbare Drang
der Sprachforscher, ins Nachbarlaboratorium „hineinzugucken“, zu se-
hen, wie es „beim guten Nachbarn geht“ und was hier „zu haben“ wäre,
91
haben dazu geführt, dass die Metasprache der Linguistik zu einem be-
liebten Quellenstoff für Parodisten und Parodien wurde, wie es zu den
Zeiten von H. Heine auch war, der sich öffentlich über die Schreib- und
Sprechweisen der deutschen Universitätsgelehrten mokierte, indem er
sie über die Elefantenbeine traktieren ließ.
Die Träger der Fachsprache der Linguistik sind heute ganz besonders
der Gefahr ausgesetzt, dass ihre Streite und Dispute um Sprachphäno-
mene in Zwistigkeiten darüber entarten, was dieser oder jener Terminus
in irgendeiner eng spezialisierten privaten Terminologie eines regional
oder international renommierten Sprachforschers bedeutet und was un-
ter diesem Terminus zu verstehen ist. Läuft das terminologische Treiben
auch weiter auf vollen Touren, so werden die Linguistikprofessoren eine
Figur aus der bekannten Parodie von H. Heine abgeben, die als Ergebnis
ihrer Forschungsstudien schreibt bzw. spricht: „... und in der grundge-
lehrten Abhandlung, so die Resultate dieser Studien enthalten wird, spreche
ich 1) von den Füßen überhaupt, 2) von den Füßen bei den Alten, 3) von
den Füßen der Elefanten, 4) von den Füßen der Göttingerinnen, 5) stelle
ich alles zusammen, was über diese Füße auf „Ulrichs Garten“ (Vergnü-
gungslokal) schon gesagt worden, 6)... “
§ 24. Einfluss von Fachsprachen auf die Gemeinsprache
Der fachsprachliche Einfluss auf die Gemeinsprache nimmt durch
grundlegende Veränderungen im kommunikativen Bereich ständig zu.
Der Austausch zwischen Fach- und Gemeinsprache hat noch nie zuvor
solche Ausmaße erreicht. L. Mackensen stellte bei einer Zählung
fest, dass von 33 470 umgangssprachlichen Wörtern 3763 aus der Tech-
nik gekommen sind oder technischen Inhalt haben [vgl. Mackensen,
1971,57]. Die Technik und das Internet sind heute der größte
Transformator im Bereich der Sprache und beeinflussen die Gemein-
sprache am nachhaltigsten. Wissenschaft und Technik wirken auf die
Gemeinsprache in erster Linie über die Konsumtion von technischen
Gütern (Fernseher, Auto usw.) oder über die Konsumtion von Wissen
(Raumfahrt, Transplantation, Hausbau usw.) ein. Der Austausch geht
vor allem in den Bereichen schnell vor sich, wo wissenschaftlich-techni-
scher Fortschritt über die Produktion auf das alltägliche Leben des Ein-
zelnen zurückwirkt. Fachsprachen bzw. fachsprachliche Elemente drin-
gen auf verschiedenen Wegen in die Gemeinsprache ein. Das wichtigste
Transportmittel bilden heute die M a s s e n m e d i e n, die ständig über
neue Techniken und neue Erkenntnisse berichten. Es sind auch F a c h-
und S a c h b ü c h e r, die für eine breite Öffentlichkeit als Informations-
quelle dienen. Zum Dritten ist es die Wirtschaftswerbung, die
sich für einen besseren Verkauf fachsprachlicher Elemente bedient.
Der fachsprachliche Einfluss auf die gemeinsprachliche Lexik
kommt in einer verstärkten Vermehrung des Wortschat-
92
z e s zum Ausdruck. Diese Vermehrung erfasst heute den unmittelbaren
Lebensbereich, Arbeitsbereich, Ausbildungs- und Freizeitbereich. Jeder
weiß heute von Hormonen, Konjunktur, Hi-Fi-Anlagen, Tuning, Fach-
und Sozialkompetenzen, von Personalpolitik usw. Bescheid. Durch die
Massenmedien beteiligt sich der Sprachträger an vielen Ereignissen und
Entwicklungen zugleich. Zeitungen und TV-Informationsprogramme
bringen ihm täglich neues Wortmaterial. Der Sprachträger verarbeitet
dieses Material und schließt es zum Teil in seinen individuellen Wort-
schatz ein. Heute sind es die modernen wissenschaftlich-technischen
Bereiche, die als Hauptquelle für Wortübernahmen dienen. Sehr viele
tauchen zuerst in der Umgangssprache auf, erst dann expandieren sie in
andere Bereiche und Schichten der allgemeinen Sprache. Allein das In-
ternet hat über die Umgangssprache der Computerfans den allgemeinen
Wortbestand der deutschen Sprache um Tausende Fachwörter er-
weitert, und das Ende der Expansion ist immer noch nicht abzusehen.
Sehr viele ursprünglich fachliche Intemetbezeichnungen dringen als
bildkräftige Neuwörter für alle Dinge, Vorstellungen und Vorgänge in
den allgemeinen Usus ein und leuchten ihn neu, frisch und bildlich aus.
Wer noch gestern angerufen wurde, wird jetzt „momentan abgeklickt“.
Was früher ausgeschaltet wurde, wird jetzt „ausgeflippt“. Das früher Ge-
prüfte wird heute „abgechekt“.
Groß ist der Einfluss der Fachsprachen aus Sport und Wehrwesen,
der sowohl in der Schriftsprache als auch in der gesprochenen Sprache
zur Geltung kommt: Würden wir heute das Sprachporträt eines Nor-
malsprechers und Schreibers aufzeichnen, würde es sich wesentlich
davon abheben, was früher im sprachlichen Usus der Sprachträger
fixiert werden konnte. Zwar gibt es auch heute sozial-, bildungs- und
altersmäßige Abschattungen im individuellen und gruppengebundenen
Sprachgebrauch, aber sie sind schon längst nicht mehr so stark ausge-
prägt wie etwa zu den Zeiten von Thomas Mann. Und das nicht zuletzt
dank den fachsprachlichen Einflüssen auf die gemeinsprachliche Le-
xik. Der heutige Sprachträger „nimmt eine Hürde“ und besteigt „das
Sprungbrett“ zum Erfolg, er „sammelt Punkte“ und „boxt seine Ideen
durch“, er „setzt zum Endspurt an“ und leistet seinen Freunden
„Schützenhilfe“, er bestimmt die „Marschrichtung“ und „torpediert“
die gegnerischen Pläne, allerdings „entgleist“ auch er zuweilen, insbe-
sondere wenn er „frustriert“ ist und viel zu lange „schizophren“ am
„Netz hing“, anstatt die „durchgebrannten Kontakte“ wieder zu „sen-
sibilisieren“. Nach Angaben H. Reuthers betrug 1959/60 der Anteil
des Sports am Gesamtumfang der Tageszeitungen 8,5 %, des Rund-
funkprogramms 1,4%, des Fernsehprogramms 13,8% [s. Reuther,
1959, 92-100].
Inzwischen liegen diese Prozentzahlen wesentlich höher. Aber auch
die angeführten Zahlen vermitteln eine Vorstellung von der Wirkung, die
von der Sportberichterstattung in sprachlicher Hinsicht ausgeht. Durch
die Fachsprachen finden auch zahlreiche Fremdwörter in den national-
93
sprachlichen Wortschatz Eingang. Die Einwirkung der wissenschaftlich-
technischen Fachsprachen hat auch zu einer qualitativen Veränderung
der Gemeinsprache geführt, die als „Verwissenschaftlichung“ oder „In-
tellektualisierung“ bezeichnet wird. Im lexikalischen Bereich erfolgt die
„Intellektualisierung“ der Gemeinsprache unter dem Einfluss der wis-
senschaftlich-technischen Fachsprachen derzeit vor allem dadurch, dass
(1) Fachausdrücke für Gegenstände und Erscheinungen der geistigen
und materiellen Kultur aus den entsprechenden Fachsprachen in die
Gemeinsprache eindringen (z. B. Basis, Perspektive, Analyse, Durchlauf-
erhitzer)} (2) der Bedarf an neuen Bezeichnungen, der mit der Entwick-
lung im Bereich der materiellen Kultur entsteht, durch die Spezialisie-
rung bereits vorhandener gemeinsprachlicher Wörter gedeckt wird (z. B.
Stromnetz, Verkehrsfluss, Fertigungsstraße)', (3) einerseits spezialisierende
Ausdrücke bevorzugt werden, die sich durch Eindeutigkeit auszeichnen
(z.B. Weltrohstoffmärkte, Weltklasseläufer, Fernsprechvermittlungsanla-
ge)', (4) andererseits Ausdrücke mit weitem Bedeutungsumfang, die der
Generalisierung dienen, häufige Verwendung finden (z. B. Anlage, Ele-
ment, Struktur, Objekt, Subjekt) [vgl. Hahn, 1983, 52]. Die Verwendung
von generalisierenden Abstrakta dringt in immer weitere
Lebensbereiche ein und erfasst immer tief greifender den alltäglichen
Usus. Das bewirkt oft modische Verwendungsweisen, die in vielen Fäl-
len zu anspruchsvoll und zu unpräzise zu sein scheinen, wie etwa Kom-
posita mit „System“ als Basiswon: Abwehrsystem, Baukastensystem, Bil-
dungssystem, Buchungssystem, Kassettensystem, Kontaktsystem, Maschi-
nensystem, Regelungssystem, Steuerungssystem, Vertriebssystem usw.
Außer einer zumeist sachlich begründeten Übernahme fachsprachli-
cher Elemente in die Gemeinsprache gibt es auch noch andere Über-
nahmen von fachsprachlichen Elementen. Sie haben eine andere Funk-
tion: zum einen die Funktion als literarisches Stilmittel, zum
anderen die Funktion als Ve r k a u f s h i 1 f e im Bereich der Warendis-
tribution. Bei diesen Funktionen besteht an sich genommen keine sach-
liche Notwendigkeit für fachsprachliche Bezeichnungen.
Die Werbesprache, wie sie in Werbespots, Anzeigen, Prospekten,
Werbeblättern usw. erscheint, bildet keine Fachsprache. Sie dient nicht
zur Verständigung unter Fachleuten, sondern dazu, bei einer Zielgruppe
Wünsche zu wecken und Produkte zu verkaufen. Diese für die Öffent-
lichkeit bestimmte Sprache wird auch als Reklame- oder Propaganda-
sprache bezeichnet. Es gibt zahlreiche hoch spezialisierte Produkte, für
die man bei Werbung und Verkauf nicht ohne eine fachsprachliche Aus-
drucksweise auskommt, wenn man den Käufer ausreichend informieren
will, z. B. bei fototechnischen Geräten:
Synchronisierter Schlitzverschluss von 1 Sek. bis 1/1000 Sek. — echte
Wechselobjektive — von 24 bis 1000 mm — Zubehör für Mikro- und Makrofo-
tografie u. a. m. — Lichtschacht — oder Prismensucher — Schnittbildentfer-
nungsmesser — auswechselbare Mattscheibe — Filmschnelltransport mit Ver-
schlussaufzug gekoppelt.
94
Aber die fachsprachlichen Ausdrucksweisen werden auch dort ge-
braucht, wo die sprachliche Kennzeichnung der Waren und deren Ei-
genschaften mit Wörtern der Gemeinsprache vollkommen ausreichend
wäre. In solchen Fällen handelt es sich um pseudowissenschaf t-
liche Ausdrucksweisen in der Wirtschaftswerbung. Sie dienen allein
dazu, fachliche Qualität und Perfektion zu suggerieren, den Verbrau-
chern mit der Sprache zu imponieren. Das Pseudo-Fachwort bezweckt
die Manipulation, die manchmal dazu führt, dass der Käufer irregeführt
wird. Die Werber bemühen sich um die Aufwertung der Produkte, wenn
sie z. B. Wirkstoffe und WirkstofTkombinationen gebrauchen, die für den
Konsumenten keinerlei Information besitzen und oft nur Fantasie-
namen darstellen. Kein Mensch wird sich vorstellen können, was z. B.
„Sunil mit Heliopur“, „Anti-Enzym BX“ oder „Wirkstoff Syloan“ sind
und warum sie bei Haarspray oder Kosmetika wirksam sein müssen. Die
pseudo-naturwissenschaftliche Ausdrucksweise wird häufig dermaßen
übertrieben, dass die Werbung für Haarwäsche wie eine wissenschaftli-
che Abhandlung aussieht:
Jarl — das Haar-Frisch-Tonicum mit den naturkräftigen Wirkstoffen: Jarl-
Haar-Frisch-Tonicum ist eine Wirkstoffkombination für Kopfhaut und Haar; sie
enthält: Natriumpantothenat (gegen Schuppenbildung), Biotin (gegen Schä-
den der Kopfhaut), Meso-Inosit (zur Förderung des Haarwuchses) und Poly-
oxyäthylensorbitanmonolaurat, das Jarl direkt an die Haarwurzeln bringt.
Die Werbespezialisten empfehlen aber, Fachausdrücke nach Mög-
lichkeit zu vermeiden, wenn beim Adressatenkreis nicht mit Vorinfor-
mationen über die darzustellenden Sachverhalte gerechnet werden
kann, doch wird dieser Rat von den Werbetextern kaum beachtet.
Die fachsprachlichen Elemente in literarischen Texten haben genau
so wie in den Werbetexten andere Aufgaben als sachliche Information
und Kommunikation zwischen Fachleuten. Sie können zwar auch hier
dem Außenstehenden mit dem Wort eine Vorstellung von der Sache ver-
mitteln, daneben aber werden sie dazu verwendet, bestimmte literari-
sche Wirkungen zu erzielen. Sie dienen zur Zeichnung des Arbeits-
kolorits, zur Charakterisierung von Zeit, Gegenstand oder
Person, zur Verlebendigung einer Schilderung. In der Belletristik
ist das Fachwort seit langem bei Vertretern der literarischen Richtungen
bekannt, die auf Realitätsnähe abgezielt sind. Wenn die fach-
sprachlichen Elemente mit künstlerischem Vermögen eingesetzt wer-
den, tragen sie wirklich dazu bei, die Arbeitsatmosphäre zu stilisieren
und die literarische Schilderung lebenswahr zu machen. Aber die fach-
sprachlichen Ausdrucksweisen, geschickt eingesetzt, können auch als
Techniken zur Personcharakterisierung fungieren, wie das
z.B. Heinrich Mann in seinem Roman „Der Untertan“ macht. Der
Hauptheld Diederich gehört nicht zu den Leuten, die sich in ihren weit
gehenden Anmaßungen zurücknehmen können. In der Fabrik seines
Vaters will er jedem vor Augen führen, wie umfassend seine Kenntnisse
95
sind und wie gut er sich nicht nur mit den Leuten, sondern auch mit
Maschinen auskennt. Seine Anmaßung und Arroganz kennt keine
Grenzen, durch den Gebrauch von technischen Bezeichnungen für die
Maschinen und Arbeitsabläufe will er seine Überlegenheit gegenüber
dem alten Meister behaupten. Überhaupt muss er sich im Leben mehr-
mals gegen andere Leute behaupten, denn sein Lebensziel ist, so groß
und bedeutend zu werden, wie keiner vor ihm. Außer den fachmänni-
schen Bezeichnungen flicht Diederich auch kaufmännische Ausdrücke
in seine Reden ein, um dem alten Meister nachdrücklich zu beweisen,
dass er hier kein Außenseiter, sondern der alleinige alles verstehende Be-
sitzer ist:
„Ich bin von dem Holländer nämlich enttäuscht... Die Messerwalze sollte
doch viel breiter sein, wo bleibt da die höhere Leistungsfähigkeit, die die Leute
uns versprochen haben? Halten Sie den Zug für gut? Ich fürchte, der Stoff
bleibt liegen...“ Napoleon Fischer [der Meister] teilte seinem Arbeitgeber mit,
daß die neue Erwerbung nichts tauge. Der Stoff blieb liegen, man mußte mit
dem Rührscheit nachhelfen, wie bei jedem Holländer ältester Konstruktion.
„Also der offenbare Schwindel!“ rief Diederich... „Das ist vertragswidrig!...
Dann können Sie mir also bezeugen, daß der Holländer die bei der Bestellung
vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt!“
In der Belletristik gibt es Genres, die es darauf abzielen fachsprachli-
che Elemente einzusetzen. Das sind Science-Fiction Romane und Zu-
kunftsromane. In diesen Romanen wird oft mit besonderer sprachlicher
Sorgfältigkeit der Stand der Wissenschaften beschrieben, was zwangs-
läufig die Verwendung der fachsprachlichen Elemente bewirkt, wobei
viele Fachwörter eben so wie in der Werbung kein Echtprodukt, sondern
Einbildung und Nachahmung sind, extra mit der Aufgabe be-
traut, die Echtheit der Szene zu suggerieren. Die Einsatzmöglichkeiten
fachsprachlicher Mittel in Presse- und Illustriertenberichten oder
Rundfunk- und Fernsehreportagen ist ebenso mannigfaltig wie in der
Belletristik. Aber all diese Einsatzmöglichkeiten sind einem höheren all-
gemeinen Ziel untergeordnet: sie müssen den Schein der Glaub-
würdigkeit aufrechterhalten.
Jede Fachsprache kann auf einer höheren Stufe der stilwissen-
schaftlicher Abstraktion als Nomenklatur angesehen werden, d. h. als
Wortbestand eines lexikalischen Teilsystems mit besonderem Geltungsbe-
reich. Zwar hat dieser Wortbestand bei seiner Umsetzung in Texte auch
syntaktische Besonderheiten, aber sie sind kaum als absolut zu betrach-
ten. Die Rede geht vielmehr genau so wie bei dem wortbildenden Aspekt
der Fachtermini um Bevorzugungen, um Präferenzen im Gebrauch dieser
oder jener syntaktischen oder wortbildenden Modelle, z. B. des Modells
mit dem Suffix -er mit Tätigkeitsbedeutung {Rechner, Endverzweiger^
Drehflügler, Heckstarter usw.) oder der bevorzugten Verwendung der passi-
vischen Satzausformungen, der kausalen und attributiven Nebensätze bei
erläuternden technischen Beschreibungen und anders mehr. In ihrem
96
Gebrauch sind die Fachsprachen an bestimmte Darstellungsarten und
Genres gebunden, die als solche mit gewissen Abwandlungen der allge-
mein gebräuchlichen Sprache vorbehalten sind: technische/wissenschaftli-
che Beschreibung, Erläuterung, Schilderung, wissenschaftliche Abhandlung,
wissenschaftliches Referat, Problemaufsatz in einer Fachzeitschrift, Experi-
fnentbericht usw Aber im Unterschied zu dem allgemeinen Wbrtbestand
haben die Fachsprachen eine zweite Realisierungsstufe oder
Ebene entwickelt und zwar die des beruflichen Verkehrs. Bestimmt treten
sie (Fachsprachen) als Basisstruktur auf, enthalten aber eine breite Palette
von eigenartigen Zügen, je nachdem, in welchen berufsspezifischen Um-
gang sie geraten: ein Physiker wird sich jedes Mal andere Sprechverhal-
tensmuster anlegen müssen, wenn er z. B. mit seinen Laboratoriumskolle-
gen oder zu Hause vor seinen erwachsenen Kindern von seinen Experi-
menten spricht. Im Umgang mit seinen Kollegen kann er es sich leisten,
weniger aufwendige und bemühungseinsparende Gebrauchstechniken
anzuwenden, für die (weniger) verstehenden Söhne und Frau kommt er
nicht umhin Erklärungen der fachspezifischen Begriffe in seine Rede ein-
zusprengseln. Seine sprachliche Identität aber bleibt in allen Fällen ge-
wahrt, als Physiker wird er sich in jedem Teilusus erhalten wollen und er-
halten können. Das, was seine fachsprachliche Identität aufrechterhalten
lässt, ist eben die zweite niedere Stufe der fachsprachlichen Umsetzung in
der Rede, die berufsspezifisch ausgerichtet ist. Eins hatte es fast nur Be-
rufssprachen gegeben, weil die fachsprachlichen Nomenklaturen noch gar
nicht herausgearbeitet waren. Das waren die Sprachen der diversen Hand-
werksberufe, z. B. die der Fischer oder Seeleute oder die der Töpfer. Auch
heute noch leben die genannten Berufe weiter, aber es ist gar nicht dazu
gekommen, dass sie eine systematisierte und stabile Nomenklatur der
Fachtermini entwickelt haben. Die Sprache des Berufsfischers wird auch
heute „weitgehend mündlich konstituiert und ist dialektgebunden“
[Huck, 1974, 72].
Die Berufssprache der Fischer wird z. B. vom Dialekt bestimmt.
Auf dialektaler Grundlage bilden sie die Bezeichnungen für das Boot
und seine Teile, für Fanggeräte, Fangtechniken, wichtige Naturbedin-
gungen und vor allem für die Fische. Alemannisch heißt z. B. der Fi-
scherkahn „Waidli“, der junge Hecht „Hierli“, die Fischbrut „Soome“
[s. Fluck, 1974, 93].
Auffallendes Kennzeichen der dialektalen Berufssprache ist ihr Zug
zur Anschaulichkeit und Konkretheit. Es zeigt sich in zahlreichen me-
taphorischen Benennungen der Geräte. So heißt in der alemanni-
schen Fischersprache ein Setz- und Schiebehamen, mit dem der Fischer
am Ufer entlang streift oder Vertiefungen ausfischt, bildlich „Störch-
lein“. Ganz vermenschlicht wird im Pommerschen die Nadel zum
Knüpfen der Netze; sie besitzt „eine Nääs oder Schnuut, ein Ooch
(Auge), eine Tungen (Zunge) und zwei Fäut (Füße)“ [Fluck, 1974, 102].
Auch die deutsche Verwaltungssprache könnte zu den Berufssprachen
gezählt werden, denn sie bildet fast kein Spezialvokabular, sondern be-
4 EoraTbipeua
97
nutzt in ihren Äußerungen weit gehend den allgemeinsprachlichen
Wortschatz. Zwar entwickelt dieser Wortschatz oft eine andere inhaltli-
che Ebene, als die gleichen „Lauthüllen“ im allgemein sprachlichen
Usus, aber die neuen Inhalte lehnen sich in einer für den Sprecher gut
verständlichen Wbise an die allgemein usuellen Bedeutungen an. So
wird z. B. verwaltungsintem nicht nur eine kurze Notiz, sondern jede
Aufzeichnung „Vermerk“ genannt. „Vorgang“ bezeichnet nicht einen
Ablauf, sondern einen Einzelfall, eine Akte. Mehrgliedrige Zusammen-
setzungen wie „Lastenausgleichsbewilligung, Lastenausgleichsleistun-
gen“ usw. sind typische Verwaltungswörter, entstehen aber nicht auf An-
forderung des Sprachsystems, sondern einzig mit dem Ziel eindeutig
zu wirken, zugleich aber allgemein verständlich zu sein. Also
sind sie mehr eine Angelegenheit des öffentlichen Verkehrs mit den Bür-
gern. Sie entspringen somit einer besonderen inneren Einstellung des
Redeproduzenten, seinem Wunsch und seiner Absicht auf jeden einzel-
nen Bürger einzugehen, indem der Bezug der Rede auf fachmännische
Ausdrucksweise deutlich erhalten bleibt. Die tägliche Wrwaltungsarbeit,
die Ausübung eines Verwaltungsberufs ist so ziemlich eine Routine, die
zu einer gewissen Schabionisierung fuhrt. Manche Schablonen
sind mit der Zeit erstarrt, aber sie bilden im Prinzip kein Hemmnis im
Verstehensvorgang, weil sich der Rezipient, öfters und regelmäßig mit
dem Verwaltungssystem konfrontiert, an die Schematisierung der Spra-
che sowie an den Verlust der Anschaulichkeit gewöhnt hat und von sei-
ner Seite keine anders gearteten Ansprüche an die Verwaltungssprache
stellt. Im mündlichen Xferwaltungsvcrkchr werden allgemeine Formen
der Gegenwartssprache gebraucht (zumindest angestrebt). Die Verwal-
tungssprache hebt sich nicht nur von den üblichen Fachsprachen ab,
weil sie keine terminologische Bindung hat und nicht in Wbrtnomenkla-
turen erfasst werden kann. Sie stellt auch streng genommen keine ein-
heitliche Berufssprache dar. Sie ist mehr ein Instrument, mit dessen
Hilfe der Verkehr der beliebigen Machtinstanzen mit dem einzelnen
Bürger, Stadtverwaltungen, Bahn, Post, Polizei, Justiz, Finanzämtern
und Ministerien zu Stande kommt.
In der Fachsprache Chemie offenbaren sich deutlich die zwei schon
oben erwähnten Existenzebenen. Neben der strengen Wissenschafts-
sprache, die in wissenschaftlichen Abhandlungen vorkommt, gibt es den
„Laborslang“, welcher vom Betätigungsfeld herkommt und sich stark an
die Umgangssprache anlehnt. Hier werden oft affektische und m e-
taphorische Bezeichnungen sowie Kurzformen gebraucht. Da
stehen wieder 3 Kipps im Stinkzimmer herum — soll bei der Berufsbetäti-
gung der Chemiker im Laboratorium „Da stehen wieder 3 Kippsche
Apparate im Laboratorium“ heißen. Im Laborbereich sind metaphori-
sche Bezeichnungen bei der Beschreibung von Versuchen und der Be-
nennung von Geräten üblich: „Sumpf* bedeutet einen bräunlich bis
schwarzen, breiartigen Destillationsrückstand; „Birne, Bombe, Schiff-
chen“ stehen bildlich für bestimmte Laborgeräte. Der Laborchemiker
98
verzichtet im Umgang mit Kollegen gern auf die Formeln, die in Fach-
büchern und wissenschaftlichen Abhandlungen fachsprachespezifisch
wirken. Für die chemische Verbindung H2O verwendet er lieber „Lach-
gas“, für HNO3 „Scheidewasser“ nach der Fähigkeit, Gold und Silber
voneinander zu trennen, für HCN „Blausäure“ nach der Eigenschaft,
mit bestimmten Metallen Berliner Blau zu erzeugen.
Viele fachtechnische Sprachen haben auch außer dem streng wissen-
schaftlichen Bereich mit dem Fachwort oder Terminus als konstituie-
rendes Element, den unmittelbaren Gebrauchsbereich, z. B. die Pro-
duktion oder die Betreibung. Erzeuger und Betreiber stützen sich zwar
auf den streng wissenschaftlichen Bereich, weichen aber in ihren
Sprechverhaltensmustern von dessen streng terminologischen Ge-
brauchsweisen ab und schaffen ihren eigenen Slang, dem seinerseits ge-
wisse Gesetzmäßigkeiten eigen sind. Zum Einen handelt es sich bei den
Sprachen der Fertigung, Montage, Installation um werkstattinterne
Kommunikationen, in denen der Faktor der sprachlichen Re-
dundanz gebrauchsmodifizierend auftritt. Die bei der Fertigung be-
schäftigten Arbeiter haben ungefähr gleiche Verstellungen über Produk-
tionsabläufe, eventuelle Störungen, Pannen und Wege zu ihrer Beseiti-
gung. Sie müssen auch nicht ihre Gedanken explizieren, wenn sie mit
ihren Kollegen an der Basis kommunizieren. Oft reicht allein ein Wort,
um verstanden zu werden. Daher kommt ein unverkennbarer Trend län-
gere und sehr lange Fachtermini zu kürzen. Das geschieht aus sprach-
ökonomischen Gründen, die im Sprachgebrauch universell wirksam
sind.
In den Fachsprachen, wie sie im mündlichen Verkehr umgesetzt wer-
den, werden mehrgliedrige Zusammensetzungen bei eindeutigem Situa-
tionshintergrund auf Kurzformen gefasst: z. B. „Trapezgewindeschleif-
maschine“ wird zur einfachen Schleifmaschine, „Rotationskolbenmo-
tor“ — zum Kolbenmotor, „Mehrfachfräsmaschine“ — zu Mehrfräser
usw. Der Umgamg im Beruf und besonders bei der Ausübung des Beru-
fes kann auch von der wertenden Modalität des Sprechers nicht frei ge-
halten werden. Jede menschliche Tätigkeit, auch die Redetätigkeit, ist
von gewissen schöpferischen Mechanismen geprägt, die die
sprachliche Entwicklung bewirken. Mit umgedeuteten und expressiv
wirkenden Werkzeugbenennungen fällt es dem Produktionsarbeiter ge-
wissermaßen leichter mit der Berufswelt zurechtzukommen und sich
über all die Routineabläufe hinwegzusetzen, die aus der tagtäglichen
praktischen Arbeit kaum wegzudenken sind. Es schafft Abwechslung,
wenn „Werkstücke“ z.B. mit Verkleinerungssuffixen versehen
und personifiziert werden. So werden z.B. verschiedenartige
Schlüssel zum Auf- und Verschrauben mit Kosenamen der Personen be-
nannt (der große und kleine Heinzi), was für die vertrauliche Atmosphäre
am Arbeitsplatz sorgt und ein vertrauliches Verhältnis zwischen Mensch
und Instrument sowie Produkt seiner Arbeit schafft. Als charakteristi-
sches Kennzeichen der fertigungstechnischen Fachsprache fungieren
99
auch zahlreiche Verbalisierungen substantivischer Einheiten bei der Be
Zeichnung der Vorgänge und Tätigkeiten z. B. warzen („Bleche mit eine
Vvärze zur Nietung versehen“), verachsen („schräg bohren“), ausbau
chen („einen Hohlkörper durch Drücken oder Spreizen aufweiten“)
eindocken („einen dünnen Stempel zum Schutz gegen Bruch mit eine
Hülse-Docke versehen“), ausbüchsen („ein verbohrtes Gewindelocl
aufbohren“), abmanteln („die Isolierung abmachen“). Viele von solche]
Verben sind metaphorisch umgedeutet, wie z.B. halsen, bau
chen, warzen. Die Metapher liegt mit ihren vielfältigen Einsatz- und Bi]
dungsmöglichkeiten im gegenwärtigen Trend, was die Individualisierung
der Arbeitswelt angeht. So wandelt die Arbeitswelt zu einem vertrauli
chen Umgang des Menschen sowohl mit Werkzeugen als auch mit Kol
legen um und „intimiert“ die Atmosphäre. „Die Kleine gehört hierher“
sagt der Installateur und nimmt die Mutter aus der Kiste, um sie an de
richtigen Stelle anzuschrauben. „Jetzt muss der Große etwas schlanke
werden“, wendet er sich an den Bolzen, bevor er ihn im Schraubstocl
befestigt. Mit Metaphern wird die Aibeitswelt nicht mehr so monotoj
und langweilig, mit Metaphern schwindet die Entfremdung zwischei
Mensch und Maschine, mit Metaphern kommt ein neues Gefühl auf
das Gefühl der Gemeinsamkeit.
Mit fachsprachlichen Metaphern bei der Benennung der Flugzeug)
kann man angenehme Emotionen bei den Rezipienten zu Tage fördern
z.B. „Caravelle“, „Sokol“, man kann den Passagieren das Gefühl de
Sicherheit suggerieren, z.B. „Viking“, aber auch einschüchtem ließt
sich mit solchen Flugzeugnamen wie „Thunderflash“ oder „Phantom“
Das kognitive Eindringen in die Welt, mit dem Ziel zu erkennen, wa
diese Welt „im Innersten zusammenhält“, war und bleibt ohne Meta-
pher nur beschränkt vorstellbar. Je komplizierter die Dinge in der um
umgebenden Welt liegen, desto stärker ist der Hang ausgeprägt, sie mi
Hilfe einer Metapher zu erschließen. Der Physiker besitzt zwar du
Möglichkeit, mit Hilfe mathematischer Formeln sich exakt auszudrü-
cken, dennoch bleibt für ihn die Sprache ein unvermeidliches Mediun
der Verständigung und der Erkenntnis. Die Erkenntnis erfolgt nicht zu-
letzt durch die Suche nach Analogien zwischen dem, was schon erkann
worden ist und dem, was noch zu erschließen und zu erkennen ist. Au
diese Weise entstanden in der Fachsprache Physik sehr viele meta-
phorische Umdeutungen aus der Gemeinsprache. Unter dei
Atomphysikem hat sich zum Beispiel neben mathematischen Formulie-
rungen der Quanten- und Wellenmechanik eine physikalische Umgangs-
sprache herausgebildet, in der man zur Beschreibung der kleinsten Teile
der Materie verschiedene anschauliche Bilder verwendet.
Man spricht hier von „Wellen“ oder „Teilchen“, von „Elektronen-
bahnen“ und „Zusammenstößen“, von „Kollisionen“, „Attraktion*
und „Zusammenprallungen“. Man spricht von „Strahlungsfluss“ un(
„Lichtstrom“, von „Flussdichte“ und „Durchflutung“. Das sind nich'
einfach Wörter aus der Gemeinsprache, das sind hier fachspezi-
100
fisch verwendete gemeinsprachliche Metaphern. Die Begriffsbil-
dung erfolgt hier über Ähnlichkeitsoperationen und beruht auf einer ge-
wissen Stabilität zwischen der gewöhnlichen Sprache, wie man sie
schreibt und spricht, und sprachlichen Neubildungen in jeglicher Form.
In den vergangenen Jahrzehnten erwuchs auf vielen Gebieten von
Fachwissen, Arbeitstechniken, Arbeitsmaterialien und Erzeugnissen die
ökonomische Notwendigkeit Normen zu setzen. Die institutionelle Nor-
mung in Deutschland beginnt im fachsprachlichen Bereich im Jahre
1917. In diesem Jahr wurde der „Normalienausschuss für den allgemei-
nen Maschinenbau“ gegründet. Der genannte Ausschuss wurde dann im
Laufe der Zeit zum Normenausschuss der deutschen Industrie erweitert,
der heute unter dem Namen „Deutscher Normenausschuss“ (DNA) die
nationale Normung betreibt. Ihm gehören 121 Fachnormenausschüsse
und selbstständige Arbeitsausschüsse mit etwa 2000 Unterausschüssen
und Arbeitskreisen an. Einer von den Arbeitsausschüssen ist der Aus-
schuss für Terminologie, der an der internationalen Normungsarbeit
teilnimmt und die Einführung der Normen in dem terminologischen
Wartbestand fördert.
§ 25. Sozial-, territorial-, alters- und geschlechtsmarkierte
Ausdrucksweisen als Widerspiegelung
der gesellschaftlichen Verhältnisse
I. Sozial markierte Ausdrucksweisen. Die Sprechweise eines Men-
schen ist durch ein Bündel von verschiedenartigen Variablen gekenn-
zeichnet. Einer der wichtigsten redeprägenden Parameter ist der g e -
sellschaftliche Status der Person, der des Öfteren mit seinem
Bildungsstand und seiner Vermögenslage gepaart wird. Natürlich ist das
Deutsch des Adels für heutige Sprachverhältnisse nur aus historischer
Sicht interessant, aber ohne Einblick in diese zeitlich entlegenen Ge-
brauchsweisen wäre die richtige Einschätzung des heutigen Standes nur
schwer möglich. Bei Th. Mann in seinem Roman „Buddenbrooks“ wer-
den die Sprechweisen der höheren gesellschaftlichen Schichten er-
schlossen, die zudem noch als Politiker auf städtischer Ebene und er-
folgreiche und tüchtige Geschäftsleute ihre Art und Weise sich sprach-
lich zu repräsentieren, entwickelt und lange Zeit beibehalten haben. Das
ist nicht die Sprache des dünkelhaften Adels, der sie sich zugelegt hat.
Eher ist es die Sprache eines aufgeklärten sprachbewussten und wohlha-
benden Bourgeois, die auch Th. Mann selbst gesprochen und geschrie-
ben hat. Die Sprache selbst übernimmt hier nicht nur und nicht so sehr
die mitteilende Funktion, viel mehr dient sie der Darstellung, der kunst-
vollen Darbietung der inhaltlichen Zusammenhänge.
Die Sprache wird selbst zu einem Darbietungsverfahren, das die han-
delnden Personen in den ihnen von Geburt an zugewiesenen Nischen
glaubwürdig und szenisch wirksam macht, indem sie den Leser intrigiert
101
und ihm Sprechmuster vorlegt, die er nicht oder nur selten erlebt hat.
Eine raffinierte Wortwahl aus dem allgemein gebräuchlichen
Wortbestand der Sprache führt dazu, dass manche Gebrauchsweisen der
Wörter den Anhauch des Gewählten vermitteln. Beim Lesen, genauer
gesagt, beim Versinken in diese Lektüre, spürt man sofort, dass man
heute anders spricht, einfacher, direkter, robuster vielleicht, ohne auf
den sprachlichen Ausdruck so viel Wert zu legen, denn die Sprache ver-
liert immer mehr an ihrem Statussymbol und wird lediglich zu einem
Verständigungsmittel. Die eingesprengselten Fremdwörter
schatten noch stärker die Eleganz des deutschsprachigen Ausdrucks ab.
Ihr Zweck ist es nicht nur höheren Bildungsstand und höheren Status zu
markieren. Sie sind hier, damit das sprachliche Gewand noch eleganter
und anspruchsvoller im Schnitt aussieht. Auch der syntaktische
„Zuschnitt“ (um das Bild zu erhalten) ist der gewählten Wortwahl
würdig: volle Satzstrukturen ohne schroffe Brüche und Änderungen bei
Satzbauplänen, keine Hast, nur noch Ausgewogenheit und Ausgegli-
chenheit zwischen Satz- und Textteilen. Die ganze Syntax atmet Ruhe
und Würde aus, die man auch „im Landschaftszimmer, im ersten Stock-
werk des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Jo-
hann Buddenbrook vor einiger Zeit käuflich erworben hat“, spürt und
genießt. Hier einige Beispiele, die dem heutigen Leser Aufschlüsse ver-
mitteln über die Statussprache der höheren sozialen Schichten im deut-
schen Raum:
„Nein, Nein“, sagte der Konsul. „Kopf hoch, Toni, courage! Eines schickt
sich nicht für alle. Jeder nach seiner Art. Thilda ist brav, aber wir sind auch
nicht zu verachten. Spreche ich rational, Bethsy?“
Herr Jean Jacques Hoffstede, der Poet der Stadt, drückt sich etwa so
aus:
„Besten Dank für die freundliche Einladung, meine Hochverehrten. Diese
beiden jungen Leute haben wir in der Königsstraße getroffen, der Doktor und
ich, als sie von ihren Studien kamen. Prächtige Burschen — Frau Konsulin?
Thomas, das ist ein solider und ernster Kopf; er muß Kaufmann werden, da-
rüber besteht kein Zweifel. Christian scheint ein wenig Tausendsassa zu sein,
ein wenig incroyable... Allein ich verhehle nicht mein engouement. Er wird
studieren, dünkt mich; er ist witzig und brilliant veranlagt.“
Die alten Buddenbrooks sind sich ihrer Sprechweisen als Statussym-
bol vollkommen bewusst und gehen nur aus bloßem Vergnügen am
sprachlichen Spiel manchmal in eine andere Tonlage, in ein anderes
Register, wenn z. B. Johann Buddenbrook in seinen angestammten
Mutterdialekt verfallt, lediglich um seine Sprechweise ein wenig
spannender und abwechslungsreicher zu gestalten: „Öwer denn ookgliek
düchtig!“, und Johann Buddenbrook machte eine weite Armbewegung über
die Krögersche Verwandtschaft hin...
Die menschliche Sprache präsentiert sich im Unterschied zu den an-
deren Zeichensystemen nur selten manometrisch. Sie erschließt zu-
102
gleich mehrere Dimensionen und umfasst einige Parameter. Die
Sprechweisen der Angehörigen der Familie Buddenbrook heben nicht
nur ihre soziale Stellung, sondern auch ihre berufliche Betätigung he-
raus. Sie sind Kaufleute, und kaufmännisches Deutsch wird zu einem
systemhaften Bestandteil ihrer sprachlichen Äußerungen:
„Was tun?“ wiederholte der Konsul... Aber wenn ich ehrlich sein soll... ich
bin schließlich Associe... Was meine Schwester in Frankfurt betrifft, nun, so ist
die Sache arrangiert. Ihr Mann bekommt schon jetzt eine Abstandssumme, ein
Viertel bloß von der Hauskaufssumme... Das ist ein vorteilhaftes Geschäft, das
Papa sehr glatt und gut erledigt hat, und das im Sinne der Firma höchst erfreu-
lich ist... Ich habe die Interessen der Firma zu vertreten und... dem Betriebs-
kapital die Summe zu entziehen... Es handelt sich um mehr als 11 000 Kurant-
taler. Das ist gutes Geld... “
Nicht einmal der Zustand der Xbrliebtheit kann Thomas Budden-
brook dazu bringen zu vergessen, dass er vor allen Dingen Geschäfts-
mann ist mit allen Verpflichtungen, die sich aus diesem beruflichen
Stand ergeben. In seinem Brief an die Mutter schreibt Thomas über die
Geliebte und seine Heiratspläne: „Ich liebe sie, aber es macht mein Glück
und meinen Stolz desto größer, daß ich, indem sie mein eigen wird, gleich-
zeitig unserer Firma einen bedeutenden Kapitalzufluß erobere“
II. Territorial markierte Ausdrucksweisen. Während die gewählte
Schriftsprache ein Statussymbol der höheren und reicheren gesellschaft-
lichen Schichten ist, die außerdem mit mehr Bildung versorgt sind,
spricht das „niedere Volk“ um die „Herren Senatoren“ herum im Hafen
und Hafenspeichern, wo Wären umgeschlagen und gelagert werden, ein
gänzlich anderes Deutsch. Die Sprache ihres Umgangs zu Hause und an
der Arbeit ist Dialekt, der zu Buddenbrooks Zeiten (aber auch bisweilen
heute) einen niedrigeren sozialen Status signalisierte. Im Haus
Buddenbrook ist es zu einem Ritual geworden, dass ein Speicherarbeiter
des Konsuls mit einer Gratulationsrede erscheint, die vorwiegend im
Dialekt als Ausdruck seiner Unterwürfigkeit gehalten wird:
„Ick bün man’n armen Mann, mine Herrschaften, öäwer Glück un de Freud
von min Herrn, Kunsel Buddenblook, welcher ümmer gant tau mi west is, dat
geiht mi nah, und so bün ick kamen, um den Herrn Kunsel un die Fru Kunselin
un die ganze hochverehrte Fomili ut vollem Harten tau gratulieren... “
Aber damals herrschte noch zum Teil relatives Einvernehmen zwi-
schen höher und niedriger gestellten sozialen Schichten, Risse waren
noch nicht so tief, um sie nicht beheben zu können, deshalb scheuten
auch die höheren Schichten nicht davor zurück, ihre Nähe zum niede-
ren Volk, ihre Verbundenheit sowie ihr Zusammenhalten öffentlich zur
Schau zu stellen:
„Dank Ihnen, Grobleben! Dat is öäwer tau veel! Wat hebb’m Sei sik dat
kosten laten, Minsch! Um so’ne Red’ heww ick all lang nicht hürt!.. Na, hier!
Maken Sei sik’nen vergneugten Dag!“ Und der Konsul legt ihm die Hand auf
die Schulter, indem er ihm einen Taler gibt.
103
Der landschaftlich gebundene Wortschatz ist von großer stilistischer
Relevanz. Dabei sind zwei Erscheinungsweisen des regionalen Wort-
schatzes zu berücksichtigen: 1) der lokale Mundartschatz eines be-
stimmten Mundartgebietes, 2) der regionale Wortschatz einer Um^
gangssprache. Die Mundarten unterscheiden sich von Ort zu Ort und
weisen gewisse Rückgangstendenzen wegen Verstädterung dank Presse
und Fernsehen auf. Der sozialpolitische und wirtschaftspolitische Status
mancher Mundarten bleibt trotzdem sehr hoch, z.B. des Bayerischen.
Die landschaftlich gefärbte Umgangssprache lässt das grob Mundartli-
che weg, behält aber die sekundären Mundartmerkmale: Sprachme-
lodie, Aussprache, regional gebundene Wörter. Die
Mundart kann hochsprachlich auftreten, sie kann auch die Umgangs-
sprache prägen. Ein lyrisches Gedicht in der Mundart kann ein sprachli-
ches Kunstwerk sein. Die Predigt in einer Hamburger Kirche wird alle
Anforderung an die Hochsprache erfüllen müssen außer einer: die
mundartliche Lautung wird kaum schwinden, trotz dass der Predigende
die Laute klar, scharf abgehoben, plastisch schön herauszubringen be-
strebt ist. Ein guter plattdeutscher Erzähler wird, wenn er seine Lieb-
lingsgeschichte auftischt, die Mundart anders gebrauchen und innerhalb
der Mundart nach Kanonen der Hochsprache reden, als wenn er zu
Hause im Alltag seinem Arbeitsgehilfen auf dem Bauernhof eine Anwei-
sung gibt, z.B. ein Arbeitsgerät zu reinigen. Reine Mundarten werden
immer seltener und nur noch „zu Hause“ gesprochen. Ansonsten
fließen sie in die regionale Umgangssprache hinein, die größere Gebiete
ergreift und eine Art Ausgleichsergebnis aus einander benachbarten
Mundarten darstellt. Die regionale Umgangssprache nähert sich mehr
oder weniger der Gemeinsprache an. In Mundarten und regionalen
Umgangssprachen entsteht in jedem Menschen eine eigenartige Bin-
dung an die Gruppe, das eigentümliche W7r-Gefühl, dass man
durch sprachliche Eigentümlichkeiten mit ganz bestimmten Gruppen
und Schichten anderer Menschen vertraulich verbunden ist. Die Ver-
ständigung geht unter dem Begleitgefuhl der Geborgenheit: „Ja,
du verstehst mich. Du sprichst wie ich. Du gehörst zu uns.“ Der Schwa-
be, der Schweizer, der Bayer fühlen sich heimatlich berührt, wenn sie die
vertraulichen Klänge ihrer Mundart hören. Das Wir-Bewusstsein, wel-
ches dank Mundart und mundartlich gefärbter Umgangssprache ent-
steht, wissen die Politiker aller Ränge geschickt zu nutzen, wenn sie z. B.
verstärkt an ihre Wähler appellieren müssen und ihre Volkszugehörigkeit
sowie Verständnis für Probleme der einfachen Büiger herausstreichen
wollen. Als z. B. in Deutschland die Tierseuche grassierte, sah sich die
damalige Agrarministerin verpflichtet die Bauern zu beruhigen und be-
gab sich quer durch das Land auf eine Tour durch Bauemgehöfte. Um
sich bei den Bauern mit ihren Vorschlägen und Konzepten durchzuset-
zen und Kontakte zu knüpfen, bediente sie sich in Bayern der süddeut-
schen regionalen Umgangssprache, im Norden stellte sie sich auf platt-
deutsche Wörter aus dem Bauernlexikon um, was ihr nicht zuletzt half.
104
die Bauern zu beschwichtigen und ihnen die Angst vor notwendigen
massenhaften Tierschlachtungen zu nehmen. Wenn der Hamburger
Bürgermeister vor der unteren Kammer des Hamburger Parlaments, der
Bürgschaft, z. B. über das Jahressteuerergänzungsgesetz spricht, muss er
nicht so sehr nüchterne Sachverhalte darlegen (die kennt ja jeder), son-
dern viel mehr die alteingesessenen Hamburger dazu motivieren, dass
sie auch diesmal seine Steuervorschläge nicht blockieren. Kein einziges
Redekunstverfahren bleibt bei ihm ungenutzt, aber das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit entsteht erst, wenn er die Sprache der Hamburger
Bürgschaft spricht, d.h. regionale Umgangssprache, durchsetzt mit
plattdeutschen Ausdrucksweisen und städtischem Slang.
Mundarten und regionale Umgangssprachen lassen auch in der
schöngeistigen Literatur vielfältige stilistische Werte realisieren. Sie
schaffen ein bestimmtes Lokalkolorit und sorgen für glaub-
würdigere stilistische Charakterisierungen der han-
delnden Personen. Ein Beispiel dafür bietet Thomas Mann in den
„Buddenbrooks“:
„Und wenn ich ,Frikadellen4 sage, so begreift sie es nicht, denn es heißt
hier ,Pflanzerin4; und wenn sie ,Karfiol4 sagt, so findet sich wohl nicht so leicht
ein Christenmensch, der darauf verfallt, daß sie Blumenkohl meint; und wenn
ich sage:,Bratkartoffeln4, so schreit sie so lange ,Wahs!4, bis ich ,geröste Kartof-
feln4 sage...44
Tony, deren Sicht hier erschlossen wird, fallt es schwer, sich in Mün-
chen einzuleben. Sie fühlt sich hier immer noch etwas fremd und natür-
lich nicht, weil hier eine andere Sprache gesprochen wird, als zu Hause.
Sie sucht nur die Gründe ihrer inneren Missmut in äußeren Unterschie-
den, im Bereich des landschaftlich markierten Wortgebrauchs. Ihr
Mann spricht auch im Umgang mit ihr eine sehr verfremdende Sprache,
somit zeichnet sich schon auf der Ebene der sprachlichen Ausgestaltung
ein tiefer verwurzelter Konflikt der Charaktere, Auffassungen, Ansich-
ten und Lebensstile ab. Und mag ihr Mann auch so gemütlich reden,
wie es im Beispiel unten zum Vorschein kommt, ist er nicht in der Lage,
ihre Sehnsucht nach Zuhause zu löschen:
„Tonerl, mir war’s gnua. Mehr brauchen mer nimmer. Ich hab’ mi allweil
g’schunden und jetzt will i mei Ruh... und am Abend hab’ i’s Hofbräuhaus. I
bin ka Prozen net und mag net allweil a Gold z’ammscharn, i mag mei
G’mütlichkeit! Von morgen ab mach i Schluß und werd Privatier!44
Häufiger als solche „Sprachporträts“ finden sich einzelne land-
schaftlich gebundene Wörter bei einzelnen Autoren, beispielsweise
^estpreußische Wörter bei Günter Grass (difteln, Stert, Dootendetz, Pu-
scheln), berlinische bei Wölfdietrich Schnurre (Hopse, spinnete Tatzken,
Scharteke) oder bei Alfred Döblin in „Berlin Alexanderplatz“, kölnische
bei Heinrich Böll (Büdchen, Klüngel) oder schweizerische bei Max
Frisch.
105
Aber mit dem Schweizerischen hat es seine eigene Bewandtnis. Denn
hier steigen wir in die Problematik der national spezifischen Varianten der
deutschen Sprache ein. Die nationale Variante hat bestimmt einen ande-
ren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Status als regionale
Sprachen, obwohl sie ihr Spezifikum zumeist auch den Mundarten und
regionalen Umgangssprachen zu verdanken hat. Der Status als Amts-
sprache eines souveränen Staates lässt die nationalen Vari-
anten mit ihren sprachlichen Eigentümlichkeiten fast uneingeschränkt in
alle Bereiche des öffentlichen Lebens eindringen im Unterschied zu kon-
ventionellen Mundarten und landschaftlich gebundenen Regionalspra-
chen. Die nationale Variante ist an sich genommen Hoch- und Schrift-
sprache innerhalb eines eigenständigen Staates und ist mehrfiinktional,
indem sie den öffentlichen und privaten Verkehr bedient. Innerhalb der
genannten Verkehrsbereiche wirkt sie auch gerne- und stilprägend. Im
Funktionalstil des öffentlichen Verkehrs haben sich z. B. in Österreich be-
stimmte Bezeichnungen und Klischees eingebürgert, die im gesamtdeut-
schen Großraum zwar verstanden, aber nicht gebraucht werden. Auch
dem deutschkundigen Ausländer bereiten sie gewisse Probleme bei sei-
nem Gang durch österreichische Behörden: Erlagschein nennt man die
ganz gewöhnliche „Zahlkarte“, Bekanntmachung soll hier „Kundma-
chung“ sein, die Papiere treffen hier nicht ein, sondern langen ein', beistel-
len heißt hier „zur Verfügung stellen“, in den öffentlichen Formularen
steht hier das Nationale mit der Bedeutung von „Personalangaben“ usw.
In deutschsprachigen Massmediatexten der Schweiz und Österreichs
haben sich auch national spezifische Ausdrucksvarianten verankert:
„Der Direktorenrat“ heißt auf schweizerische Art und Weise das Direk-
torium', das Gewerbe kann auch „ein Bauerngut“ bedeuten, Umtriebe ste-
hen für „umständliche Zusatzarbeit und Zusatzausgaben“, harzige Ver-
handlungen sind „schwere langweilige Verhandlungen“, verkommen wird
da gebraucht, wo „Übereinkunft erreicht wird“, in die Kränze kommen
wird etwa mit einem Sieg (z. B. bei den Wahlen) gleichgesetzt, vor den
Wählen muss man sich zum politischen Kampf bereit machen, d. h.
schweizerisch in die Hosen steigen', Kantönligeist sieht nicht über die
Grenzen seines Kantons hinaus, was den heutigen gesamteuropäischen
Globalisierungs- und Öffnungsbestrebungen zuwiderläuft.
Einer der bekanntesten deutsch schreibenden schweizerischen Auto-
ren Max Frisch wirft in seinem künstlerischen Werk zwar gesamt-
menschliche Probleme auf, bindet aber seine Helden sowie deren
Handlungen im Großraum Europa an eine Stelle, die ihm (dem Autor)
selbst tief ins Herz vergraben ist, an die Schweiz. Bei solcher räumlichen
Bindung kann er nicht umhin, von schweizerischen Eigentümlichkeiten
intensiv Gebrauch zu machen: „...diegoldne Stille der Vergängnis, alles
wie verzaubert“', „Julika hatte damals einen Hund, einen Fox... oder in
der Sprache dieses Landes... Foxli“.
III. Altersmarkierte Ausdrucksweisen. Das menschliche Wesen ist
nicht nur ein Individuum, sondern auch ein S o z i u m und ist als sol-
106
ches an verschiedene Gruppen der Sprachträger gebunden, unter ande-
rem auch an bestimmte Altersgruppen. Aus linguistischer Sicht wäre es
bestimmt aufschlussreich die Altersgruppen in einer eng maschigen Ein-
teilung zu erforschen und die Sprech- sowie Verhaltensweisen der Zwan-
zigjährigen, Dreißigjährigen, Vierzig- und Fünfzigjährigen zu erfor-
schen. Aber da es nicht zuletzt aus rein verfahrenstechnischen Gründen
nur schwer oder gar nicht möglich ist, beschränkt man sich bis heute mit
der Erforschung der entgegengesetzten Altersgruppen: (1) der Gruppen-
sprache der Jugendlichen und (2) der (in sehr beschränktem Maße)
Gruppensprache der älteren (alten) Leute.
1. Die Älteren haben vieles an den Sprechweisen ihrer Kinder zu be-
mängeln. Dabei vergessen sie oft, dass sie in ihrer Jugend auch eine an-
dere Sprache gesprochen haben als ihre Eltern und Großeltern. Die Ju-
gend geht heute zum „Rave“, um „abzutanzen“, so wie die Eltern auf
den „Fez“ gingen, um zu „schwofen“. Anstatt „cool“ sind heute „voll-
fett“, „verschärft“ oder „entgeil“ angesagt. Klagen über die sprachverlu-
derte Jugend sind so alt wie die Sprache selbst.
Aber langfristig angelegte Studien belegen auch, dass die TV- und Vi-
deo-Generation den Oldies sprachlich keinesfalls unterlegen ist. Laut ei-
ner Studie im OECD-Raum aus dem Jahre 1996 waren die 16- bis
25-jährigen beim Lesen stärker als die älteren Befragten. Eine Tendenz
kommt allenfalls zum Vorschein, dass sich der Schreibstil der Jugendli-
chen dem Gesprochenen annähert. Elemente der Mündlichkeit prägen
die Arbeiten heutiger Abiturienten: sie haben einen emotional ge-
ladenen Erzählstil, schreiben unvollständige Sätze und
benutzen dabei umgangssprachliche Wendungen. Bei der
formalen Beherrschung der Sprache haben die heutigen Schüler viele
wunde Stellen, z. B. bei der Rechtschreibung, dafür sind sie im Mündli-
chen viel gewandter geworden als frühere Generationen. Die TV-Gene-
ration lebt im Kommunikations- und Informationszeitalter, aber das
wichtigste Kommunikationsmedium bleibt zum Glück immer noch die
Sprache. Deshalb werden die Anforderungen an die Sprachfahigkeit in
Schule und Beruf immer höher. Die Sprachkompetenz wird heute eben-
so verlangt wie die Fachkompetenz. Die Sprache ist ein Element der
Kultur, und die Jugendkultur verkörpert spezifische Werte, Ideale, In-
teressen, Xferhaltensweisen und interaktive Einstellungen.
Aber von einer einheitlichen Jugendkultur kann man unmöglich
sprechen, denn sie ist vielfältig und nicht homogen. Sie umfasst auch
verschiedenartige Subkulturen, z.B. die der Punks oder die der
Graffiti-Fans. Die Jugendlichen verkehren in einem ebenso vielschich-
tigen Kommunikationsumfeld, z.B. mit Erwachsenen, Lehrern, Ver-
einsfreunden, Geliebten usw. Die Ausdrucksweisen, wie sie von Jugend-
lichen produziert werden, müssen folglich je nach dem, an wen sie sich
richten, ziemlich stark variieren [vgl. KyabMHHa, 2000, 46]. Mit jedem
Jahr vermehrt sich die Zahl der Jugendmagazine und Jugendzeitschrif-
ten, die sich nur an bestimmte Gruppen der Jugendlichen wenden und
107
nicht an Jugendliche en gros. „Auto-Touring“, „Hörzu“, „Bravo Sport“
bemühen sich erfolgreich um männliche Leser, während „Bravo Girl“,
„Brigitte“ und „Freundin“ für weiblichen Leserinnenkreis werben. Auch
genremäßig werden die Ausgaben für Jugendliche so gefächert, dass die
eigenartige soziale Situation der Jugendlichen nicht unberücksichtigt
bleibt. Die Jugendlichen zeichnen sich sozial als Gruppe dadurch aus,
dass sie sich im Leben erst anpassen müssen. Sie adoptieren sich an die
soziale Umwelt, sie gliedern sich ein, sie reihen sich in die Welt ein und
suchen hier nach ihrem eigenen Platz. Sie erschließen für sich die räum-
lichen, zeitlichen und persönlichen Koordinaten der Welt, in die sie
hineinwachsen.
Die Massenausgaben verwenden für Jugendliche als Rezipienten der
sprachlich spezifisch ausgestalteten und inhaltlich an be-
stimmte Themen gebundenen Botschaften auch spezifische
Genres und Rubriken, die den Jugendlichen dazu verhelfen sollen, er-
wachsen, wissend und verstehend zu werden. Dazu gehören z. B. solche
Genres wie „praktische Tips“, „Empfehlungen“ und „Konsultationen“.
Wegweisende und aufklärende Funktionen übernehmen z.B. solche
Rubriken wie „Sprich dich aus beim Dr.-Sommer-Team“ in „Bravo“,
„Liebe-Beratung“ in „Popcorn“ oder „Per E-Mail zum Job“. Die Aus-
gaben für Jugendliche können nicht umhinkommen, sich ihrerseits auf
die Sprach- und Sprechgewohnheiten der Jugendlichen einzustellen
und bei all ihrer hohen Mission den Jugendlichen „auf den Mund zu
schauen“, wenn sie akzeptiert werden wollen. Bei der Wortwahl richten
sie sich an dem literarisch-umgangssprachlichen Ge-
brauch, der für Jugendliche ein gewohntes sprachliches Milieu darstellt.
Weiterhin wird der so genannte Jugendslang gebraucht, unter dem meist
emotional gefärbte, oft umgedeutete Ausdrücke aus der allgemeinen
Sprache verstanden werden, die vom normalen Gebrauch abweichen
und das Besondere der Gruppe gegenüber allem zum Ausdruck bringen,
was außerhalb der Gruppe liegt.
Hallo Zahn (Mädchen)! Hallo Typ (Junge)! Ist meine Schlägerpfanne
(Kopfschutz der Mopedfahrer) nicht das Allegrößte? Willste was auf meinem
Feuerstuhl gefahren werden? Steh ich nicht drauf (das bereitet mir keine
Freude). Außerdem habe ich die kanischen Röhren (amerikanische lange
Hosen) nicht dabei. Was für Ischen (Mädchen) gibt’s denn hier? Wollen wir
’ne Menage (Essen) nehmen? Ne, lieber ein Rohr brechen (eine Flasche trin-
ken). Ich finde sie ein bißchen krank (blöd). Aber für dein vergammeltes Pen-
nerkissen (unordentlicher langer Haarschnitt) ist sie vielleicht nicht so un-
dufte (unpassend). Willste nicht mit in die Scheune (Kino) gehen? Es gibt da
den letzten Heuler (großartiger Film). Die Lappen (Geld) kommen von mir.
Ich bin zwar noch die Miete für den Stall (Wohnung) scharf (schuldig), aber
ich werde wegen der Mäuse (des Geldes) sowieso noch mit meiner Regierung
(Eltern) sprechen. Schaff dich nicht (Bemühe dich nicht). Der Film ist ’ne
ziemliche Verlade (nichts Besonderes), und Cooper finde ich ’nen ziemlich
finsteren Hirsch (langweilig). Ne, ich passö (verzichte). Tschau! Du bist ein
108
Unhahn (Nörgler). Guck dir doch bloß mal dahinten die Wuchtbrumme
(Mädchen) an.
(zit. nach: .Hcbkhh, 1973, 197)
Zum Jugendslang werden auch Wörter hinzugerechnet, die das Be-
sondere im sprachlichen Gebrauch der Schüler und Studenten heraus-
streichen und zumeist bildkräftige Umdeutungen der allge-
mein gebräuchlichen sprachlichen Einheiten sind, z. B.: Pauker („Leh-
rer“), Quittung („Zeugnis“), einhauen, einklauen, einkritzeln, einmalen,
einpinseln („schreiben“), Fuchszettel, Schnurzer, Schummelzettel, Spicker
(von den Schülern angefertigte „Hilfsmittel“), Brummer, Doppelalter,
Großvater, Hüter („Sitzengebliebener“), Schlusslicht („Klassenletzter“),
Mangelkontakt („mangelhaftes Auffassungsvermögen“), durchfliegen,
durchhauen, durchkrachen, durchplumsen, durchrasseln, vorgelingen
(„die Prüfung nicht bestehen“).
Die Jugendsprache ist durchsetzt von Modewörtern, die übrigens mit
der Zeit einander abwechseln, Anglizismen und Amerikanismen, die ih-
ren Verwendungsbereich in der Jugendsprache immer wieder erweitern,
sowie Wörtern, die eine bestimmte Subkultur innerhalb der Jugendkul-
tur kennzeichnen, z. B. die der Hardmetaller, Computerkids, Compu-
tergameboys, der Sportfans usw. Als Beispiel sei an dieser Stelle ein Aus-
zug aus der Zeitschrift „Play“ gebracht, in dem das neue Computerspiel
unter Einsatz der Sport- und Computersprache beschrieben wird:
Eine Kickersimulation im wahren Sinne des Wortes. Die Minimännchen
von sensibler Software sehen aus wie Gummikameraden, die Ihr normalerweise
in der Kneipe gegenüber findet. World of Soccer (Spielname) ist gerade als
Budgettitel zum Billigpreis aufgelegt worden, ob Ihr Eure hart verdienten Mü-
cken (Geld) dafür anlegen sollt, könnt Ihr mit diesem Demo (Computerdisket-
te) feststellen.
(zit. nach: KyabMwua, 2000, 60)
Der nächstfolgende Text soll ein typisches Redeprodukt der Jugend-
lichen veranschaulichen, wobei es sich mit Bestimmtheit sagen lässt,
dass sich die Jugendsprache je nach der Zeit stärker oder schwächer
wandelt, wie auch eine jede „verschlüsselte“ Gruppensprache. Mit der
Zeit muss der Code wenn nicht gewechselt, so doch abgeändert werden,
damit der geschlossene abgrenzende Charakter der
sprachlichen Kommunikation bewahrt bleibt und keine Gewöhnung
und „Entschlüsselung“ eintritt:
Hallo, Christa, old Girl\ Ausgerechnet in der Berliner City muß ich dich
Wiedersehen! Chic siehst du aus, Darling. Aus unserem Baby ist ein richtiger
Vamp geworden. Einen schauen Pulli hast du an. Ich hätte dich bald nicht wie-
dererkannt; dabei hast du doch so ein fotogenes Gesicht. Aber etwas mehr
Make-up würde ich dir doch empfehlen, ein wenig Rouge unterstreicht deinen
Teint. Ja, Christa, das war eine Zentralschaffe, als wir noch Teenager in der
Tenne waren! Du musst mich unbedingt besuchen, Sweetheart\ Ich habe eine
dufte Bude mit einer satten Schlummermutter. Morgen abend gebe ich eine Par-
109
ty mit kleinen Drinks und Evergreens. Du kommst doch? Das wird eine Show,
wenn ich dich Freddy und den anderen Boys vorstelle! Wir mixen uns einen
Extra-Cocktail auf dein Comeback. Hier hast du meine Adresse, ich hab’s jetzt
eilig. Freddy erwartet mich zur Weekendtour. Ich muss mir noch den Bikini ho-
len und die Shorts anziehen. Für den Campingplatz ist der Petticoat zu schade,
außerdem nicht fair beim Hulahoop-Turnier. Von deinen Hobbys mußt du mir
morgen erzählen. Ich komme jetzt übrigens gerade von der Uni, baue doch im
nächsten Jahr mein Examen in Germanistik. Du weißt ja, für Fremdsprachen
habe ich keine Begabung. So long, Christa, keep smiling\“
(zit. nach: /JeBKnn, 1971, 198)
Die Jugendlichen erkennen die Welt nicht so sehr auf rationellem
Wege, sondern viel mehr durch ihre Emotionen, Gefühle, gefühlsmäßi-
ge Reaktionen. Einbildung, gesteigerte Emotionalität, Leidenschaft-
lichkeit prägen nicht nur die \\ährnehmung der Welt durch Jugendliche,
sondern auch ihre Art, sich sprachlich zu präsentieren. Auf der einen
Seite scheuen die jungen Leute vor Schablonen zurück, auf der anderen
Seite geraten sie oft auf schablonhafte Gleise, wenn z. B. die Rede von
Liebe geht. „Mein allerliebstes Herz“ — mit diesen Worten wird einer
der Liebesbriefe eingeleitet, die die Redaktion des Jugendmagazins
„Junta“ in ihrer Rubrik „Zarte Botschaften“ bringt. Am 10. Mai 1694
wurde bekanntlich der erste Liebesbrief mit gleicher Anrede durch die
Post befördert, den der Dichterfürst Goethe an seine Freundin Charlot-
te von Stein schrieb. Er schrieb an seine Geliebte 1700 Briefe und ge-
brauchte ungezählte zärtliche Anreden. Seine „zarte Botschaften“ ka-
men an und Charlotte schrieb über Goethe: „Er ist mir wie ein schöner
Stern, der mir vom Himmel gefallen.“ Auch in heutigen Briefen
„schmilzt“ man „von unendlicher Liebe“, erlebt „das Feuerwerk der
Gefühle“, „erobert das Herz“ und übermittelt „leidenschaftliche Küs-
se“. Auch heute sind Liebesbriefe ein eigenartiges Genre der „Jugend-
prosa“, in dem sich „die Seelen öffnen und berühren“:
Liebe Renate!
Wenn du über die Straße gehst, klopft mein Herz wie verrückt. Ich brauche
dich, wie eine Beule auf meinem Rücken. Du bist so schön, wie eine Rose. Ich
liebe dich mehr als meinen Computer, obwohl er schöner ist. Du fehlst mir im-
mer, zumindest an jedem zweiten Tag. Du bist meine süße Sahnetorte. Ich
könnte dich vernaschen. Deine Augen leuchten, wie Sterne am Himmel. Du
bist für mich die schönste (nach dem Computer).
P.S. Liebe Renate, wenn dir mein Vorschlag nicht gefallt, dann sollst du in
der Anrede den Namen ändern und den Brief an Susi weiterschicken. Danke!
Dein Peter
HO
Wbnn man den oben angeführten Brief liest, kann man nur schwer
das Gefühl loswerden, so etwas irgendwo schon gelesen zu haben. Man
kann hier leicht eine unbewusste Andeutung, Allusion an das schon von
der Schule her bekannte Gedicht von H. Heine spüren:
Wenn ich an deinem Hause
des Morgens vorüber geh,
so freut mich, du liebe kleine,
wenn ich dich am Fenster seh.
Offensichtlich gelingt den Jugendlichen nicht immer die Flucht vor
der Schablone, insbesondere bei Liebe. Aber so „zärtlich“ wie in ihren
Liebesbriefen sind die Jugendlichen im Verkehr mit Gleichaltrigen nicht
immer. Wenn ihnen jemand oder etwas missfallt, fallt ihnen gar nicht ein
ihre Abneigung diplomatisch durch einen milderen sprachlichen Aus-
druck zu verschleiern. Familiär abschätzig werden die Personen
bezeichnet, die am anderen „gegnerischen“ Ende des Kommunikati-
onsaktes stehen: Idiot, Mama-Bubis, Trottel, Trampel, Weib, Nutte,
Schlampe, Mistgurke, Hure, Flittchen, Kuh, Zicke, Bullen („Polizisten“),
Pack, Pisser, dreckiger Verräter, der fiese Mensch, der eckligste aller Men-
schen und Ähnliches mehr. In ihrer Beziehung zu den anderen verfallen
die jungen Leute oft in extreme Wertungen, denn im verworrenen
Knäuel der gesellschaftlichen Verhältnisse fühlen sie sich oft unterlegen
und missverstanden. Sie sind oft auch feindselig zu denjenigen einge-
stellt, die angeblich von ihrer alters- und erfahrungsmäßigen Überlegen-
heit zu sehr oft Gebrauch machen: vor allem sind das Lehrer, Erzieher,
Eltern [s. Ky3bMHHa, 2000, 87]. So schreibt z. B. eine Schülerin über die
Klassenreise nach Italien:
Vor langer, langer Zeit regierten der mächtige König Gerhard von Germa-
nia und die holde Königin Hedwig von Geographien Seite an Seite zwei neben-
einander liegende Reiche in H-25 und H-26. Diese beiden Herrscher beschlos-
sen eines Tages mit ihrem Hofstaat gemeinsam eine Reise anzutreten. Man ei-
nigte sich auf ein Ziel... Sie wählten das Reiseziel Florenz... Nicht nur der
Adel, sondern auch das niedere Volk bereitete sich auf die Reise vor... Der Tag
der Reise kam, und so machten sich die beiden Herrscher auf den Weg ins ferne
Reich der Medici...
(zit. nach: KyabMuna, 2000, 69)
In dieser schülerhaften Stilisierung explizieren sich die sozialen Posi-
tionen des Lehrers und des Schülers. Bei sozialer Zusammenwirkung er-
weist sich die Position des Lehrers als dominierend {König, Adel, Herr-
scher), während sich der Schüler sozial unterstellt empfindet {der Hof-
staat, das niedere Volk).
Den Mangel an sozialer Gewichtigkeit versuchen die Jugendlichen
durch ihren Nigilismus gegenüber den Wertvorstellungen der älteren
Generation auszugleichen. Die Generation der Eltern und Großeltern
wird mit abschätzigen Bezeichnungen abgetan:
111
Abgefahrener Zug (ältere Leute), Roger (Dorftanz) ohne Ende. Verstehen
die heutige Jugend nicht, verstehen auch die Welt nicht ganz richtig. In einem
kranken Körper steckt ein kranker Geist. Man muss sich abgesichert abspalten
genau jetzt von den alten Konservanten.
(zit. nach: KyabMima, 2000, 106)
2. Emotional bewegte Jugend, die die Welt bildlich und bildkräftig
wahmimmt, grenzt sich von allem und allen ab, was anders beschaffen
ist oder anders beschaffen zu sein scheint, während sich die Lebensein-
stellungen und Verhaltensweisen der älteren Generation auf ganz ande-
ren Ausgangspositionen beruhen. Die sprachlichen Verhaltensmuster
der älteren Leute sind leider bis heute von der wissenschaftlichen For-
schung fast gar nicht erfasst, obwohl immer wieder Versuche unternom-
men werden, auch hier wissenschaftliche Klassifikationsordnung zu
schaffen. Die Wissenschaftler haben berechnet, dass gegen das Jahr 2040
die Zahl der Personen fortgeschrittenen Alters verhältnismäßig hoch
sein wird, die der jüngeren Nachkommen geringer, was erhebliche sozia-
le und sprachliche Folgen haben würde. Das fortgeschrittene Alter
kennzeichnet sich durch physische Alterung und veränderten Lebens-
rhythmus. Die Kommunikation zwischen den Generationen setzt vo-
raus, dass ältere und jüngere Menschen sich im Gespräch aufeinander
einstellen und das in Form „kommunikativer Akkommodation sprach-
lich wirksam wird“ [Vbith, 2000,172], Geschieht das nicht, so kommt es
zu gestörter Kommunikation, die eventuell einen sozialen Konflikt zwi-
schen Alt und Jung auslösen kann. Der Begriff des Alters wird in der
Gerontolinguistik auf das fortgeschrittene Lebensalter eingeengt (geron
steht im Griechischen für „alt, bejahrt“). Mit Gerontolinguistik (kurz —
Gerolinguistik) wird nicht die Sprache unterschiedlicher Altersstufen,
etwa die Altersstufen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, son-
dern nur die von Menschen fortgeschrittenen Alters gemeint. Die Gero-
linguistik untersucht die Abhängigkeit der Sprache vom sozialen Alter,
unter dem eindeutig das fortgeschrittene Alter verstanden wird. Das so-
ziale Alter bedient sich hypothetisch eines spezifischen Sprachsystems,
welches als Gerolekt bezeichnet wird. Der Sozialbereich des alten Men-|
sehen engt sich wegen Aufgabe des Berufs, Umgestaltungen im privaten
Bereich, Veränderungen in formellen und informellen Beziehungen^
Das durchschnittliche soziale Netzwerk älterer Menschen ist zumeist
auf fünf bis acht Kontaktpersonen begrenzt, mit denen Beziehungen gej
pflegt werden. Hier stehen Familie, Freunde und Nachbarn an erster
Stelle. Die Kommunikationsintensität wird ebenfalls in allen Bereichen
reduziert, wovon ganz besonders die Themenauswahl betroffen
ist. Von Bedeutung bleibt nur die Kommunikation mit Menschen del?
unmittelbaren Umgebung über Probleme des Alltags. Der sprachliche
Diskurs (Redeproduktion) hat zwei dominante Merkmale: er ist ausge-
prägt selbstbezogen und stark vergangenheitsorientiert.
Die Altersmerkmale ergeben sich auch aus der abnehmenden sprach-
lichen Leistung. Im Wortschatzbereich kommt es kaum zur Reduzierung
112
des Wortschatzes, aber die Modernität, die zeitliche Angemessenheit der
sprachlichen Ausdrücke geht verloren. Beim syntaktischen Bau geht es
oft darum, dass die Satzkomplexität oft verringert wird, häufig kommt es
zu Satzbrüchen und Satzwiederaufnahmen. Das „alles
wissende“ und belehrende „Selbst“ rückt bei der Redeproduktion in den
Vordergrund genau so wie die eigene Vergangenheit. Die Gegenwart
wird entwürdigt und vollkommen unterschätzt. Im fortgeschrittenen Al-
ter wird zudem noch der wichtigste Mechanismus des sprachlichen
Funktionierens blockiert: die alten Leute erleben Störungen mit
paradigmatischer Strukturierung des Wortschatzes
nach assoziativem Prinzip. Sie versagen oft bei der Festlegung
der Gleichzeitigkeit, Ähnlichkeit und Austauschbarkeit in paradigmati-
schen Beziehungen, sie sind auch oft nur begrenzt in der Lage richtige
syntagmatische Beziehungen, d. h. Anreihungsbeziehungen durchzuhal-
ten, die z. B. im Satz aus einer Folge von auseinander gereihten Glie-
dern (Wörtern) bestehen. Ähnlichkeits- und Austauschbar-
keitsstörungen bewirken, dass die Sprache der alten Leute im Ge-
gensatz z. B. zu der Jugendsprache arm an Bildern und bildlichen Ver-
gleichen ist, sowie an emotional markierten stilistischen Mitteln.
Die Störungen bei syntagmatischen Beziehungen bewirken, dass die
Sätze einfacher in ihrem Bau werden, weil die komplexen Satzgefüge
nur noch schwer bis zu ihrem logischen und syntaktischen Ende durch-
gesprochen oder auch durchgeschrieben werden können. Der hervorra-
gende Meister des Sprachporträts Thomas Mann macht in seinem Werk
„Buddenbrooks“ anschaulich, wie sich die Sprechweisen der älteren
Generation von der der jüngeren abheben, ohne natürlich stark ausge-
prägte störungsbedingte Sprechweisen der Alten wortgetreu aufzuzeich-
nen, was wahrscheinlich in einem künstlerischen Werk auch nicht ganz
am Platz wäre. Die Älteren, inspiriert vom Geist der Großen Französi-
schen Revolution, bedienen sich einer mit französischen Ausdrücken
durchsetzten Sprechweise, was den jüngeren nicht eigen ist. Sie suchen
damit ihre geistige Bindung an die Zeit ihrer Jugend nicht zu verlieren.
In ihrem Gedächtnis haben sie etwas ganz Großes, Bedeutsames, was
sie um ihren besten Willen nicht vergessen wollen und nicht vergessen
können. Zumeist sind die französischen Wörter einfach Anredefloskeln,
ein Modeattribut der Zeit, aber den Jüngeren sind sie zwar verständlich,
aber nicht geläufig: „mon vieux, Bethsy“, „Excuzes, mon eher! Mais
c’est une folie!“, „Na, assez, Jean“ und Ähnliches mehr. Während die
jungen Leute ausschließlich in der Gegenwart und zu einem Teil in Zu-
kunft leben und die Vergangenheit nur aus Lehrbüchern kennen, enthal-
ten ihre Ausdrucksweisen in der Regel keinen Anschluss, keine Anleh-
nung an das schon einst Erlebte. Das, was die Jugendlichen erlebt ha-
ben, war gestern, vorgestern, in den Ferien, aber lag nicht in einer quali-
tativ ganz anders beschaffenen Zeit. Die Sprechweisen der Jugendlichen
sind daher simultan mit der Gegenwart und die der alten Leute ret-
rospektiv, rückweisend. Ein Beispiel aus „Buddenbrooks“:
113
„Tja, traurig... wenn man bedenkt, welcher Wahnsinn den Ruin herbeiführ-
te... Wenn Dietrich Ratenkamp damals nicht diesen Geelmaach zum Kompag-
non genommen hätte! Ich habe, weiß Gott, die Hände über dem Kopf zusam-
mengeschlagen, als der anfing zu wirtschaften...“
Eine verstärkte Thematisierung der Vergangenheit fuhrt bei den alten
Leuten oft dazu, dass das Gegenwärtige bemängelt wird und die Jüngeren
belehrt werden, denn die Alten glauben den Sinn des Lebens schon ermit-
telt und erkannt zu haben. Der alte Konsul Buddenbrook sieht sich von
der Höhe seines Alters vollkommen berechtigt, die Verhaltensweisen sei-
ner erwachsenen Söhne zu beanstanden und sein Missfallen darüber zu
äußern: Es passiert leicht, daß du ratlos bist; schlechte und verdammungs-
würdige Einflüsse (über die Schreibweise des Sohnes); du wirst dich durch
dieses miserable Geschreibsel einschüchtern lassen — ja\ (Drohung an den
Sohn). Der alte Buddenbrook gibt sich nicht nur in seiner sozialen Hal-
tung, sondern auch in seinem Redestil dominierend gegenüber seinen
Kindern. In seiner Antwortreaktion auf den Brief des Sohnes aus der ers-
ten Ehe urteilt er über seinen Sohn, als wäre er der Richter in letzter Ins-
tanz. Das soll zugleich zu einer Belehrung für den zweiten Sohn werden,
der sich in vielem der Überlegenheit des Vaters bewusst ist:
„Unchristlichkeit! Ha! Geschmackvoll, muß ich sagen, — diese fromme
Geldgier! Was seid ihr eigentlich für eine Kompanee, ihr jungen Leute, — wie?
Den Kopf voll christlicher und phantastischer Flausen... und... Idealismus!
Und wir Alten sind die herzlosen Spötter... und nebenbei die Juli-Monarchie
und die praktischen Ideale... und lieber dem alten Vater die gröbsten Sottisen
ins Haus schicken, als auf ein paar tausend Taler verzichten!.. Und als Ge-
schäftsmann wird er geruhen, mich zu verachten! Nun! Als Geschäftsmann
weiß ich, was faux-frais sind.“
Die alten Leute sehen oft ihre soziale Verpflichtung darin bestehen,
Traditionen zu wahren und nicht zuzulassen, dass der durchgehende
Zeitfaden an einem schönen Tage reißt. Und eben im Lichte dieser so-
zialen Xbrpflichtung thematisieren sie häufig das eigene Selbst: „Mein
Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche,
daß wir bey Nacht ruhig schlafen können.“
IV. Geschlechtsinarkierte Ausdnicksweisen. Im Sprechverhalten einer
Person sind praktisch alle sozialen Parameter enthalten, die für diese
Person kennzeichnend wären. In den meisten Fällen treten sie aber
nicht souverän und eigenständig auf, sondern im Verbund miteinander.
Das erschwert ganz besonders die Untersuchung sprachlicher Eigen-
tümlichkeiten, denn sie können zugleich auf verschiedene soziale Posi-
tionen und Rollen hinweisen. Weiblichkeit oder Männlichkeit bildet al-
lein keine soziale Rolle, vielmehr wird die Rolle jeweils konstituiert im
Verein mit anderen Eigenschaften einer Person sowie in Kontakt mit
Personen, die eine solche Rolle nicht ausfüllen“ [Veith, 2000, 152].
An den Inhaber einer sozialen Position werden einzelne Erwartungen
gestellt, sich zu verhalten und sprachlich in Erscheinung zu treten. Von
114
einer Ärztin erwartet man z. B., dass sie bemutternd und kinderfreund-
lich sein soll. Mit den geschlechtsspezifischen Besonderheiten in Rede
und Stil als „Einkleidungsform“ der Rede befasst sich die Genderlin-
guistik. Die Genderlinguistik ist eine Richtung innerhalb der Soziolingui-
stik, die die Abhängigkeit der Sprache vom Geschlecht untersucht. Die
praktische Forschung geht dabei zwei Wege, die einander nicht aus-
schließen, sondern eher präzisierend ergänzen. Beim kognitiven Heran-
gehen an das Problem von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ erarbei-
tet man die mentale Konzeptualisierung der Begriffe
„Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ sowie deren Umsetzung in ver-
schiedenen Sprachen und Kulturen. In der Sprache werden Bezugsrah-
men ermittelt, in denen z. B. die typische Vorstellung über die Frau bzw.
den Mann erschlossen werden. An das zentrale Konzept der Frau ver-
sucht man solche Bezugsrahmen zu binden, wie Familie, Liebesbezie-
hungen, bestimmte Verhaltensmuster der Frau als Mutter, Ehegattin,
Einschätzungen des eigenen Äußeren, geschlechtsspezifische Wfertvor-
stellungen usw. Es ist klar, dass in jeder Kultur die Auffassung der Frau
sowie ihre Rolle in der Gesellschaft kulturspezifisch abge-
schattet sind. Die Genderforscher zielen in ihren Untersuchungen
mehr darauf ab, das weibliche Sprechverhalten sozusagen aus dem „In-
neren“ zu erschließen, d. h. nicht wie die Sprache oder ihre Subsysteme
den Begriff konzeptualisieren, sondern wie das sozial gebundene weibli-
che Geschlecht seine Sprachwelt und Sprechverhalten geschlechtsspezi-
fisch organisiert.
An sich genommen ist diese Forschungsrichtung nicht neu. Noch zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Linguisten auf geschlechtsspe-
zifische Differenzierungen aufmerksam, vor allem auf den Ebenen des
Wortschatzes, des Stils, der Syntax und Gedankenführung. „Demnach
zeigen Frauen eine Vorliebe für feinere, auf gewissen Gebieten verhüllte
und mittelbare Bezeichnungen, da sie gefühlsmäßig vor groben und der-
ben Ausdrücken zurückschrecken“ [s. Veith, 2000, 757].
Die früheren Forschungen waren mehr biosoziologisch ange-
legt und hoben die gesellschaftlichen Funktionen von Mann und Frau
aus dem Forschungsfeld heraus. Dabei wäre es heute z. B. grundsätzlich
falsch der Frau in ihrer Funktion als Chefin gleiche sprachliche Eigen-
tümlichkeiten zu unterstellen wie der Frau als Mutter, Geliebte, Tochter
oder Parteifunktionär. Der Sprache der Frau wurden z. B. solche Beson-
derheiten in Wortschatz, Stil und Syntax zugeschrieben, wie der kleinere
familienorientierte Wbrtschatz, keine Wortspiele und Neologismen, ein-
fache Syntax, einfache Gedankenführung und Ähnliches mehr
[vgl. Veith, 2000, 755]. Sogar auf den ersten Blick scheint eine solche
Unterstellung stark simplifizierend, vereinfachend und gar nicht zutref-
fend zu sein, denn hier werden in erster Linie Unterschiede in der ge-
sellschaftlichen Stellung aus der wissenschaftlichen Betrachtung ausge-
klammert. Außerdem kann auch eine Frau in einer bestimmten gesell-
schaftlichen Position ganz unterschiedliche „Gestalten“ annehmen: zu
115
Hause ist sie eine liebende Frau und Mutter, im Büro — eine strenge
Chefin, am Bett der kranken Mutter — eine verzweifelte liebende Toch-
ter usw. Ihr Sprechverhalten wird jedesmal etwas anders sein müssen,
um ihrer Rolle oder „Gestalt“ gerecht werden zu können.
Geschlecht, Alter und Beruf sowie soziale Stellung der Frau in der
Gesellschaft prägen in ihrer wechselseitigen Wirkung aufeinander ste-
reotype Ansprüche oder Erwartungen der Gesellschaft, gestellt an das
Weibliche in einer Frau. Das Ermitteln und Fixieren des „Weiblichen“
erfolgt gewiss durch die Opposition, Gegenüberstellung hinsichtlich
der analogen Parameter des „Männlichen“. Abweichungen von stereo-
typen Vorstellungen werden im die Frau umgebenden Sozium sofort er-
kannt und dienen als Signale dessen, dass dieser oder jener Frau etwas
besonderes, nicht ganz Frauliches haftet. Somit wird das Gender oder
der Genderfaktor auf Grundlage unterschiedlicher Kontextualisierungs-
konventionen behandelt. Die Kontextualisierungshinweise werden be-
nutzt, um zu signalisieren, wie die sprachlichen Äußerungen zu inter-
pretieren sind. Da die mehrparametrigen Analysen sehr aufwendig und
nicht immer auf steriler experimenteller Basis betrieben werden können,
hat die Genderlinguistik bis heute kein komplettes Gesamtbild des
„Weiblichen“ vorlegen können. Nichtsdestoweniger haben die Meister
des künstlerischen Wortes schon längst den soziolinguistischen Untersu-
chungen und deren Resultaten vorzugreifen vermocht. In diesem Zu-
sammenhang wenden wir uns wiederholt Thomas Mann und seinem
Roman „Buddenbrooks“ zu. Thomas Mann hat mit Sicherheit nicht
von Schlussfolgerungen gewusst, die in der modernen Genderlinguistik
formuliert wurden. Aber er hat die meisten wesentlichen Erkenntnisse
der Genderlinguistik künstlerisch verarbeitet, „verinnerlicht“ und an der
zentralen weiblichen Gestalt, an Tony Buddenbrook erprobt. Tony als
typisierte Gestalt ist zwar zu einem gewissen Teil an jene vergangene
Zeit gebunden, aber bis heute findet sie Anklang als „typische“ Frau,
abgesehen von Zeit, Land und jeglichem sozialen und wirtschaftlichen
Wandel. Eine der Erkenntnisse der Genderlinguistik lautet, dass sich die
Frauen in ihrem Sprechverhalten nicht so sehr auf die Berichtsebene,
auf sachliche Information über Vorgänge, Ereignisse und Handlungen
angewiesen fühlen, sondern sich viel mehr auf die Beziehungs-
ebene konzentrieren, die durch persönliche Kontaktaufnahme,
zwischenmenschliche Annäherung oder Distanzierung gekennzeichnet
ist [vgl. Veith, 2000, 163]. Tony, wie sie Thomas Mann erschaffen hat,
bewegt sich fast immer auf der Beziehungsebene und sucht stets nach
Kontaktpersonen, an die sie sich anlehnen kann in ihrem Urteil oder in
ihrer Auffassung von Etwas. Mal sind es ihre Ehegatten, mal der ältere
Bruder, mal sogar die Haushälterin Ida:
„Danke, Ida, das tut gut... Ach, setz dich noch ein bißchen zu mir, gute alte
Ida, hier auf den Bettrand. Sieh mal, ich muß beständig an morgen denken...
Was soll ich bloß tun? Bei mir dreht sich alles im Kopfe herum... Es muß sich
morgen entscheiden... Aber was soll ich nur sagen, Ida, wenn er fragt?! Du bist
116
noch nie verheiratet gewesen und kennst eigentlich das Leben nicht, aber du
bist ein ehrliches Weib und hast deinen Verstand... Kannst du mir nicht raten?
Ich hab’ es so nötig... “
Die Frauen sind auch heute mehr kooperativ und weniger dominant in
ihrem Sprechverhalten und das mag wohl zumindest an zwei Momenten
liegen. Zum einen sind auch starke „power Frauen“ physisch dem Mann
unterlegen, zum anderen mussten sie und müssen immer noch ihren
gleichberechtigten Stellenwert in der Gesellschaft und in der Fa-
milie erkämpfen, erringen, dem Mann stets „aus der Hand reißen“. Wäh-
rend der Mann gelassen seine dominante Stellung genießen darf, sieht
sich auch die moderne Frau, genau so wie einst Tony Buddenbrook, ge-
zwungen, sich um ihre Gleichheit mit dem Mann intensiv zu bemühen.
Auch heute scheint der Frau ihr öffentliches Ansehen sowie ihre Rang-
stellung in der Gesellschaft bedroht zu sein, mögen es auch Relikte des
alten historischen Bewusstseins sein. Das alte Buddenbrook’sche Haus,
die Firma sind für Tony ihre Statussymbole, von denen sie sich unmöglich
trennen will, sonst geht ihre gesellschaftliche Identität verloren und sie
selber gerät in eine niedrigere soziale Nische:
„Dies geschieht nicht, Thomas! Solange ich lebe, geschieht das nicht! Wenn
man seinen Hund verkauft, so sieht man danach, was für einen Herrn er be-
kommt. Und Mutters Haus! Unser Haus! Das Landschaftszimmer!...“
Die verstärkte Bemühung um die Erhaltung der gehobenen, zumindest
gleichberechtigten Stellung scheint auch heute kein absoluter Bewusst-
seinsatavismus in einer Frau zu sein und bewirkt, dass die Frau in ihrem
öffentlichen Auftreten, begleitet durch sprachliches Auftreten ihre Domi-
nanz herauszustreichen sucht. Ein Mittel zur Dominanzerkennung bzw.
Dominanzbewahrung ist für die Frau das Äußere. Die Frau versteht mit
den Augen, das war, das bleibt, das wird wohl bleiben. Wenn man die The-
menbezüge von Mann und Frau anteilig gewichtet, so wird es sich mit
großer Sicherheit erweisen, dass die Frau mit ihrer besonderen Vorliebe
für Äußerlichkeiten in Führung liegt, genau so wie Tony Budden-
brook, die alle und alles zuerst mit Augen mustert und bewertet, um abzu-
schätzen, ob sie einem gewissen Statussymbol gewachsen sind:
„Du glaubst nicht, was für ein komischer alter Herr (Bankier Kesselmeyer —
N.A.) das ist! Er hat einen weißen, geschorenen Backenbart und schwarz-weiße
dünne Haare auf dem Kopf, die aussehen wie Flaumfedern und in jedem Luft-
zug flattern...“
„Unsere Villa, die ich dir schon eingehend beschrieb, liebe Mama, ist wirk-
lich sehr hübsch... Gegen den Salon hättest du nichts einzuwenden: ganz in
brauner Seide. Das Eßzimmer nebenan ist sehr hübsch getäfelt; die Stühle ha-
ben fünfundzwanzig Kurantmark das Stück gekostet... “
Wenn man heute von der „Verweiblichung“ von Männern
spricht, so wird als eines der augenfälligsten Merkmale solch einer Ver-
weiblichung der Hang einiger Männer zu Äußerlichkeiten sowie zu de-
ren Xfersprachlichung in der Sprache der Männer genannt.
117
Das jahrhunderteschwere Traditionserbe kann auch das heutige
weibliche Bewusstsein nicht so leicht abschütteln, es ist z. B. nachge-
rechnet worden, dass zu den regelmäßigen Besuchern von Kirchen im
europäischen Areal viel mehr Frauen als Männer gehören. Das zeugt
vielleicht gar nicht davon, dass es unter Frauen mehr Gläubige gibt als
unter Männern, aber auch heute glaubt eine Durchschnittsfrau weniger
an sich selbst und ihre eigenen Kräfte, sondern genau so wie Tony Bud-
denbrook an einen glücklichen Zufall, an einen zuverlässigen Partner,
an das Schicksal letzten Endes, was in den Partien ihrer sprachlichen
Äußerungen Niederschlag findet, die Handlungen, Entscheidungen, in-
nere Einstellungen usw motiviert:
„Ach, Mutter“, schrieb Tony, „was kommt auch alles auf mich herab! Erst
Grünlich und der Bankerott und dann Permaneder als Privatier und dann das
tote Kind. Womit habe ich soviel Unglück verdient!“
Zuletzt bliebe noch die alte neue Genderweisheit zu veranschauli-
chen, dass die Frau gefühlsbetonter auf die Welt und alles, was
drin ist, reagiert. Zwar lässt sich die Gefühlsbetontheit der Wahrneh-
mung je nach sozialer Stellung, Beruf und Alter abstufen, aber im Allge-
meinen bricht das Gefühl in den Sprechweisen der Frauen viel stürmi-
scher und unvermittelter heraus, als bei einem Mann:
„Ich verstehe es nicht... ich verstehe es nicht... “ schluchzte Tony fassungs-
los und schmiegte ihren Kopf wie ein Kätzchen unter die streichelnde Hand...
„Er kommt hierher, sagt allen etwas Angenehmes... reist wieder ab... und
schreibt, daß er mich... ich verstehe es nicht... wie kommt er dazu... was habe
ich ihm getan?!“
„O bewahre!“ rief Tony... „Was für ein Unsinn, Grünlich zu heiraten! Ich
habe ihn beständig mit spitzen Redensarten verhöhnt! Ich begreife überhaupt
nicht, daß er mich noch leiden mag! Er müßte doch ein bißchen Stolz im Leibe
haben!“
Sicher gibt es in der Genderforschung noch zahlreiche Lücken und
Ungereimtheiten, die wissenschaftlich fundiert zu beheben die Aufgabe
der künftigen Forschung ist. Hauptsache, dass das Vorhandensein des
wissenschaftlichen Phänomens selbst, der Sprache der Frauen, keinem
Zweifel unterliegt und so augenfällig präsentiert ist, dass in der dichteri-
schen Kunst überzeugende Beispiele erschlossen werden können, wie
sich eine Frau sprachlich gibt.
§ 26. Zeitliche und individuell schöpferische Ansätze
im Wortgebrauch
Wörter mit unterschiedlicher zeitlicher Geltung bilden einen stilis-
tisch bedeutsamen Wortschatzbereich. Ihre stilistische Wirkung beruht
darauf, dass bestimmte Wörter in Mode kommen oder veralten können
und dann nur selten gebraucht werden. Ihre Bedeutung und Funktion
118
Übernehmen dann die anderen vorhandenen oder neu gebildeten Wör-
ter. Die Herausbildung des gegenwärtigen deutschen Sprachsystems er-
folgte bekanntlich unter massiven Einflüssen des Purismus, der
Reinhaltung des deutschen Sprachsystems und Verdrängung des Frem-
den, zumeist Lateinischen. Die puristisch gesinnten Sprachforscher der
Vergangenheit waren um „die Verbesserung der deutschen Sprache“ be-
sorgt und haben das Deutsche um eine beachtliche Anzahl von Wörtern
bereichert, deren weiteres Schicksal verschieden war. Zur Zeit ihrer „Er-
findung“ wurden sie alle als neuartig und befremdend empfunden. Viele
davon erwiesen sich als kurzlebig und haben ihre Schöpfer nicht über-
lebt. Die anderen sind ins Fleisch und Blut des Deutschen eingedrungen
und erfreuen sich bis heute „bester Gesundheit“.
Im 18. Jahrhundert wirkte der lateinischen Abfassung von Schriften
das wachsende Lesebedürfnis breiter Volksschichten entgegen. Das Volk
wollte in seiner Sprache, d. h. in einem verständlichen Deutsch unter-
halten oder belehrt werden. Nun trat Johann Christoph Gott-
sched, 1700 geboren, auf den Plan. Er schrieb: „Ein deutscher Poet
bleibt bei seiner Muttersprache und behängt seine Gedichte mit keinen
gestohlenen Lumpen der Ausländer“ [Gepflegtes Deutsch, 1969, 34].
Das etymologische Wörterbuch verzeichnet als Gottsched’sche solche
Wörter, wie z. B. Begeisterung. Büste. Gegenstand. Hörsaal. Zischlaut
usw, denen ein langes Leben Geschieden war. Gottscheds Widersacher
G.E. Lessing hat dessen weniger gelungene Verdeutschungen kritisch
ausgewertet und selber Varianten erfunden für die in seinen Augen miss-
lungenen Xbrdeutschungen wie Vortrab („avantgarde“), oder Nachtrab
(„arriergarde“). So wurden die von Gottsched stammenden „Xbrtrab“
und „Nachtrab“ durch Lessing’sche „Xörtrupp“ und „Nachtrupp“ ver-
drängt, deren vitale Existenz sich bis in die heutige Zeit hinausstreckt.
Nach dem etymologischen Wörterbuch verdanken wir Lessing die fol-
genden anschaulichen Wortbildungen: Bücherwurm. Liebchen. Maßre-
gel. ähneln, empfindsam, rührend, zerstreut. Schaubühne, gleichförmig
u. a. m.
J. C a m p e, 1746 geboren, war ein Wsrtschöpfer mit praktischer Ver-
anlagung. Er war Jugendschriftsteller und Pädagoge, Hauslehrer bei den
beiden Humboldt. Ihm verdanken wir eine Reihe von ausgezeichneten
Neubildungen, die heute in aller Munde sind: Beweggrund. Bittsteller.
Einzahl. Esslust, Kreislauf, Minderheit, Stelldichein, Streifwache, Tage-
blatt, Zerrbild. W. G o e t h e und F. S c h i 11 e r waren auch die größten
Sprachforderer ihrer Epoche. Schon die ersten Werke dieser Dichter
wirkten befreiend in ihrem Streben nach Natürlichkeit und Lebensecht-
heit. Unter ihrem Einfluss wandelte sich die Sprache der Dichter, strebte
nach deutscher Ausdrucksweise. Das bestimmte auch die Sprache vieler
Menschen, die auf die Stimme der beiden hörten. Die Prosa, besonders
des jungen Goethe, war so bildhaft durchsichtig, dass sich die Leser an
ihr fast unbewusst die besten Ausdrucksweisen anerziehen konnten. Aus
dem reichen Vorrat Goethe’scher Neubildungen wollen wir ein paar be-
119
sonders anschauliche herausgreifen, wie Katzenjammer, Trotzkopf, Trag-
weite, Weltliteratur. Sehr viele Wortbildungen von Goethe haben sich
aber nicht durchgesetzt, sind einmalige Neuwörter (Neologismen) ge-
blieben und prägen nur die Wfelt seiner Dichtung, ohne von den anderen
akzeptiert worden zu sein, z.B. Geschwindschreiber („Stenograf),
Selbstigkeit („Egoismus“), Selbstler („Egoist“), Zweigesang („Duett“).
Von F. Schiller stammen die pathetischen Gedankenfreiheit und Götter-
funken.
Das ganze sprachliche Schöpfertum vermittelt die wichtige Erkennt-
nis: im Wbrt voll Empfindung wird auch der Begriff stark. Die richtige
Erkenntnis beginnt und endet mit der Fassung in Wort. In Wort und sei-
nem Gebrauch sind Mittel und Wege vorgeschrieben, auf denen man
sich dem Wesen der Welt nähern kann. Die Welt ist erkennbar, weil in
der Sprache stereotype Vorstellungen, Muster und Erwartungen begriff-
lich in Wort enthalten sind. Wenn diese Vorstellungen oder Muster nicht
ausreichen, wenn die Komplexität der Welt sich erhöht, werden neue
Begriffshüllen geschaffen, die es besser ermöglichen, das Spezifische be-
stimmter Sachverhalte zu erfassen. So kommen neue Bezeichnungen
auf, die bald gar nicht mehr als neuartig auffallen.
Das individuelle sprachliche Schöpfertum der früheren Jahrhunderte
wird im 20. Jahrhundert durch das kollektive „Schöpfertum“ der
gesellschaftspolitischen Formationen und Doktrinen abgelöst. Es wer-
den Begriffe geprägt, die als Historismen bezeichnet werden können,
weil sie das historische Kolorit einer bestimmten Zeitperiode markieren.
In diesem Zusammenhang sei an die Neuprägungen der Hitlerzeit ge-
dacht, die zumeist eine verschleiernde Wirkung hatten, z.B. Sterilisie-
rung, den Fall erledigen („ermorden“), rassig (in Bezug auf Menschen),
Rassereinheit, Rassezucht, Arier, arisch, nordisch, Führer und Führer-
schaft usw. Bis heute lebt im modernen Sprachgebrauch manche Scheu
vor gewissen Begriffen aus dieser Zeit. So wurde längere Zeit das Wort
„Führer“ nur ungerne und mit Vorbehalten gebraucht, zumeist hat man
damit lieber Komposita oder Umschreibungen gebildet, wie in Führung
liegen oder Branchenführer sein. Man kann wohl vermuten, dass „der
Reiseführer“ nie zum einfachen „Führer“ gekürzt wird.
Die Epoche des politischen Gegeneinanders hat ganze Wortsysteme
entstehen lassen, die die Konfrontation der wesensverschiedener ideolo-
gischer und gesellschaftlicher Systeme deutlich hervortreten lassen. Der
Warschauer Vertrag und der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)
auf der einen Seite und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und
die NATO auf der anderen Seite platzierten die zentralen Begriffe ihrer
konzeptionellen Auffassungen in unterschiedlichen Wahrnehmungsko-
ordinaten. Dieses ideologiegebundene Auseinanderdriften der beiden
Systeme setzte schon mit den Potsdamer Abkommen ein, bei deren
Umsetzung viele doktrinprägende Neuwörter das Licht der Welt erblick-
ten, die heute in Prosa und Dichtung die Atmosphäre jener Zeit nach-
spüren lassen: entnazifizieren, entmachten, entkartellisieren, bizonal, Re-
120
Militarisierung usw. Während die „Trümmerfrauen“ (auch ein Historis-
mus) in Ost und Wfest ganze Städte „enttrümmerten“, erschien im Osten
eine neue „Arbeitsmoral“ mit „Aufbausonntagen“ und „Friedens-
schichten“ der „aufbauwilligen“ Bürger, die an „Qualitätsbewegungen“
teilnahmen, „Patenschaften übernahmen“, in LPG’s (landwirtschaftli-
che Produktionsgenossenschaft) und VEB’s (volkseigener Betrieb) ihr
„Plansoll“ erfüllten und Überboten, mit „Höchstleistungs- und Höchst-
ertragskonzeptionen“ die Sache anpackten, im Urlaub oder in den Feri-
en als „Erntehelfer“ der neuen Republik dienten und Abend für Abend
in einer „Betriebsvolkshochschule“ die Bank drückten, um später even-
tuell mit einem „Aktivistenabzeichen“ für ihren „Aufbaubeitrag“ ge-
würdigt zu werden.
Der Aufbau in Ost und West wurde von einem wissenschaftlich-tech-
nischen Fortschritt getragen, der zu beiden Seiten „der Mauer“ zur
Steigerung des Wohlstands (natürlich in verschiedenem Maße) beitrug.
Das Volk, das durch den Krieg von jeglichem Komfort entwöhnt war,
begeisterte sich für „maschenfeste Strümpfe“ und „hautenge Pullis“, für
„handwarmes Badewasser“ und „haushaltschemische“ Erzeugnisse, für
„bügelfeuchte“ Wäsche aus der Waschmaschine und „knitterfreie“
Schlips, für „atmungsaktive“ Schuhe und „schmutzabweisenden“
Tischbelag. Banale Baumwolle oder Wolle ist plötzlich weniger geeignet
als synthetische Fasern wie Nylon, Dederon, Perlon, Lanon. Gespart
wird jetzt nicht für einen Plattenspieler, sondern nach Möglichkeiten für
Video, Stereo oder Hi-Fi.
Wörter sind an Zeit gebunden, die Zeit und ganz besonders der Zeit-
wandel verlangt nach neuen Wörtern zur Prägung der neuen Begriffe
oder zur Benennung von neuen Gegenständen.
Die neunziger Umbruchsjahre prägen schon neue Wortschatzsyste-
me, die die Welt neuer Begriffe und Realien erschließen und auf den
neuen Bürger in einer neuen nicht mehr in DDR und BRD gespalteten
Welt beziehen sollten. Nach dem „Fall der Mauer“ wurde das DDR-
Deutsch abgewertet und bloß zu ironisch-satirischen Zwecken
verwendet. Man wuchs in eine neue Welt hinein mit Ausgleichszahlun-
gen, Sozialtransfers, Sozialeinspritzungen, Pendlerverkehr, Teilzeitbeschäf-
tigung, Harmonisierung der Löhne und Gehälter, Sanierung der Betriebe
und ganzer Branchen, Umstrukturierung, Förderprogrammen und An-
schluss an den Westen.
Die Neuwörter erweitern täglich den Fachwortschatz und skizzie-
ren den Gang des menschlichen Gedankens, der menschlichen Er-
kenntnis. Die siebziger Jahre setzten z. B. Begriffe aus den Sozialwis-
senschaften durch: „Entfremdung“ aus der Soziologie, „Frustration“
und „Motivation“ aus der Psychologie. Alltäglich wurden auch „schi-
zophren“ und „kreativ“. Die achtziger Jahre, die als Jahrzehnt des
Börsenrauschs und der Yuppies bezeichnet werden, werden die Voka-
beln der so genannten „Altemativszene“ als Neuheiten in den Usus
aufgenommen: etwa „Umwelt“, „Ökologie“, „Umweltschutz“ als
121
Motivbezeichnungen der nicht mehr passiven, sondern kämpferisch 1
eingestellten Bürger, vor allem der aufgeklärten und gebildeten Ju-
gendlichen.
Modewörter dieser Zeit sind „Sensibilität“ und „Betroffenheit“.
1968 wird „multikulturell“ zum Schlagwort. In den neunziger Jahren
verliert der Ökojargon an Boden. Nach dem Wandel in Osteuropa ver-
schwinden viele politische Kampfbegriffe, wie die aus der NATO-Stra-
tegie: „Zügelung“, „nukleare Abschreckung“. An ihre Stelle kommen
kooperative Bezeichnungen wie Friedenseinsatz, Blauhelme,
Systemverträglichkeit oder Systemkompatibilität, Nukleardemontage, Ra-
ketenverschrottung. Auch die Computersprache wirkt selbst berei-
chert und bereichert den allgemeinen Gebrauch. Jetzt wird „vernetzt“
gedacht und „virtuell“ gesehen. Die zweite Hälfte der Neunziger prägt
die Wirtschafts- und Sozialkrise. Zum Wort des Jahres wird „der Sozial-
abbau“, der zu einem größeren Teil auf das „Sparpaket“ der Regierung
und den „Reformstau“ zurückgeführt wird. In den 90er Jahren beginnt
es auch in der EU zu „kriseln“. Und nicht einmal die „Krisenkapitäne“
der europäischen Gemeinschaft, die zugleich auch die „geistigen Väter“
der Gemeinschaft sind, sind im Stande die „Konvergenzkriterien“ von
Maastricht aufzulockern.
Somit verlangt jede Zeit und jede gesellschaftspolitische, kulturpoli-
tische und wissenschaftlich-technische Konfiguration der Zeit sowie die
Disposition der Kräfteverhältnisse ihren sprachlich spezifischen Aus-
druck, und die Wörter, einmal neu gebildet, hinterlassen Spuren, nach
denen sich die Nachkommen in der Vergangenheit zurechtfinden wer-
den. Die Neologismen einer Zeitperiode wandern als Ususwörter
in die andere, nachfolgende Zeit hinüber, wo sie schon als, zum Teil ver-
altet, als Schlüssel dienen, um den Geist der Vergangenheit zu erfassen.
Auf solche Weise erfolgt die Überlieferung des geistigen Erbes und der
faktualen Information von der Generation der Väter an die Generation
der Kinder.
In der Fachliteratur gliedert man das gesamte neu geschaffene Wort-
gut in folgende Gruppen oder Rubriken ein:
1. Neubildungen — ganz neue Wörter. Die Zahl eigentlicher Neubil-
dungen ist in den letzten Jahrhunderten verhältnismäßig klein geblie-
ben, wenn man von Ableitungen aus schon vorhandenen Lexemen ab-
sieht. Die Neubildungen von schon vorhandenen Wörtern oder Wurzeln
durchdringen insbesondere den technischen Bereich, wo Kons-
truktionen neuerer Geräte neue Benennungen verlangen. Aber auch in
Politik und Wirtschaft wird eine Zunahme von abgeleiteten Neubildun-
gen registriert. Meist handelt es sich um Neuableitungen aus den alten
Sprachen, aus dem Griechischen und Lateinischen, so dass viele Neu-
bildungen europaweit verstanden werden und den Sprachverkehr inter-
nationalisieren, z. B. Globalismus, Regionalismus, Harmonisierung, kon-
vergieren, divergieren und Ähnliches mehr. Zu den meist gebrauchten
abgeleiteten Neubildungen gehören präfixale Verben und deren
122
substantivische Begleiter auf ~ung\ Verkehrsanlagen begrünen,
ein Flugzeug betanken, das Theater bestücken, Säle bestuhlen, Werften be-
kranen, ein Rasiermittel beduften, einen Raum beschallen, die Oper betex-
ten, eine Produktion vermassen, die Geldmenge verknappen, ein Auto ver-
clieseln, eine Funkanlage entstören, Kakao entölen, eine Ware auspreisen.
Nicht weniger produktiv scheint auch das Modell mit -mäßig geworden
zu sein: institutionsmäßig, listenmäßig, produktionsmäßig, wettermäßig,
leistungsmäßig, besetzungsmäßig u. a. m. Die suffixalen und präfixalen
Neuableitungen sind aus dem Grunde immer noch auf Expansionskurs,
weil sie ausdrucksökonomisch sind und die ganze Äußerung
straffen lassen. Auch sind sie prägnanter und einprägsamer, lassen den
Begriff selbst präziser abgrenzen, ohne dass dabei Schwierigkeiten im
Verstehens- und Verständigungsvorgang eintreten.
2. Neuprägungen. Als solche werden Wörter aufgefasst, die aus schon
bestehenden Wörtern neu geschaffen worden sind, z. B.: Atomenergie,
bombengeschädigt, Bestarbeiter, Pflegebedarf, Gemeinschaftsarbeit, kos-
tensparend, energiesparend, systembedingt, Unternehmenstransparenz,
Wegwerfwäsche, Einwegflasche usw. Es handelt sich dabei vor allem um
Zusammensetzungen gegebener Wörter, die auf diese
Weise einen neuen Sinn ergeben. Die Neuprägungen sind heute in den
Bereichen der Technik, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik beliebt, wo
substantivische Kompositabildungen überwiegen.
3. Neubedeutungen. Unter der dritten Gruppe der Neuwörter wer-
den Neubedeutungen verstanden, die entstehen, wenn die gegebenen
Wörter eine neue Bedeutung angenommen haben, z. B. jemanden
magnetisieren (sehr genau beobachten, mustern mit dem Ziel je-
mands Aufmerksamkeit zu fesseln) oder jemanden neutralisieren (so
tun, dass der Mensch seine feindselige Einstellung einbüßt und wenn
schon nicht zum Freund, so doch zu einem gleichgültigen Betrachter
wird).
4. Einmalbildungen. Innerhalb der 4. Gruppe können wir die so ge-
nannten Einmalbildungen zusammenfassen, die in der Regel von
Dichtern, Schriftstellern und angesehenen Politikern stammen, aber
selten oder gar nicht die Chance haben in den allgemeinen Usus hinü-
berzuwechseln, weil sie zum Einen zu sehr bildkräftig und oft so-
gar metaphorisch umgedeutet sind, und zum Zweiten in-
dividuell zugeschnitten sind, indem sie die Sicht und die
Gefühlswelt des Autors erschließen. Sie kennzeichnen den Individual-
stil eines Autors und werden in den anderen Kontexten oft als Allusio-
nen, Hinweise und Bezugnahmen auf den Quellenautor empfunden.
In den meisten Fällen sind sie nur sehr beschränkt nachvollziehbar in
den vom konkreten Autor und konkreten Werk abstrahierten Kontex-
ten. Xbn H. Heine stammen solche Einmalbildungen wie Museenwit-
wensitz (Weimar), Suppenkesselinteressen, Menschenfrühling, prügel-
treu, Gesetztafelgesicht, Gebetbücherton, von E.Wfeinert — Aphorismen-
kompott und Gemütsschamott, von N. Lenau — das Rückwärtsdenken
123
und Vorwärtsgrübeln. Eigentlich kann fast eine jede gelungene dichte-
rische Metapher als Einmalbildung eingestuft werden, die „maßge-
schneidert“ im gesamten Wortgut bleibt und eher eine kreative
Etiquette bleibt, die der das individuelle Gesamtschaffen charakteri-
sierenden Interpretationen bedarf.
Genau so wie Neologismen beruhen auch die Archaismen auf zeitli-
cher Eingrenzung in der Verwendung. Innerhalb der Wörter mit zeitge-
bundener Geltung lassen sich folgende Gruppen unterscheiden: 1) ver-
altete Wörter, 2) veraltende Wörter.
1. Bei den veralteten Wörtern handelt es sich um Wörter, die heute
nicht mehr zum aktiven Wortschatz gehören, aber noch verstanden
werden. Veraltete Wörter, Archaismen im engeren Sinne des Wortes,
haben vielfältige stilistische Funktionen oder Wertungen. In histori-
schen Monografien und wissenschaftlichen Fachtexten über die ver-
gangenen Zeitperioden sowie soziale und politische Entwicklung un-
terschiedlicher Völker und Völkerstämme übernehmen sie eindeutig
die Funktion des Fachwortes oder des Terminus, die der Ver-
ständlichkeit halber auch noch erläutert werden. Hier seien einige Bei-
spiele aus der „Geschichte des deutschen Volkes“ angeführt, herausge-
geben 1952 in Berlin:
Die Feudalherren ließen nur einen kleinen Teil ihrer Besitzungen von un-
freien Knechten und Mägden bewirtschaften. Die Feudalherren verlangten von
den hörigen Bauern Abgaben und Frondienste. Die meisten Feudalherren be-
saßen mehrere Fronhöfe. Diese konnten sie nicht selbst verwalten. Deshalb
setzten sie Verwalter ein. Die Verwalter wurden Meier genannt. Jeder hörige
Bauer mußte aus 12 Scheffeln (= 8,75 Liter) Roggen 24 Brote backen... Als Ab-
gaben von den Erträgnissen ihrer Hufen (1 Hufe = 30 Morgen) mußten die hö-
rigen Bauern 56 Denare bezahlen. Ein Denar hatte den XVbrt von 15 Roggen-
broten zu zwei Pfund.
In schöngeistigen Werken kommt den Archaismen die Funktion zu,
das Kolorit der Epoche zu zeichnen, damit die künstlerische
Fiktion verifiziert wird, d.h. die Züge der historischen Wahrheit ge-
winnt. Solche veralteten Wörter werden bisweilen als Historismen be-
zeichnet. Bei J.W. Goethe und Fr. Schiller sind ziemlich längere Partei-
en der künstlerischen Darstellung durch Historismen geprägt, die schon
zu den Lebzeiten der beiden genialen Schriftsteller gänzlich aus dem ak-
tiven Gebrauch verdrängt wurden: „Dies sagend ritt er trutziglich von
dannen, ich aber blieb“ (Schiller); „Wie entgleitet schnell der Fuß schie-
fem, glatten Boden! Wen betört nicht Blick und Gruß, schmeichelhafter
Odem?“ (Goethe). Es müssen dabei nicht unbedingt zeitlich sehr weit
entlegene Perioden sein, die zum Gegenstand der künstlerischen Bear-
beitung und Wiederholung werden.
Das bewegte 20. Jahrhundert brachte Wandlungen und Kriege sol-
chen Ausmaßes mit, dass die Sprache kaum Schritt halten konnte mit
historischen Umwälzungen. Die Jahre der großen gesamteuropäischen
124
Depression sind z. B. heute bei ihrer Abbildung in der Wortkunst durch
solche historischen Wörter erkennbar, wie Hausierer und hausieren, Kar-
toffelzüge, Kohlendeputate sowie Ersatzzucker, Ersatzseife, Essmarken,
Brotration u. a. m. Mehrere Historismen aus der Depressionszeit sind
hinübergewandelt in die nicht weniger mühevollen und harten Nach-
kricgsjahre, der Vorrat an Vorkriegs- und Kriegswörtern wurde sogar er-
weitert: dazu kamen z. B. Trümmerfrauen und Trümmerkinder, die die in
Schutt und Asche liegenden deutschen Städte enttrümmerten, Kriegsge-
schädigte und Heimkehrer, die in ehemaligen Bombenkellern ihre Unter-
kunft gefunden haben, der Aufbaugeist und Aufbauwille, zu denen sich
die meisten Bürger verpflichtet fühlten. In diese Zeit fallen auch die
Montanhilfen, d.h. Hilfeleistungen an Deutschland von der Europäi-
schen Union für Stahl und Kohle. Die meist verbreitete Hilfsform waren
Anthrazitzüge aus Luxemburg. Alle Kontrollfunktionen und Organisati-
onsfunktionen werden von „Amis“ oder „Alliiertenbehörden“ ausgeübt,
die auch den Grenzverkehr im geteilten Berlin regelten, indem sie die
Grenzübergänge errichteten, die viel sagende Namen trugen: „Iwan,
Charlie, Jean“, je nach dem meist verbreiteten Namen im Siegerstaat.
Mit der endgültigen Spaltung in DDR und BRD begann auf der lexi-
kalischen Ebene eine ziemlich deutliche Auseinanderentwicklung, viele
Neuwörter jener Zeit sind heute zu Historismen geworden, die Unter-
schiede im ideologischen und politischen Aufbau der zwei deutschen
Staaten herausstreichen und ermöglichen, das Kolorit jener Zeiten
in der schöngeistigen Literatur, in Massmedientexten
sowie in der Umgangssprache wiederherzustellen. Sie prägen auch
die Sprechweisen der älteren Generation, besonders wenn es sich um
retrospektive Redefragmente handelt.
Veraltete Wörter haben auch genreprägende und genrebildende Po-
tenzen in der Dichtung, insbesondere in der Ode oder in der Ballade.
Sogar die späteren Nacharbeitungen der deutschen Volksballaden
schließen lexikalische, syntaktische und morphologische Archaismen als
ein konstituierendes Merkmal ein. Im Fall der Ballade handelt es sich
um eine bewusste Stilisierung der Vergangenheit, bei der Ode rückt der
Archaismus als Träger und Ausdruck des Erhabenen, des Poetischen in
den Vordergrund: Zur Veranschaulichung bringen wir an dieser Stelle ei-
nige Vierzeiler aus der Ballade „Das Lied vom Herrn von Falkenstein“,
nachgearbeitet vom jungen Goethe:
Es reitet der Herr von Falkenstein
Wohl über ein breite Heide.
Was sieht er an dem Wege stehn?
Ein Maidel mit weißen Kleidern.
Wohin, woraus, du schöne Magd?
Was machen ihr hie alleine?
Wollt ihr die Nacht mein Schlafbuhle sein,
So reiten ihr mit mir heime.
125
Sie ging den Turm um und wieder um:
Feinslieb bist du darinne?
Und wenn ich dich nicht sehen kann,
So komm ich von meinen Sinnen.
H. Heine wirkt deutlich stark archaisierend in seiner Lyrik der jün-
geren Jahre. Die Archaisierung scheint ein Bestandteil seiner künstleri-
schen Konzeption der frühen Schaffensperiode zu sein. Die Wirkung,
die er durch Archaisierung erlangen wollte, war der Ausdruck des a b-
solut Poetischen, des über alle Alltäglichkeiten Erha-
benen:
In seinem Buch „Junge Leiden“ finden wir das Gedicht „Der wunde
Ritter“, das exemplarisch für viele seine Gedichte jener Zeit stehen kann:
Ich weiß eine alte Kunde,
Die hallet dumpf und trüb;
Ein Ritter liegt liebeswunde,
Doch treulos ist sein Lieb.
Als treulos muß er verachten
Die eigne Herzliebste sein,
Als schimpflich muß er betrachten
Die eigne Liebespein.
Er möcht’ in die Schranken reiten
Und rufen die Ritter zum Streit:
Der mag sich zum Kampfbereiten,
Wer mein Lieb eines Makels zeiht!
Da würden wohl alle schweigen,
Nur nicht sein eigener Schmerz;
Da müßt’ er die Lanze neigen
Wider’s eigene klagende Herz.
Auch in den Volksliedern, die bis heute gesungen werden, bleibt
der absolut poetische Klang der Archaismen erhalten und macht das
Wesen der Liederpoetik aus:
Hansel, dein Gretelein
hat ja kein Hellerlein,
kommst gleich in Sorgen.
Fand mein Holdchen nicht daheim:
muß das Goldchen draußen sein.
Grünt und blühet schön der Mai,
Liebchen ziehet, froh und frei.
Der spätere „bissige“, satirisch eingestellte H. Heine bedient sich
schon der archaisierten, genauer gesagt archaisierenden Ausdrucks-
weisen zur Erlangung von ganz anderen, stilistischen Wirkungen, als
rein poetischen. Er bespöttelt und lacht aus, was immer noch
am Alten, Herkömmlichen, eng Traditionellen hängt. „Beseelt“ von
großen französischen Ideen kommt er nach Deutschland zurück und
sieht, dass in seinem Heimatland diese Ideen niemand merklich be-
wegen. Das trifft ihn hart ins Herz und hält dazu an, das zu sehr tra-
ditionelle Deutschland als Burg des Rückständigen zu bewerten und
auszulachen. Auf die Spitze wird die Satire in seinem Poem
„Deutschland. Ein Wintermärchen“ getrieben, wo er z.B. über den
altpreußischen Geist des „eingefrorenen Dünkels“ folgendes
schreibt:
126
Das ist so rittertümlich und mahnt
An der Vorzeit holde Romantik,
An die Burgfrau Johanna von Montfaucon,
An den Freiherrn Fouque, Uhland, Tieck (romantische
Dichter — N.B.)
Das mahnt an das Mittelalter so schön,
An Edelknechte und Knappen,
Die in dem Herzen getragen die Treu
Und auf dem Hintern ein Wappen.
Das mahnt an Kreuzzug und Turnei,
An Minne und frommes Dienen,
An die ungedruckte Glaubenszeit,
Wo noch keine Zeitung erschienen.
Altertümelnde archaisierende Ausdrucksweisen dienen in den
heutigen Massmediatexten nicht so viel als Ausdruck der beißenden
Satire wie bei H. Heine, sondern viel mehr zur ironischen Auf-
lockerung bei der Darbietung der faktualen Information. Der
heutige publizistische Trend liegt in der ironischen Tonführung, aus
der die Wertungen des Journalisten nur schwer oder gar nicht heraus-
zuklären sind, wobei die Archaismen hier eine ziemlich verbreitete
Technik darstellen. Sie schaffen eine Kontrastwirkung gege-
nüber der nüchternen normativen und gefühlsneutralen Umgebung,
fesseln die Aufmerksamkeit des Lesers und veranlassen ihn weiter zu
lesen. Der renommierte deutsche Fußballtrainer Otto Rehagel wird
von den Journalisten mit „König“ tituliert und seine Fußballspieler
als „hörige Vasallen“, die vor einer „Fehde“ mit dem König Angst
haben, bei dem nur ein „Wimpernschlag und eine Geste“ genügen,
damit sie für „abverdient“ (arbeitslos) erklärt werden, aber „teut-
sche“ Kicker kämpfen „hehr“ und lassen auch weiter ihre „Degen“
schwenken. Ein weiteres Beispiel aus „Süddeutsche Zeitung“. Der
deutsche Autokonzern „Volkswagen“ setzt alles daran, um kostengüns-
tiger zu produzieren, zu diesem Zweck vergibt er die Anfertigung von
technologisch leichteren Werkteilen an „Skoda“ und „Seat“ in Osteuro-
pa, was als „Fronarbeit“ qualifiziert wird, mit der „Tagelöhner“ be-
schäftigt sind. In den Beispielen mit Otto Rehagel und „Volkswagen“
wollen die Berichterstatter aus „Süddeutsche Zeitung“ keineswegs ihre
eindeutig abschätzigen Wertungen zum Ausdruck bringen. Im Material
über Rehagel will der Reporter den harten Trainer als erfolgreichen Ma-
nager präsentieren, im Fall mit „Volkswagen“ wird die neue europaweite
Taktik der Kostensenkung anschaulich erschlossen.
2. Der Prozess des Alterns und Wrgehens der Wörter führt dazu, dass
Begriffe, die bereits durch Neubildungen ersetzt worden sind, weiterhin
benutzt werden, wenn auch nur seltener und vorwiegend von älteren
Sprechern. Einige Autoren verwenden die veraltenden Wörter bewusst,
127
um ältere Menschen in den ihnen vertrauten Sprechweisen zu zeigen. In
„Buddenbrooks“ spricht der alte Buddenbrook von Lebrecht Kröger:
Immer kulant, mein lieber Herr Verwandter. Ich habe ihm dergleichen
nicht spendiert, als er sich sein Gartenhaus vorm Burgtor bauen ließ. Aber
so war er immer... nobel!Spendabel!. “ Seine Frau steht ihm in ihrer fei-
nen archaisierenden Redemanier nicht nach: „Er gibt nicht nach, der
Junge. Er kapriziert sich auf diese Entschädigungssumme für den Anteil am
Hause... “
Auch die Umgangssprache scheut vor veralteten und veraltenden
Gebrauchsweisen nicht zurück, denn sie ermöglichen, es die ironi-
sche Einstellung des Sprechers zu dem, was er spricht, zum Aus-
druck zu bringen. Dem Lehrer „geziemt“ es schlecht, die Schüler zu
„schikanieren“, auch wenn er „das Aufbegehren“ in der Klasse nicht
dulden will. Wenn sich ein besonders eigensinniger Schüler nicht an die
Tafel „bequemen“ will, kann ihm mit der „Abtafelung“ gedroht werden,
d. h. mit dem Entzug des Mittagessens. Die veralteten und veraltenden
Wörter bilden eine sprachliche Quelle, aus der immer wieder je nach
Wirkungsbedarf geschöpft werden kann.
So erleben die Archaismen ihr Comeback in verschiedenste funktio-
nalspezifisch gebundene Redensweisen und wirken darin frisch und
neuartig wie z. B. das Wort „Gescherr“ als Bezeichnung eines Teams von
Gleichgesinnten, angeleitet von ihrem „Herrn“ (Sehet), denen die Auf-
gabe „beschieden“ war, ein Unternehmen fit zu machen (nach Materia-
lien der „Wirtschaftswoche“, 2005, Ne 4).
Literaturnachweis
1. Baron B. Geschlossene Gesellschaft. Vortragsreihe im Sommersemester
1996. — Konstanz, 1996.
2. Benes E. Fachtext, Fachstil und Fachsprache. — Düsseldorf, 1971.
3. Dieckmann W. Sprache und Politik. — Stuttgart, 1972.
4. Fluck Hans-R. Arbeit und Gerät im Wortschatz der Fischer. — Tübingen,
1974.
5. Fluck Hans-R. Fachsprachen. — Tübingen, 1996.
6. Hahn V. Fachkommunikation. — Berlin, 1983.
7. Mackensen L. Die deutsche Sprache in unserer Zeit. — Heidelberg, 1971.
8. Reuther H. Umfang und Wertung des Sports in der modernen Publizis-
tik. — Frankfurt/M., 1959.
9. Samel J. Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. — Berlin,
1995.
10. Sandig B. Stilistik der deutschen Sprache. — Berlin, 1986.
11. Veith W.H. Soziolinguistik. — Tübingen, 2000.
12. Lennep Kak HHTpnra no3HaHM«: CG. craTeu. — M., 2000.
13. ßeeKUH B.U. CGopuuK ynpaxHeHuu no neKCMKOJioruu HeMemcoro
fl3bixa. — M., 1973.
14. Ky3bMUHa E. Cpe/jCTBa BbipaxeHua Mexjiu4HoCTHbix oTHoiueHuu b
Texcrax mojioacxhom C(j)epbi oGmeHu«: Kann, flucc. — M., 2000.
128
Kapitel 7
STILISTISCHE MITTEL UND VERFAHREN
ZUR STEIGERUNG DER ANSCHAULICHKEIT
UND WIRKSAMKEIT DER REDE
§ 27. Anschaulichkeit durch Detailangabe und Beiwort
Jede Rede ist im Optimalfall darauf gerichtet, durch anschauliche
Darlegung der Sachverhalte wirksam zu werden. Jedes Redeprodukt ver-
langt etwas, was über die bloß gedankliche Folgerichtigkeit und Deut-
lichkeit hinausgeht, nämlich Anschaulichkeit. Wenn es darauf ankommt,
andere Menschen zu einer bestimmten Handlungsweise zu bewegen,
wie etwa in der Werbung, oder ihnen bestimmte Sachverhalte oder Vor-
gänge zu verdeutlichen, wie in Vorträgen, Beschreibungen oder Erzäh-
lungen, werden sprachliche Bilder zu Hilfe genommen, um etwas an-
schaulich darzustellen [vgl. Sowinski, 1973, 50].
Größere Anschaulichkeit im Stil kann mit verschiedenen Mitteln er-
reicht werden. Alle bedeutenden Erzähler streben danach, Bilder der
schöpferischen Fantasie zu schaffen, an denen sich die Vorstellung des
Lesers entzünden könnte. Der Leser kann sich um so stärker in ein er-
zähltes Geschehen einfühlen, je mehr er an Einzelheiten der Darstel-
lung in sinnvoller Ordnung aufnimmt. Die Wirkung eines Textes ist von
der Darstellungsweise eines Autors ableitbar, von der Kunst, die Sach-
verhalte sichtbar und greifbar zu machen, indem man z. B. die Szene au-
genfällig detailliert zeichnet, so wie es ein guter Maler mit bunten Pin-
selstrichen macht. Solch eine Darstellungsweise bedarf nicht unbedingt
besonderer stilistischen Mittel oder Verfahren und kann mit stilistisch
nullmarkiertem Wortschatz in stärkstem Maße wirksam werden. Die
Darstellung wird bildhaft, wenn das, was der Autor schreibt, an die As-
soziationen, Vorstellungen, Erfahrungen und Erwartungen des Rezipi-
enten Anklang findet sowie dessen Gefühle anregt. Von alters her ist es
in der Theorie der Redekunst bekannt, dass die Steigerung der pragma-
tischen Wirkung oft im treffenden, einprägsamen Detail steckt, welches
allein oder im künstlerischen Wechselspiel mit anderen pointierenden
Details ein Gesamtbild schafft, welches der Rezipient als Ganzes wahr-
nimmt und miterlebt. Die ganz große Kunst ist einfach und benötigt oft
keinen besonderen Schmuck, aber trotzdem entsteht bei der Wahrneh-
mung eines echten Kunstwerkes das Gefühl des ästhetischen Genusses.
So lesen wir in „Buddenbrooks“ eine folgende Beschreibung:
Man saß im „Landschaftszimmer“, im ersten Stockwerk des weitläufigen
alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Johann Buddenbrook vor eini-
ger Zeit erworben hatte und das die Familie noch nicht lange bewohnte. Die
starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum
5 BoraTbipeua
129
getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften, zartfarbig wie der dünne
Teppich, der den Fußboden bedeckte, Idylle im Geschmack des 18. Jahrhun-
derts, mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackerleuten, nett bebänderten Schäfe-
rinnen... Ein gelblicher Sonnenuntergang herrschte meistens auf diesen Bil-
dern, mit dem der gelbe Überzug der weißlackierten Möbel und die gelbseide-
nen Gardinen von den beiden Fenstern übereinstimmten.
Aus diesem Auszug wird ersichtlich, wie das Detail greifbar nahe
wird, als sähe es der Leser mit seinen eigenen Augen. Solche Augenfäl-
ligkeit wird nicht zuletzt durch Epitheta erreicht. Epitheta oder Beiwör-
ter charakterisieren oder bewerten in der Regel. Häufig gehen von ihnen
die entscheidenden Xörstellungsdifferenzierungen aus. Vor allem Ge-
genstände oder Vorgänge aus dem Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren
(Sichtbaren, Hörbaren, Fühlbaren) wirken anschaulicher, wenn ihnen
vorstellungsdifferenzierende Adjektive oder Adverbien beigefügt sind.
Man vergleiche etwa folgende Sätze [s. Sowinski, 1973, 54]:
(1) Ein alter Baum ragte in den grauen Novemberhimmel.
(2) Ein knorriger alter Baum ragte mit seinen weit gespannten Ästen in den
milchig grauen Novemberhimmel.
Während der erste Satz durch „ragen“ und „grau“ nur vage Vorstel-
lungen zu wecken vermag, entsteht im zweiten Satz durch „knorrig, weit
gespannte Äste, milchig grau“ ein viel anschaulicheres Bild. Die Cha-
rakterisierung durch Beiwörter kann unterschiedlicher Natur sein. Sie
kann Ausdruck erkenntnisbetonter Objektivität oder er-
lebnisbetonter Subjektivität sein. Der erste Fall dominiert
den Funktionalstil der Wissenschaft und Technik sowie den des öffentli-
chen Verkehrs. Der zweite ist das Spezifikum der schöngeistigen Texte
sowie mancher Arten von Massmediatexten. Bei H. Böll lesen wir in sei-
ner Novelle „Die Botschaft“:
Einfach meinem Gefühl nach ging ich links herum, aber da war der Ort
plötzlich zu Ende: etwa zehn Meter weit lief noch die Mauer, dann begann ein
flaches, grauschwarzes Feld mit einem kaum sichtbaren grünen Schimmer, der
irgendwo mit dem grauen himmelhohen Horizont zusammenlief, und ich hatte
das schreckliche Gefühl, am Ende der Welt wie vor einem unendlichen Ab-
grund zu stehen...
In einem schöngeistigen Text fällt es oft nicht leicht charak-
terisierende und wertende Funktion der Beiwörter auseinander zu hal-
ten, denn die Wertung erfolgt nicht nur nach rationeller Einteilung in
„gut“ und „schlecht“, sondern erfasst auch sinnlich wahrnehm-
bare Parameter wie „angenehm“, „unangenehm“, „widerlich“, „gut
tuend“, „bekömmlich“ oder „unbekömmlich“ usw. Insbesondere bei
Personenbeschreibungen überlappen sich die charakterisierenden und
wertenden Funktionen der Epitheta. So wird z. B. in „Buddenbrooks“
die Konsulin Elisabeth Buddenbrook beschrieben, mit der der Autor of-
fensichtlich sympathisiert. Er will, dass der Leser diese aparte und ver-
130
trauenswürdige Frau mit seinen Augen sieht und nicht weniger als er
(Autor) an ihrer soliden Schönheit Gefallen findet:
Sie war, wie alle Krögers, eine äußerst elegante Erscheinung, und war sie
auch keine Schönheit zu nennen, so gab sie doch mit ihrer hellen und besonne-
nen Stimme, ihren ruhigen, sicheren und sanften Bewegungen aller Wfelt ein
Gefühl von Klarheit und Vertrauen. Ihrem rötlichen Haar, das auf der Höhe
des Kopfes zu einer kleinen Krone gewunden und in breiten künstlichen Lo-
cken über die Ohren frisiert war, entsprach ein außerordentlich zartweißer
Teint mit vereinzelten kleinen Sommersprossen...
Bei der Beschreibung einer anderen Figur, der von Grünlich, schei-
nen die Liebe und Xfertrauen des Autors versiegt zu sein. Er mokiert sich
über Grünlichs Äußeres und seine Art und Wbise aufzutreten:
Durch den Garten kam, Hut und Stock in derselben Hand, mit ziemlich
kurzen Schritten und etwas vorgestrecktem Kopf, ein mittelgroßer Mann von
etwa zweiunddreißig Jahren in einem grüngelben, wolligen und langschössigen
Anzug und grauen Zwirnhandschuhen. Sein Gesicht unter dem hellblonden,
spärlichen Haupthaar war rosig und lächelte; neben dem einen Nasenflügel be-
fand sich eine auffällige Warze... Seine Favoris waren von ausgesprochen gold-
gelber Farbe...
Übrigens sieht Tonys Vater Grünlich anders als Tony, die ihn albern
findet. Der Konsul spart nicht mit wertenden lobenden Epitheta für
Herrn Grünlich, indem er auf seine Tochter einredet, Grünlichs Ange-
bot nicht abzuweisen, für ihn ist Grünlich „ein angenehmer, weitläufiger,
wohlerzogener, christlicher, tüchtiger, tätiger, galanter und fein gebildeter“
Mann. Leider hat sich der Konsul in seiner Bewertung nicht bestätigt
gefunden; eine logische Fabelentwicklung, der der Autor durch die Be-
schreibung Grünlichs schon vorgegriffen hat.
Die Auswahl und Verwendung der Beiwörter in einem wissen-
schaftlichen Text beruht nicht auf einem Erlebnis, das dem Leser
vermittelt wird, sondern auf der Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen
Objekten der realen Wirklichkeit. Die Epitheta sind hier sachlich,
konkretisierend, obgleich auch hier die Wertung nicht ausgeschlos-
sen ist, wenn etwas als nicht mehr dem modernen Stand der Erkenntnis
entsprechend beurteilt wird. In „Grundlagen der Untemehmensfuhrung“
aus dem Jahr 1991 findet sich die folgende Passage, in der die charakterisie-
renden Beiwörter gänzlich anders beschaffen sind, als in der Belletristik,
aber ebenfalls dem höheren Ziel der Anschaulichkeit dienen:
Statt bürokratischer Organisationen mit rigiden generellen Regungen, tief
gestaffelten Hierarchien, weit vorangetriebener Arbeitsteilung... kann man den
Gegentyp der flexiblen Organisation entwerfen mit flachen Hierarchien, hori-
zontaler und lateraler Kommunikation, wenigen allgemeinen Regelungen, par-
tizipativen Entscheidungsprozessen...
Unter den Beiwörtern gibt es solche mit stark differenzier-
ter Wirkung und solche mit gering differenzierter Wirkung.
131
Die Anschaulichkeit kann durch zu allgemeine Epitheta geschwächt
werden. Zu den schwach differenzierenden Beiwörtern werden zu allge-
mein wertende Wörter wie schön, gut, schlecht, böse, groß, klein usw ge-
zählt. Das Beiwort „schön“ kann z. B. etwas Angenehmes {schönes Wet-
ter), etwas Harmonisches {schöner Klang), etwas Ideales {schöne Seele),
etwas Wohlgefälliges {schönes Mädchen) meinen. Ein großes Haus kann
hoch, wuchtig, geräumig, verwinkelt, mehrstöckig, lang gestreckt, breit
u.a.m. sein [vgl. Sowinski, 1973, 55]. Eine anschauliche Beschreibung
muss also nach dem „treffenden“ Wort suchen.
In den meisten Fällen setzen die Epitheta dem übergeordneten Satz-
glied neue Informationen zu. Aber eine bestimmte Gruppe von Kombi-
nationen mit Beiwörtern basieren nicht darauf, neue Informationen zu
erschließen. Sie dienen eher einer spezifischen Symbolisie-
rung. Ein solches Beiwort wird „Epitheton ornans“ (schmückendes
Beiwort) genannt. Es ist eine Figuration alter Volksdichtung und dient
der typisierenden und symbolisierenden Hervorhebung charakteristi-
scher Merkmale. In Bezug auf die volksnahe Dichtung werden solche
Epitheta auch „stehend“ genannt, z. B. eine schöne Jungfrau, tiefes Tal.
der hohe Berg, kühler Wein, der grüne Wald, das rote Blut usw.
Stehende Epitheta sind auch der heutigen Gegenwartssprache geläu-
fig und werden hier formelhaft verwendet, wie liebe Reisende, hohe Gäs-
te, hochverehrte Damen und Herrn, der teure Tote. Im Unterschied von
der volkstümlichen Dichtung können sie aber nicht als „schmückende
Beiwörter“ bezeichnet werden, denn ihre Funktion besteht nur in der
formelhaften Typisierung.
§ 28. Der Vergleich und seine stilistischen Werte
Neben den unmittelbaren sprachlichen Bildern wie Epitheta sowie
anderen sprachlichen Konfigurationen, die an der Vorstellungs- und As-
soziationswelt des Lesers rütteln, und die der Leser auf Grund seiner ei-
genen Erfahrung miterlebt, gibt es Bilder, in denen zwei oder mehrere
Bildbereiche zu einer Aussage Zusammenwirken, so dass der Bildsinn
das Gemeinte nur mittelbar ausdrückt. Diese mittelbaren oder übertra-
genen Bilder sind seit alters her bekannt und werden in der antiken Rhe-
torik als Tropen gekennzeichnet. Zwischen den unmittelbaren und den
mittelbaren Bildern ist der Vergleich einzuordnen. Hier wird das Ge-
meinte nicht durch die ihm angemessenen Wörter ausgedrückt, sondern
durch Hinzufügung eines Wortes aus einem anderen Sinnbereich.
Die Verbindung von zwei Wörtern (Begriffen) wird möglich durch eine
gemeinsame Eigenschaft beider Begriffe, die als Vergleichsbasis oder la-
teinisch das tertium comparationis bezeichnet wird. Die erste Vorstellung
(Wort) wird mit der Vergleichsvorstellung mit Hilfe einer Vergleichspar-
tikel {wie, als ob, als) oder eines Vergleichsverbes (z. B. gleichen, ähneln)
zusammengefugt. Die Vergleiche können auf Grund der direkten Be-
132
deutungen der Komponenten entstehen oder kann die zweite Kompo-
nente umgedeutet, übertragen sein. Aber die beiden Abarten der Verglei-
che laufen darauf hinaus, dass der Vergleich ein Mittel des bildlichen
Ausdrucks bleibt, denn durch die Zusammenführung der Begriffe aus
unterschiedlichen Sinnbezirken entsteht eine dritte Vorstellung, die
weder mit der ersten, noch mit der zweiten zusamenfallt.
Die menschliche Erkenntnis geht den Weg der Suche nach Ähnlich-
keiten zwischen dem, was in der praktischen Erfahrung schon da ist und
dem, was neu erkannt und erschlossen werden soll. Wenn keine Ähn-
lichkeiten vorliegen, geht die weitere Suche nach Gegensätzlichkeiten.
Wenn weder Ähnlichkeiten noch Gegensätzlichkeiten vorhanden sind,
wenn nicht einmal ein komplementäres (ergänzendes) Verhältnis mög-
lich ist, gehören die auszuwertenden Begriffe nicht in ein mentales Kon-
zept hinein. Das schließt aber nicht aus, dass nicht ein drittes Verhältnis
durch das menschliche Gehirn entdeckt oder erfunden wird. Es entste-
hen dann „kühne“ Bilder, die nicht für alle Sprachträger gleich ver-
ständlich werden. Sie müssen dann „entschlüsselt“, ausgewertet werden
in einem „breiterem“ Sinnzusammenhang: im Kontext der Zeit, des
Ortes, des Funktionalstils, der Gattung, der individuellen schöpferi-
schen Schreib- oder Sprechmanier.
Die Begriffsbereiche, auf denen die Vergleichsbasis beruht, können aus
der näheren menschlichen Umgebung stammen. Es entstehen in diesem
Fall konventionelle Vergleiche, die für die meisten Sprachträger eines Kul-
turareals einleuchtend wirken. Sie können in vielen funktional bedingten
Sprech- bzw. Schreibsituationen gebraucht werden und nicht nur in der
schöngeistigen Literatur. Konventionelle „Alltagsvergleiche“
werden im tagtäglichen Umgang fast spontan „geboren“. Somit sind sie
die Elemente des sprachlichen Schöpfertums der Individuen, aber im
Unterschied zu den bildlichen Vergleichen in der Belletristik überzie-
hen sie nie das Auffassungsvermögen des Rezipienten und schaffen kei-
nen großen Verfremdungseffekt. Wenn jemand sagt Du bist heute wie
Schlagsahne, entsteht ein spontaner Vergleich, der aber auf die Wahrneh-
mung, Deutung und Reaktion des Rezipienten „eingestellt“ ist. Vorpro-
grammiert wird durch diesen Vergleich eine positive Reaktion. Der Rezi-
pient muss sich zumindest geschmeichelt fühlen, wenn er mit leckerer
Schlagsahne verglichen wird. Außer den spontanen Redevergleichen gibt
es einen kulturspezifischen Bestand an Vergleichen, der für ein Kulturareal
oder für mehrere typisch ist. Im europäischen Kulturareal z. B. sind solche
Vergleiche allgemein verständlich, wie dumm wie Stroh, dürr wie eine
Spindel, lang wie ein Baum, langsam wie eine Schildkröte, stumm wie ein
Fisch u. a. m. Sie beruhen auf der allgemeinen menschlichen Praxis und
Erfahrung der Europäer. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Ver-
gleich glatt wie ein Aal in den Kulturen nicht rezipiert werden kann, in
denen die Vorstellung über diesen Fisch fehlt, und wo man nicht einmal
weiß, dass es ein Fisch ist. Dem russischsprachigen Redeempfanger wird
wohl der Vergleich tot wie eine Maus Schwierigkeiten beim „Enträtseln“
133
bereiten, obgleich sie nicht unüberwindbar sind, weil in beiden Arealen
kulturspezifische Gemeinsamkeiten überwiegen.
Die Vergleiche werden oft nicht nur zur Veranschaulichung der Ei-
genschaften herangezogen, sondern auch zur begrifflichen Er-
läuterung im Stil der Wissenschaft und in Publizistik.
Sie sind ebenfalls konventionell und auf allgemeines Verständnis einge-
stellt: Masse wie Brei, Teig, dicke Sahne oder die Entscheidung kam wie
ein Blitz. Viele Vergleiche mit konventionalisierter Vergleichsbasis kön-
nen im Deutschen zu einer lautlichen Hülle verschmelzen und somit zu
einem Wort als Einheit des Bezeichneten und des zu Bezeichnenden,
wenn man das Wort als sprachliches Zeichen akzeptiert. Auf diesem
Wege entstanden strohdumm, mausetot, spindeldürr, baumlang, elefanten-
dick, rabenschwarz, felsenfest, federleicht usw.
Aus den Vergleichen, die zur Begriffserläuterung eingesetzt werden,
ergeben sich oft adjektivische Bezeichnungen, wie breiartig, teigförmig,
säureariig, löffelförmig und anderes mehr, die mit Hilfe von Halbsuffixen
abgeleitet werden. Der konventionelle Xbrgleich tendiert im Prinzip zur
Vereinheitlichung seiner Form in einem Wort.
Eine ziemlich ausgebaute Gruppe von kulturspezifischen Vergleichen
beruht auf etwaigen Kultur-, G esc h icht e- und Literaturtra-
ditionen. Solche Vergleiche gehen auf kulturspezifische mentale
Konzepte zurück, die als Schlüssel zum Verstehen funktionieren. Der
Grad ihres Verstehens oder ihrer Akzeptanz innerhalb eines Kulturareals
kann nur ermittelt werden, wenn davon ausgegangen wird, dass alle,
nicht alle, weniger als eine Hälfte oder etwa ein Drittel der Sprachträger
mit der betreffenden Tradition, historischem Ereignis und einem schön-
geistigen Werk auf Grund ihrer Vorbildung vertraut sind. Er verhält sich
wie Napoleon wird wohl wegen Bedeutsamkeit des zu Grunde liegenden
Ereignisses von den meisten Europäern verstanden, aber auch bei sol-
cher fast allgemein gültigen Akzeptanz dieses Vergleichs im europäi-
schen Großraum können Störungen auftreten, die in der Regel in den
wegen niedrigen Bildungsstandes eingeschränkten Vorkenntnissen ver-
wurzelt sind. Der analoge Vergleich Er verhält sich wie ein Pluschkin hat
eine noch enger zugeschnittene Xbrgleichsbasis und wirkt nur im rus-
sischsprachigen Kulturareal als einleuchtend.
Eine weitere Gruppe von kulturspezifischen Vergleichen nimmt ih-
ren Anfang in der Myth ologie, die als gesamteuropäisches Literatur-
und Kulturgut gilt. Auch bei dieser Gruppe handelt es sich um eine ein-
geschränkte Akzeptanz der Vergleichsbasis. Die Verstehensstörungen
sind hier zumeist mit unzulänglichem Bildungsstand der Sprachträger
verbunden. Die Vergleiche, wie Zu Hause war sie wie eine Xanthippe, Das
Problem war noch schwieriger zu lösen, als den gordischen Knoten durch-
zuhauen', Die Versuche, diese Erscheinung wissenschaftlich zu begründen
und theoretisch zu untermauern, wirkten wie ein Prokrustesbett, in das sich
die Fakten nicht einpferchen ließen gehören eindeutig nur in den Usus
der bildungstragenden Schicht der Bevölkerung und dienen als eigenar-
134
tiges Statussymbol der sozial- und bildungsmäßig höher stehenden
Sprach- und Kulturträger.
In der schöngeistigen Literatur ist der Vergleich seinem
Wesen nach anders geartet, als in den anderen Bereichen, die mit der
Redeproduktion verbunden sind. Hier ist es nicht relevant, ob die Ver-
gleichsbasis mehr oder weniger von den Sprachträgern akzeptiert und
verstanden wird. Hier kommt es darauf an, welche Absicht der Autor in
den von ihm geschaffenen Vergleich einlegt. Das tertium comparationis
kann hier ruhig außerhalb der allgemein menschlichen Praxis oder Er-
fahrung liegen, denn es ist dem Autor allein vorbehalten, seine
eigene individuelle Sicht anzudeuten. Es handelt sich um eine individu-
elle Vorstellung und individuelle Einbildungskraft, die im Prozess der
Rezeption in dem Bewusstsein des Lesers bildkräftig nachwirkt. Im Un-
terschied zu den konventionalisierten und kulturspezifischen Verglei-
chen ist der auktoriale bildliche Vergleich nicht reproduzierbar, nicht
nachvollziehbar im allgemeinen Gebrauch. Er bleibt in den meisten
Fällen eine Einmalbildung mit Bezug auf die Individualität des Schöp-
fers. Hier bringen wir als Beispiel einen erweiterten, mehrere Sätze um-
fassenden Vergleich aus „Iphigenie auf Tauris“ von J.W. Goethe:
Denn wie die Flut, mit schnellen Strömen wachsend,
Die Felsen überspült, die in dem Sand
Am Ufer liegen, so bedeckte ganz
Ein Freudenstrom mein Innerstes.
Der Vergleich kann im Gleichnis zur selbstständigen literarischen
Form werden. Das Gleichnis stellt ein analoges Geschehen für eine
ähnlich geartete Situation der Wirklichkeit dar. Der Vergleich steht in
systemhaften Beziehungen mit der Metapher. Wenn aus der Struktur des
Vergleichs die komparative Kopula (als, wie, als ob) ausgeschlossen
wird, entsteht eine Metapher. Das Verhältnis der Ähnlichkeit wird im
Satz zum Verhältnis der Identität umgewandelt: Dieses Mädchen
ähnelt einer Puppe wird zu Dieses Mädchen ist eine richtige Puppe. Aber
dieses \brfahren, Metaphern zu produzieren, gilt nur für substantivische
Metaphern. Im Unterschied zum Vergleich erschließt die Metapher das
Verhältnis der stabilen Identität und das Wesen des Gegenstandes oder
der Erscheinung. Deshalb lassen sich die metaphorischen Äußerungen
in die Koordinaten der Zeit und des Ortes nicht einbetten. Man kann
unmöglich sagen: In dieser Woche war er im Wald ein Hase, während für
den Vergleich die Einschränkung auf Zeit und Episode ganz typisch ist:
In dieser Minute ähnelte er einem wütenden Tiger.
§ 29. Stilwirkungen der Metapher
Die Metapher ist eine nächste Form (nach dem Vergleich) der indi-
rekten, vermittelten Bildlichkeit. Das „Geheimnis“ der Metapher ver-
135
suchen die Linguisten und Literaturforscher sowie Dichter und Psy-
chologen zu erforschen. Über die Metapher ist eine riesige Anzahl von
wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben, in denen versucht wird, das
Wesen der Metapher sowie ihren ästhetischen Wert zu ermitteln. Die
Metapher hält heute Einzug in fast alle Bereiche der menschlichen
Kommunikation, ausgenommen vielleicht einige Gattungen des offi-
ziellen Verkehrs: Gesetze, Befehle, Satzungen, Anordnungen, Resolu-
tionen, Patente, Mahnbriefe u.a.m. Da, wo etwas strikt eingehalten
oder kontrolliert werden muss, da, wo die Einigkeit das höchste Gebot
bei dem Zustandekommen der Kommunikation ist, ist der Gebrauch
der Metapher so gut wie ausgeschlossen. Für die Erklärung der Meta-
pher ist die gängige Formel, nach der die Metapher ein Ergebnis der
Bedeutungsübertragung nach Ähnlichkeit sei, bei weitem nicht hinläng-
lich. Heute wird die Metapher als ein eigenartiger Erkenntnisvorgang
oder Mechanismus verstanden. Mit Hilfe der Metaphorisierung vertie-
fen wir unsere Vorstellungen über die uns umgebende Welt und schaf-
fen neue Hypothesen hinsichtlich der real vorhandenen oder eingebil-
deten Sachverhalte. Die Metaphern funktionieren als Vermittler
zwischen dem menschlichen Verstand und Kultur, schreibt E. Mac-
Co r m a c in seiner Arbeit über die kognitive Theorie der Metapher.
Neue Metaphern verändern die Sprache, die wir benutzen, aber
gleichzeitig verändern sie auch unsere Wahrnehmung der Welt. Da die
Metaphern den Wandel der Sprache selbst bewirken, spielen sie eine
bestimmte Rolle in der Evolution der Kultur und beeinflussen die
menschlichen Verhaltensweisen. Für die meisten Sprachträger bedeu-
tet die Metapher ein poetisches Ausdrucksmittel, die Metapher aber
durchdringt unser ganzes Leben und kommt nicht nur in der Sprache
zur Geltung, sondern auch im menschlichen Denken und Handeln.
Sie prägt unser mentales Begriffssystem und unsere Lebenserfahrung.
G. Lakoff und M. Johnson haben eine neue Abart der Metapher
vorgeschlagen, die man „Orientierungsmetapher“ nennen könnte
[s. Jl3biK m MoflennpoBaHwe..., 1987, 126—170]. Nach ihrer Meinung
ist das menschliche Begriffssystem metaphorisch eingerich-
tet. Wir lassen uns von metaphorisierten Begriffen lenken, die die All-
tagstätigkeiten der menschlichen Individuen ordnen.
Die ordnende Funktion der metaphorisierten Grundbegriffe ist an
der Sprache „ablesbar“ und durch die Sprache wissenschaftlich und
praktisch belegbar. Das Wesen der Metapher sehen diese Forscher darin,
dass das Verstehen und Erleben der Erscheinungen einer Art in den Ter-
mini (sprachlichen Bezeichnungen) einer anderen Art erfolgt. Die Ori-
entierungsmetapher „Auseinandersetzung (Streit) sei ein Krieg“ ist
z. B. in zahlreichen und und vielfältigen sprachlichen Ausdrücken be-
stimmbar: diese Position ist unanfechtbar, er hat meine Position angegrif-
fen', er hat meine Argumente zerschlagen*, er hat im Streit gesiegt oder eine
Niederlage erlitten*, er hat ein bestimmtes strategisches Ziel verfolgt, da aber
seine taktischen Gänge verfehlt waren, wurde er vernichtet usw. In unseren
136
realen Streiten und Diskussionen richten wir uns nach den Begriffsbe-
zeichnungen aus dem Begriffsumfeld einer kriegerischen Auseinander-
setzung und dieser Umstand dominiert auch unsere Verhaltensmuster
bei einem Streit: Angriffe Verteidigung, Rückzug (Kompromiss), Gegenan-
griff und Ähnliches. Die Begriffsmetapher „Streit ist Krieg“ gehört zu
den kulturspezifischen Metaphern; man kann sich leicht eine andere
Kultur vorstellen, wo der Streit gar nicht in den Bezeichnungen der
Kriegsführung gedeutet wird.
Zumindest das europäische Kulturareal kennt noch eine weit verbrei-
tete Orientierungsmetapher: „Zeit ist Geld“. Unser Privatleben, unse-
re Wirtschaft, unsere Gesellschaft und Kultur haben wir nach dem 250
Jahre alten, grob vereinfachenden Prinzip „Zeit ist Geld“ ohne Rück-
sicht auf natürliche Rhythmen und Zeitabläufe bis zum Extrem be-
schleunigt. Unser Zeitverständnis macht die Zeit zu einer Ware, die täg-
lich gegen Geld eingetauscht, kalkuliert und manipuliert wird. In der
westlichen Kultur wird auch der Begriff „Arbeit“ mit der dafür ange-
wendeten Zeit verknüpft. Die Metapher „Zeit ist Geld“ hat vielfältige
Ausdrucksformen sowie in der Sprache als auch im realen Leben: wir
bezahlen „Sprechzeittelefongebühren“, beziehen „Zeitlohn“ und tilgen
„Monatszinsen auf ein Jahreskredit“, wir „sparen“ oder „verschwen-
den“ unsere Zeit, wir „investieren“ nicht nur Geld, sondern auch Zeit
in die Zukunft unserer Kinder, beim Einstieg in neue Geschäfte kommt
es für uns auf „Zeitgewinn“ an, während „Zeitverlust“ im harten Wett-
bewerb tödlich sein kann. Wir konsumieren die Zeit, wir verspüren das
Gefühl der akuten Zeitverknappung. Die Implikation der Metapher
„Zeit ist Geld“ kennzeichnet in unserer Kultur ein weit verzweigtes
System der sprachlichen Ausdrücke, die selbst Teilmetaphern sind, aber
ihrer metaphorischen Bedeutung sind sich die Sprachträger gar nicht be-
wusst, denn sie handeln und denken nach stereotypen vorgegebenen
Denkmodellen. Jede Kultur verfügt über bestimmte Wertvorstellungen,
die nicht unbedingt in der anderen Kultur akzeptiert werden müssen. Es
ist kaum zu glauben, dass z. B. irgendwo in Tibet die Buddhisten genau
so wie die Leute im Westen unter Zeitverknappung leben müssen oder
Zeit zu sparen versuchen.
Die Metapher ist schon längst nicht nur ein poetisches Bild, sie ist
ein wesentliches Element des nicht dichterischen Ausdrucks geworden.
Hören wir von „schallschluckenden“ Autokarosserien, rät man uns
Hemden „tropfnass“ aufzuhängen, so spüren wir auch in der Sach-
prosa einen Drang nach Anschaulichkeit durch die Metapher. Schon
das alte Handwerk hat zahlreiche metaphorische Fachausdrücke heraus-
gebildet, die meist dem Tier- und Pflanzenreich, der Sphäre des
menschlichen Körpers und dem Umkreis des einfachen sozialen Lebens
entnommen sind: Eule, Fuchsschwanz, Krallendübel, Schnecke, Stock-
schnabel, Birne, Backe, Gelenk, Knie, Nadel, Naht usw. Viele Ausdrücke
haben längst ihre Bildkraft eingebüßt und sind allgemein verwendbar ge-
worden: Feder, Flügel, Gabel, Hahn, Manschette, Welle, Zahn u.a.m.
137
Aber wenn sie auch im Allgemeinen keine sinnfälligen Vorstellungen
mehr erwecken, gehören sie immer noch zu den anschaulichen
Elementen. Aber auch nicht verblasste lebende Metaphern machen es
möglich, abstrakte Vorgänge in der Widerspiegelung durch anschauliche
Metaphern zu erfassen: Preisschere, Warenfluss, Warenstau, Datengrab,
Datenschwemme, Kreditpolster usw. Im Buch „Dialektik der Entwicklung
objektiver Systeme“ von G.Pavelzig ist z.B. Folgendes zu lesen (zit.
nach: Möller, 1983, 177)\ „Auf diesem Gebiet stehen wir erst auf der Ge-
burtsschwelle der tiefgründigen wissenschaftlichen Einsicht in die Grund-
prozesse der Vererbung und Veränderung“
Starke BegrifTlichkeit ist heute in der Wissenschaftsprosa un-
vermeidlich. Gerade deshalb soll der Sachdarsteller darauf bedacht sein,
dort, wo es möglich ist, die Anschaulichkeit zu wahren. Die auf Verglei-
chen und Metaphern beruhende Bildlichkeit kann das Begreifen eines
Sachverhalts erleichtern, wie etwa im folgenden Beispiel:
Mit einem solchen Potentialberg ist jeder positive Atomkern umgeben. Ihn
gilt es zu erklimmen, wenn ein Proton oder ein anderes positives Teilchen in
den Kern eindringen will. Kommt es mit nur geringer Geschwindigkeit heran,
so wird es den Gipfel nicht erreichen, sondern auf halber Höhe umkehren. Er-
reicht das Proton die unmittelbare Nähe des Kerns, so treten plötzlich neuarti-
ge Kräfte auf. Der Potenzialberg reicht nicht in den Himmel, sondern hat
gleichsam oben ein Loch wie ein offener Vulkan. Ein Teilchen, das den oberen
Rand des Walles einmal erreicht hat, stürzt dann in diesen Potenzialtopf hinein.
(zit. nach: Möller, 1983, 180)
In der Lehre über die Untemehmensfuhrung werden des Öfteren Klas-
sifikationen angeboten, deren Rubriken metaphorisch beschaffen sind und
dadurch stark anschaulich wirken, was das Verstehen der Rubrizierung för-
dert und die gemeinten Sachverhalte mit einem Minimum an Erläuterung
eindeutig erfassen lässt. Dadurch kommt eine Basisfunktion des metaphori-
schen Ausdrucks zur Geltung: die Metapher lässt an sprachlichem Aus-
druck sparen und den Weg zum konzeptualen Verständnis minimieren. Im
Lehrbuch „Management. Konzepte, Funktionen und Praxisfälle“ können
wir über die folgende Matrix-Klassifikation lesen:
(1) Stars
Dies sind Geschäftsfelder, die einen hohen relativen Marktanteil in schnell
wachsenden Märkten besitzen...
(2) Cash-Kühe
Die „Cash-Kühe“ erwirtschaften in reifen Märkten auf Grund ihrer sehr
guten Wettbewerbsposition hohe Erträge...
Diese Geschäftseinheiten sind in wachsenden, attraktiven Märkten mit ei-
nem geringen Marktanteil vertreten. Sie stellen also quasi eine ungenutzte
Chance dar.
(4) arme Hunde
Die „armen Hunde“ stellen die ungünstigste Position in der Matrix dar: es
sind Geschäfte mit schwacher Wettbewerbsposition in unattraktiven Märkten...
138
Im angeführten Beispiel wird jede Klassifikationsposition so erläu-
tert, als wäre es die Vergleichsbasis, das tertium comparationis, d. h. das
Gemeinsame, der Ähnlichkeitsbezug, auf dessen Grundlage die Begriffe
aus verschiedenen mentalen Bereichen zusammengefuhrt werden.
Jede Metapher ist in Gefahr, ihre Bildhaftigkeit zu verlieren und zu
einer einfachen Formel zu werden. Dichter, Journalisten und Redner
versuchen solchen Erstarrungstendenzen durch immer neue Metaphern
entgegenzuwirken. Aber dichterische, journalistische oder rednerische
Metaphern sind etwas anders beschaffen, als z. B. die in der Sachprosa.
Die Metapher in der Dichtung ist organisch mit der poetischen Er-
schließung der Welt durch den Autor verknüpft. Solche Metaphern ha-
ben ästhetische Wirkung. Das dichterische Schaffen dieses oder je-
nes Autors wird ziemlich oft durch die Metaphorik bestimmt, die für ihn
(den Autor) kennzeichnend ist. Der Dichter verzichtet auf die konven-
tionelle Sicht, auf die konventionelle Auffassung der Welt, er will nicht
den Weg des Üblichen gehen.
Er macht sich auf den Weg durch den dichten Wald der sprachlichen
Ausdrücke und sucht Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Be-
griffsbereichen. Solche Übereinstimmungen mit der sinnlich erfahrba-
ren Realität sollen nicht nur seinem künstlerischen Konzept, seiner
künstlerischen Absicht, sondern auch seinem Gemütszustand entspre-
chen. Die künstlerische Metapher in reiner Form ist egozentrisch,
sie braucht weder verstanden, noch akzeptiert zu werden. In den meis-
ten Fällen stellt sie eine einmalige und einzigartige Bildung dar, ein
Bild, das von den üblichen Erfahrungen der sinnlich wahrnehmbaren
Realität abweicht. Eine künstlerische, poetische Metapher verfremdet
eher, als dient sie den Zwecken der Erläuterung oder Verstehenserleich-
terung. In P Celans Gedicht „Todesfuge“ lesen wir:
Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken
sie nachts wir trinken und trinken...
(zit. nach: Sowinski, 1973, 307)
Die „schwarze Milch der Frühe“ steht hier für das todbringende Le-
ben und Leid der Juden in einem Konzentrationslager. Aber „enträtselt“
kann diese Metapher nur im Kontext des gesamten Lebens und Schaf-
fens des Autors, im Kontext seiner Erfahrung und seiner Sehweisen wer-
den. Solche individuellen dichterischen Metaphern nennt man „kühne
Metaphern“ oder auch Chiffren. Die Chiffren sind im Prinzip nicht rea-
litätskonform und besitzen vielmehr einen assoziativen oder
symbolischen Verweiswert eigner Art. In jedem Text erfordern sie
eine gesonderte Auslegung aus dem Gesamtzusammenhang, soweit es
überhaupt möglich ist. Häufig finden sie sich in der Lyrik expres-
sionistischer Dichtung sowie bei Lyrikern der Gegen-
wart. Die Vergleichsvorstellung wird bei kühnen Metaphern oder Chif-
fren nicht bewusst. Der expressionistische Dichter Georg Trakl schafft
139
eine verfremdende metaphorische Abbildung der Realität, indem er
„Gesang des Abgeschiedenen“ schreibt:
... Es haben die grünen Wälder
Am Abend sich zu stillen Hütten versammelt;
Die kristallenen Weiden des Rehs...
Derselbe metaphorische Wortgebrauch kann bei verschiedenen
Dichtern mit unterschiedlichen assoziativen und inhaltlichen Werten
gebraucht werden. Das Gedicht „Weiterung“ von Hans Magnus Enzens-
berger erschien in seiner Sammlung „blindenschrift“ vom Jahre 1964
und ist inhaltlich durch die Metapher „FLUT“ geprägt. Für ihn bedeu-
tet die Flut eine weltweite Katastrophe, einen Weltuntergang, dem
nichts und niemand entkommt. Die Flut verschont niemand, nachher
gibt es keine Überlebenden mehr:
wer soll da noch auftauchen aus der Flut,
wenn wir darin untergehen?
noch ein paar fortschritte,
und wir werden weitersehen,
wer soll da unserer gedenken
mit nachsicht?
das wird sich finden,
wenn es erst soweit ist.
und so fortan
bis auf weiteres
und ohne weiteres
so weiter und so
weiter nichts
keine nachgeborenen
keine nachsicht
nichts weiter
Bestimmt kannte Enzensberger, dass es ein Gedicht von Bertolt
Brecht gibt mit der textprägenden Metapher „DIE FLUT“:
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut
in der wir untergegangen sind
gedenkt
wenn ihr von unseren Schwächen sprecht
auch der finsteren Zeit
der ihr entronnen seid.
Ihr aber, wenn es soweit sein wird
daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
gedenkt unserer
mit Nachsicht.
Es ist klar, dass der Lyriker Enzensberger in seiner Version der Flut
der Fassung von Bertolt Brecht, die gegen Ende der dreißiger Jahre irn
Exil entstanden ist, nicht zustimmt. Brechts „Flut“ als Metapher für fa-
schistische Herrschaft scheint ihm zu eng und zu optimistisch zu sein.
140
Seine „Flut“ ist mit einem anderen Sinn behaftet und beruht auf einer
anderen gefuhls- und erfahrungsmäßigen Prognose der weiteren Ent-
wicklung, genauer gesagt, der ausbleibenden Entwicklung. Enzensber-
gers „Flut“ setzt den Punkt (keine nachgeborenen, keine nachsicht), bei
B. Brecht steht an dieser Stelle das Zeichen der Fortsetzung (Ihr, die ihr
auftauchen werdet aus der Flut... gedenkt... auch der finsteren Zeit).
Im Unterschied zu der individuellen künstlerischen Metapher ist die
journalistische Metapher in Massmediatexten ein Ausdruck
„kollektiver“ Erfahrungen und Assoziationen. Sie ist nicht dazu be-
rufen, den Gemütszustand des Dichters zu reflektieren, sondern die Ge-
müter der Leser zu bewegen. Das tertium comparationis einer solchen Me-
tapher darf keine Verfremdung bei der Wahrnehmung zur Folge haben:
„... die meisten Konzerne und Großunternehmen am Rhein und Ruhr... droh-
ten der IG Metall unverhüllt mit dem Gespenst der Arbeitslosigkeit... “
Strukturell gibt es mehrere Arten der Metapher, die von den einzel-
nen Autoren in verschiedenem Umfang gebildet und verwendet werden.
Eine der einfachen Formen ist die Genitivmetapher, d. h. eine Kombina-
tion von einem Substantiv im Nominativ, welches als Bildspender fun-
giert, und einem Substantiv im Genitiv, das meist Bildempfanger ist.
Solche Formen können aus einem Vergleich hervorgegangen sein und
fuhren leicht zu metaphorischen Zusammensetzungen: Zelt des Him-
mels, Gerüst einer wissenschaftlichen Theorie.
Eine andere Form ist die Verbindung von metaphorischem Adjektiv
und Substantiv: ein süßer Ton, die spröde Erde*, ein wildes, irres Glück.
Als dritte Variante kommt die Verbmetapher in Frage, derart wie Perso-
nifizierungen: das Herz redet mir zu oder die Antwort weiß allein der Wind.
Von der Verbmetapher ist nur ein kleiner Schritt zur Satzmetapher,
die mehrere Metaphern vereinigt, wie bei H.Böll in der Novelle „Die
Botschaft“: „Es war unsagbar still, jene Stunde, wo die Dämmerung noch
eine Atempause macht, ehe sie grau und unaufhaltsam über den Rand der
Feme quillt... “
Die Metapher kann auch satzübergreifend sein, d.h. auf einen gan-
zen Text oder eine Textpassage ausgebaut und erweitert werden, wie es
öfters W. Borchert gemacht hat:
Hamburg!
Das sind diese ergrauten, unentbehrlichen, unvermeidlichen Unendlichkei-
ten der untröstlichen Straßen, in denen wir alle geboren sind und in denen wir
alle sterben....
Hamburg!
Das sind die tropischen tollen Bäume, Büsche und Blumen des Mammut-
friedhofes, dieses vögeldurchjubelten gepflegtesten Urwalds der Wdt, in dem
die Toten ihren Tod verträumen und ihren ganzen Tod hindurch von den Mö-
wen, von Mödchen, Masten und Mauern, den Maiabenden und Meerwinden
phantasieren... da schwatzen die Toten, die unsterblichen Toten vom unsterbli-
chen Leben! Denn die Toten vergessen das Leben nicht — und sie können die
Stadt, ihre Stadt, nicht vergessen!
141
Die künstlerische Metapher stellt als solche das stilistische Verfahren
der Charakterisierung dar. Sie ergibt oft ein solch hartes Urteil,
welches kein Richter fallen würde. H. Heine hat bekanntlich Metaphern
geschaffen, die an satirischer Ausdruckskraft vielen anderen Verfahren
zur Schaffung der satirischen Effekte überlegen sind. In seinem Roman
„Deutschland. Ein Wintermärchen“ finden sich zahlreiche Beispiele
dafür, wie durch die Metapher eine starke satirische Entfremdung ent-
steht. Der Autor offenbart durch die Metapher sein äußerst negatives
Urteil über den Gegenstand der Äußerung und komprimiert dieses Ur-
teil in eine bissige Metapher:
Zu Aachen, auf dem Posthausschild,
Sah ich den Vogel wieder,
Der mir so tief verhaßt! Voll Gift
Schaute er auf mich nieder.
„Der Vogel“ steht hier metaphorisch für das preußische Wappen, das
für den Dichter den verhassten preußischen Geist versinnbildlicht, des-
sen dominante Eigenschaft „der eingefrorene Dünkel“ ist.
Den Kölner Dom empfindet der Dichter als Bollwerk der preußi-
schen Orthodoxie, Starrheit, Geistlosigkeit, Rückständigkeit, wenn er
schreibt:
Er (Dom — N.A.) sollte des Geistes Bastille sein,
Und die listigen Römlinge dachten:
„In diesem Riesenkerker wird
Die deutsche Vernunft verschmachten!“
Der Dichter Heine liebt seine Heimat, hofft innigst darauf, dass die
großen Ideen der französischen Republik auch hier tief gehende X\knd-
lungen herbeiführen, sieht aber bei seiner Rückkehr aus Frankreich
nicht einmal geringste Veränderungen in Deutschland. Der Dichter ist
enttäuscht, erbittert, erbost über seine immer noch schlummernde und
den Wandel verschlafende Heimat. Er fühlt sich verwundet und erlaubt
sich ein erbittertes Urteil über die Vorgänge in Deutschland:
Das ist ja meine Heimatluft!
Die glühende Wange empfand es!
Und dieser Landstraßenkot, er ist
Der Dreck meines Vaterlandes*
Der Dichter hegt aber immer noch Hoffnungen darauf, dass
Deutschland aus seinem Winterschlaf erwacht, dass auch hier geistige
Freiheit herrschen wird, dass die preußischen Fesseln fallen, wenn sich
das Volk, „der große Lümmel“, der demokratischen Ideen annimmt,
wenn es (Volk) sie verinnerlicht:
Er nahte sich, und mit dem Beil
Zerschmetterte er die armen
Skelette des Aberglaubens, er schlug
Sie nieder ohn Erbarmen.
142
§ 30. Personifikation und Synästhesie als wichtigste
Erscheinungsformen der Metapher
Personifikation und Synästhesie sind sprachliche Ausdrucksformen
der Metaphorisierung, die auch in der Umgangssprache begegnen, in
der Dichtung jedoch als bewusste Stilmittel oder stilistische Verfahren
verwendet werden und stärkste Stilwirkungen ergeben.
Die Personifikation wird als Verlebendigung der von Natur aus nicht le-
bendigen Wesen und Dinge verstanden.
In dieser \brlebendigung sieht man ein grundsätzliches psychologi-
sches Phänomen, das sich auch im religiösen Animismus, in der Mytho-
logisierung, in der Sagen- und Märchenbildung sowie in stilistischen
Personifikationen und Allegorisierungen auswirkt. Die Personifizierung
kann sowie in neu gebildeten Ausdrücken begegnen, wenn den Nichtle-
bewesen Eigenschaften und Handlungen zugeordnet werden, die sonst
nur Lebewesen kennzeichnen können. In der Umgangssprache vollzieht
sich der beständige Vorgang der personifizierenden Metaphorisierung,
was zur größeren Lebendigkeit und Anschaulichkeit der Sprache bei-
trägt. Die schon vorhandenen Personifizierungen werden stets durch
neue erweitert, die aus dem Volksmund kommen oder aus der Dichter-
sprache übernommen werden, z. B. der Baum ächzt, die Liebe siegt, der
Himmel lacht, das Laub zittert, der Computer piepst, der Wind flüstert usw.
Die Personifikationen sind in allen funktionalen Stilen anzutreffen, aber
bevorzugt werden sie natürlich in der Dichtung. Die häufigste Form
ist die Zuordnung eines Verbs, das ein Lebewesen als Subjekt fordert, zu
einem Nichtlebewesen. Aber auch Beiwörter können bei der Personifi-
zierung von einem Lebewesen auf ein Nichtlebewesen übertragen wer-
den: der lachende Himmel, der flüsternde Bach usw. Die Personifizierung
kann eine Einzelbildung sein (der blinde Zufall), aber sie kann auch zu
einem durchgehenden stilistischen Verfahren der poetischen Schilde-
rung modifiziert werden und ein einheitliches poetisches Bild ergeben.
In diesem Fall wird der wichtigste Gegenstand der poetischen Schilde-
rung von vornherein in personifizierter Form als ein textprägendes Bild
impliziert, z. B. die Stadt, der Fluss, der Bach usw. Alle anderen Personi-
fikationen im Gesamttext ergeben sich dann aus der vorgegebenen Im-
plikation, fügen sich leicht in ein semantisches System ein und lassen
sich als einzelne Sprachumsetzungen eines einheitlichen personifizier-
ten Bildes ansehen. Erich Kästner impliziert z. B. die Personifikation der
Monate und versieht sie mit menschlichen Eigenschaften:
Umringt von Kindern wie der Rattenfänger,
tanzt auf dem Eise stolz der Januar...
Im Galarock des heiteren Verschwenders,
ein Blumenzepter in der schmalen Hand,
fahrt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,
aus seiner Kutsche grüßend, über Land...
143
Nun hebt das Jahr die Sense hoch
und mäht die Sommertage wie ein Bauer.
Wer sät, muß mähen.
Und wer mäht, muß säen... {August — N.A.)
Das Jahr wird alt. Hat dünnes Haar.
Ist gar nicht sehr gesund.
Kennt seinen letzten Tag das Jahr.
Kennt gar die letzte Stund. (Dezember — N.A.)
In der europäischen Literaturtradition wird die Zeit als höhere Ge-
walt empfunden, die das Schicksal des Menschen lenkt. Erich Kästner
liegt mit seinem Gedicht „Große Zeiten“ voll und ganz im europäi-
schen Dichtungstrend, wenn er schreibt:
Die Zeit ist viel zu groß, so groß ist sie.
Sie wächst zu rasch. Es wird ihr schlecht bekommen.
Man nimmt ihr täglich Maß und denkt beklommen:
So groß wie heute war die Zeit noch nie...
Wasser, ebenso wie Himmelskörper und Winde, unterliegen in der
dichterischen Kunst den ständigen personifizierenden Modifikationen.
Bei H. Heine ist es der Bach (Ilse) und der Vater Rhein in „Deutschland.
Ein Wintermärchen“, bei Th. Mann in „Tonio Kröger“ die Nordsee, bei
W. Borchert die Elbe: „Rhythmisch dumpfen sie dagegen, eintönig, gleich-
mäßig wie Atem. Denn der Wellengang der Elbe, der Stromatem, ist nun ihr
Rhythmus — das Wasser der Elbe ist nun ihr Blut... “
H. Heine lässt Vater Rhein die erbitterte Wahrheit über die deutschen
Verhältnisse sprechen und stellt somit die Personifikation in den Dienst
der Satire:
„Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb,
Daß du mich nicht vergessen;
Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht,
Mir ging es schlecht unterdessen.
Zu Biberich hab ich Steine verschluckt,
Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker!
Doch schwerer liegen im Magen mir
Die Verse von Niklas Becker.
Er hat mich besungen, als ob ich noch
Die reinste Jungfer wäre,
Die sich von niemand rauben läßt
Das Kränzlein ihrer Ehre.
Wenn ich es höre, das dumme Lied,
Dann möchte ich mir zerraufen
Den weißen Bart, ich möchte fürwahr
Mich in mir selbst ersaufen!..“
Seinen eigenen Zorn über das Gedicht des preußischen Juristen N.
Becker, das von antifranzösischen Stimmungen durchdrungen war („Sie
144
sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein“) lässt H. Heine den
Vater Rhein zum Ausdruck bringen, denn für Heine bedeutet „antifran-
zösisch“ in erster Linie alles, was gegen den Geist der Freiheit und De-
mokratie verstößt.
Unter Synästhesie wird die Verbindung von zwei verschiedenen Sinnes-
empfindungen verstanden, wobei die eine übertragene Bedeutung annimmt
oder ein gleichwertiges Nebeneinander verschiedener Bereiche bedingt
[vgl. Sowinski, 1973, 3JO].
Synästhesien treten sowie in der Umgangssprache auf als auch
in den schöngeistigen oder Journalistischen Textpro-
dukten auf. In der Synästhesie kann eine beliebige Vereinigung von
Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten vor sich gehen. Ist da-
bei die Vergleichsbasis leicht verständlich, gehen die Synästhesien in den
Gebrauch ein, wie etwa die Verschmelzung von Farben und Klängen.
Bei Mode sind z.B. folgende Synästhesien zu „Farbe“ üblich: grelle,
schreiende, giftige, harte, weiche, satte, kalte und warme Farben. Bei Mu-
sikern und Filmschaffenden sind mehrere Synästhesien mit „Stimme“
als Grundwort im Umlauf, z. B. harte, weiche, giftige, stumpfe Stimme.
Bei H. Heine entsteht mit „duftender Stimme“ eine Einmalbildung, bei
der das Vergleichsmoment subjektiv-emotional gefärbt ist. Die Synäs-
thesie entsprach den Forderungen der Romantiker nach dem Zusam-
mentreffen mehrerer Wirkungen im Gesamtkunstwerk. So enthält Bren-
tanos Gedicht „Abendständchen“ eine poetische Synästhesie, die den
Eindruck steigert:
Golden wehn die Töne nieder
durch die Nacht, die mich umfangen,
blickt zu mir der Tone Licht...
Die Synästhesie bleibt aber in der Dichtung nicht nur auf die roman-
tische Schule beschränkt. So ist bei G. Maurer in seinem Gedicht „Am
Fluß“ eine anschaulich wirkende poetisierende Synästhesie anzutreffen:
Nun sind sie ein glattes Gesicht.
Doch laß dich nicht täuschen:
Die Fische spielen unter dem Licht
mit grünen Geräuschen...
§ 31. Stilistische Wirkungen der Metonymie
Die antike Rhetorik hat eine Reihe von Wortersetzungen unter dem
Begriff der Metonymie (Namenvertauschung) zusammengefasst. Solche
Wortersetzungen sind auch heute üblich. Die Wortersetzung vollzieht
sich im Falle der Metonymie auf unterschiedlichem logischen Verhält-
nis. Es sind dabei folgende Ersetzungen verbreitet:
(1) des Autors für das Werk: Es ist ein echter Dürer, ich lese Schiller,
(2) der Wirkung für die Ursache: Erfügte ihm die Schmerzen zu\
145
(3) des Materials für den Gegenstand: Er stieß ihm das Eisen
(Dolch) ins Herz;
(4) der Perso n für die Sache: Cäsar (die Truppen Cäsars) zog an
den Rhein; der Nachbar (das Haus des Nachbarn) ist angebrannt;
(5) des Kollektivabstraktums für die Einzelnen: das ganze
Dorf feierte mit;
(6) des Rahmens für den Inhalt: er hat Köpfchen (Verstand); der
Kreml (Sitz der russischen Staatsleitung); der Himmel (Gott) steht ihm bei;
(7) der Gottheit für ihren Bereich: Er hat sich dem Bacchus
(Wein) ergeben;
(8) des Sinnbildes für die Abstraktion: schmutziger Lorbeer
(zweifelhafter Ruhm).
Die Metonymie, die auf einem Quantitätsverhältnis beruht, wird die
Synekdoche genannt. Dabei wird ein weiterer Begriff durch einen engeren
bezeichnet, z. B. das Ganze durch einen Teil. Der Teil steht dabei für das
Ganze, was pars pro toto auf Lateinisch heißt, z. B. ich rühre keinen Finger
dafür. In einer Synekdoche kann die Mehrzahl durch die Einzahl ersetzt
werden, z. B. edel sei der Mensch. Ein Einzelnes wird für die Bezeichnung
der Art oder Gattung verwendet: kein Hund (Lebewesen) kann davon leben.
Wenn der Eigenname durch die Nennung der Dienstbezeichnung,
der Herkunft, des Berufs oder einer Eigenart ersetzt wird, entsteht die
Antonomasie. Oft dienen die Antonomasien besonderen stilistischen
Zwecken. Sie wirken verhüllend, wie z.B. die graue Eminenz des
Bundeskanzlers oder charakterisierend tadelnd, wie z.B. die
Stillhaltepolitiker. Entscheidend für die Wirksamkeit der Antonomasie ist
die kontextuale Kennzeichnung des Gemeinten.
Metonymische Umschreibungen bewirken bildhaftere Ausdrucks-
weisen gegenüber abstrakten Bezeichnungen, deshalb sind sie z. B. für
politische Einstellungen sowohl in der Presse als auch in der Um-
gangssprache geläufig, z.B.: die Roten, die Linken; er ist rot, links,
braun eingestellt (als Politiker).
Auch bei Metonymien ist genau so wie bei Metaphern das Gefühl der
Übertragung, der Ersetzung mitunter schon verblasst. Man bedient sich
der Metonymien, ohne damit besondere stilistische Ansichten zu verfol-
gen. Wenn man z. B. sagt: Wir brauchen uns keine Sorgen ums täglich Brot
zu machen, denkt man gar nicht daran, dass „täglich Brot“ alle Dinge
bezeichnet, die für den menschlichen Unterhalt notwendig sind.
Die schöngeistige Literatur macht von der Synekdoche be-
vorzugten Gebrauch, denn gerade diese Art der Metonymie ermöglicht
die individuelle und anschauliche Identifikation des Objekts. Das Objekt
wird dank der identifizierenden Eigenart von den analogen Objekten ab-
gehoben. Bei W. Borchert wird die Synekdoche in der Erzählung „Die
Hundeblume“ zu einem Verfahren mit besonderer stilistischen Funkti-
on. Der Häftling sitzt in einer Einzelzelle, in der die Tür mit Eisenblech
beschlagen ist. Er ist „hilflos und konzentriert auf nichts als auf sich selbst,
ohne Attribut und Ablenkung und ohne die Möglichkeit einer Tat6. Ein Le-
146
ben außerhalb des Gefängnisses gibt es für ihn nicht. Auch Menschen,
die hier nur ihre Identifikationsnummer tragen, gehen ihn nichts an, er
ist ganz in sein Inneres versunken. Er kennt nur „Vordermann“, wenn
die Häftlinge auf den Gefängnishof ausgeführt werden. Sein Desinteres-
se an der Wirklichkeit nimmt ein Ende, wenn er einen Mithäftling beo-
bachtet, den er nur „die Perücke“ nennt, weil man dessen Glatze leicht
für eine Perücke halten könnte. „Die Perücke“ ist der einzige Mensch
hier, dessen menschliche Eigenschaften den Ich-Erzähler interessieren:
Aber zäh ist sie, diese Perücke — sie kann schon aus Bosheit allein nicht ab-
treten, weil sie ahnt, daß ich, ihr Hintermann, sie hasse...
Und ich hasse die Perücke, weil sie feige ist — und wie feige...
Die anfängliche Identifikation des „Vordermanns“ nach der Perücke
hält die Fabelentwicklung in der Geschichte aufrecht. Der Erzähler
macht sich im Weiteren Gedanken darüber, „warum man die Perücke ins
Gefängnis gesperrt hat, was für eine Tat sie begangen hat, was sie ausgefres-
sen hat, ob sie vielleicht etwas unterschlagen oder gestohlen haf!“ Es ent-
wickelt sich ein Verhältnis zwischen dem Ich-Erzähler und der „Perü-
cke“, welches eindeutig als Hass qualifiziert werden kann:
Oh, es würde mir leicht sein, sie (Perücke — N.A.) zu morden, und es könnte
ganz unauffällig geschehen... Ihr Kopf wäre in der Mitte auseinandergeplatzt...
und die wenigen Tropfen rote Tinte daraus hätten verlogen gewirkt wie Himbeer-
saft...
Der Hass aber erlischt, wenn die Perücke auf einem Gang durch den
Hof plötzlich umfällt und stirbt:
In dem Augenblick, als ich mit dem Mann, den ich die Perücke nannte,
Auge in Auge war und fühlte, daß er unterlag, dem Leben unterlag — in dieser
Sekunde verlief mein Haß wie eine Welle am Strand, und es blieb nichts als ein
Gefühl der Leere...
Die anfängliche und einzige Identifikation des Vordermannes gestaltet
sich zu einem Drama der Gefühle, aber solche Gefühle wie Hass, Mord-
lust sind an sich genommen anormal, abweichend, wenn der Mensch ein
normales gewöhnliches Leben lebt und nicht eingesperrt im Lager sitzt.
Für anormale Verhältnisse gibt es anormale Gefühle und statt Namen
Identifikationsnummern: „ Vielleicht würde alles anders werden, wenn sich
die Vordermänner mal nach ihren Hintermännern umsehen würden, um sich
mit ihnen zu verständigen. So ist aber jeder Hintermann — er sieht nur seinen
Vordermann und hasst ihn“, resümiert der Erzähler.
Die allen Literaturforschem gut bekannten Antithesen von H. Heine
können unter anderem auf Synekdochen gebaut werden, wie etwa die
folgende aus „Deutschland. EinWintermärchen“:
„Wir wollen auf Erden glücklich sein,
und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwarben.“
147
§ 32. Untertreibungen und Übertreibungen
Bei Untertreibungen und Übertreibungen geht es um den Ersatz ei-
nes gemeinten, aber nicht durch ein eigenes Wort ausgedrückten Sinnes
[vgl. Sowinski, 1973, 313]. Die Ersatzformen erkennen wir aus dem
Wortcharakter, der Aussagekonstruktionen, aus dem sprachlichen oder
situativen Kontext.
1. Die Untertreibung oder Abschwächung des Gemeinten kann
sprachlich auf verschiedene Art und Weise ausgedrückt werden. In
der Umgangssprache gibt es dafür Sonderformeln, wie das ist halb so
schlimm oder das tut nichts. Die abschwächende Funktion überneh-
men oft auch Diminutivformen, wie das war bloß ein Schmerzchen,
kein richtiger Schmerz. Auch adjektivische Zusätze sind üblich, um
Unangenehmes abzuschwächen, wie das war ja nur eine kleine Panne,
keine richtige Havarie. Das stilistische Verfahren, die Wirkung des
Unangenehmen abzuschwächen, heißt der Euphemismus. Die Eu-
phemismen gehen oft auf ursprüngliche Tabuierungen zurück. Man
hat sich z.B. gescheut (und diese Scheu ist bis heute noch nicht ver-
gangen), das Phänomen des Lebensendes unmittelbar zu bezeichnen,
daher gebraucht man für das Sterben und den Tod verscheiden, able-
ben, verlassen', das Irdische segnen usw. Gefährliches, z.B. im Krieg
wird oft auch durch Euphemismen untertrieben. In H. Bölls Novelle
„Wiedersehen in der Allee“ werden die feindlichen Artillerieangriffe,
die die Soldaten schon gewohnt sind, als „Orgel“ bezeichnet und
Bomben als „Eier“.
Die Sprachmanipulation durch Untertreibung gab es immer und
wird es noch weiter in der Sprache der Politik geben. In der Na-
zizeit wurden Zwangsdeportierte zu „Fremdarbeitern“, Massenmorde
zur „Sonderbehandlung“, Massenmorde an Juden zur „Endlösung“,
Rückzüge am Kriegsende zu „Frontbegradigungen“ usw.
Auch heute gibt es in der Politik, insbesondere in der Sozialpolitik,
recht viele sprachliche Gebrauchsweisen, die den direkten, oft unange-
nehmen Sinn abmildern helfen. Zumeist sind das neutralisiere n-
d e Begriffe, und ihre Interpretation hängt vom Standpunkt der einzel-
nen Sprecher ab, z. B. bedeutet die „Sozialverträglichkeit“ bei Lohnzah-
lungen, die bei Tarifverhandlungen als Schlüsselbegriff gebraucht wird,
dass die Arbeitgeber kaum auf Lohnanhebungen einigen werden oder
dass die Arbeitnehmer um sozialen Friedens willen keine überzogenen
Lohnansprüche erheben dürfen.
Die möglichen Härten im Geschäftsstil werden nach Möglich-
keit auch dank den Abschwächungen vermieden. In Mahnungen wird
z.B. zunächst recht höflich auf Versäumnisse hingewiesen, um den
Kunden nicht zu verärgern, z. B.: Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgan-
gen sein, dass am 1. 4. die erste Rate Ihrer Versicherungsprämie fällig war.
Bei Mode und Konfektionsverkauf gibt es besondere Euphemismen
für Damen und Herren, die nicht besonders gut gebaut und übergewich-
148
tig sind, z. B. vollschlank, mollig, beleibt, korpulent, stark (nur für Her-
ren) usw.
Eine Sonderform der Untertreibung stellt die Litotes dar, die Hervor-
hebung eines Faktums durch die Verneinung seines Gegenteils. Durch
die Aussage von dem, was nicht geschieht, wird die Aufmerksamkeit
stark auf das gelenkt, was geschieht, z. B. es ist nicht unwahrscheinlich', er
redet nicht schlecht, er hat dafür nicht wenig erhalten. Solche Untertrei-
bungen wie Litotes hängen mit einem Problemkreis zusammen, der
außerhalb der eigentlichen Stilistik liegt. Es ist die Haltung des Spre-
chers, der immer bestrebt ist, die Äußerung auf sich zu fokusieren und
weniger kategorisch in seinem Urteil zu wirken. Wfenn er sagt: „Es war
nicht schlecht“, bezieht er eine schwankende Position, denn allem An-
schein nach war es trotzdem etwas schlechter, als er erwartet hat. Er will
sich aber mit seinem kategorischen Urteil bloß zurückhalten, um seinen
Partner zu schonen.
2. Den abschwächenden Ausdrucksformen stehen die steigernden,
übertreibenden gegenüber, die unter dem Begriff der Hyperbel zusam-
mengefasst werden. Die Hyperbel kann in erstarrten sprachlichen For-
men erscheinen wie: todmüde, hundsmiserabel, spottbillig, splitternackt,
eine Ewigkeit warten, tausend Mal sagen, ein Loch in den Bauch fragen
usw. Auch die Hyperbel hängt mit der Haltung des Sprechers zusam-
men, der die Glaubwürdigkeit seiner Äußerung steigern will. Seine Hal-
tung ist gefühlsmäßig betont, was ihn zu einem Superstatement bewegt,
d.h. zu einem verstärkten Herausstreichen seiner einschätzenden Prä-
senz im Text.
Außer der Umgangssprache sind Übertreibungen oft in volks-
tümlichen Dichtungen anzutreffen, z. B. in Volksliedern:
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß,
wie heimliche Liebe, von der niemand weiß.
Hyperbolische Stilelemente gibt es auch in Werbe texten, die
stets positiv, hyperbolisch und superlativisch sein soll. Die Werbung ge-
braucht gern traditionelle Steigerungswörter, z. B. blitzneu, brandneu,
extrafein usw. Die Sprache der Werbung kennt auch viele steigernde Zu-
satzwörter, mit deren Hilfe Zusammensetzungen gebildet werden, wie
Wunderpreis, Großaktion, Doppeleffekt, Traumgeschwindigkeit, Weltfüh-
rer (bei Autos mittlerer Klasse). In Geschäftsbriefen haben sich
bis heute Steigerungen erhalten, wie zutiefst berührt, vollstes Verständnis,
baldmöglichst, allerbeste Ware usw. Viele von solchen Steigerungen wir-
ken heute archaisierend und werden von einem sprachlich geüb-
ten Schreiber bewusst vermieden.
Literaturnachweis
1. Die Differenzierung der Metapher in der Literatur der Moderne. Die li-
terarische Moderne in Europa. — Opladen, 1994.
149
2. Möller G. Praktische Stillehre. — Leipzig, 1983.
3. Sowinski B. Deutsche Stilistik. — Frankfurt/M., 1973.
4. ApynuoHoea H. MeTa<J)opbi w jjncKypc / C6. Teopwa MeTa<J)opbi. — M
1990.
5. Baciuibee B, FIpoOjieMbi coothouichmh kofhwtmbhofo m kommyhmk^-
TMBHOTO KOMIlOHeHTa BbICKa3bIBaHMH. — M., 1993.
6. ßeMbRHKOe B. KoFHMTMBHaR JIMHFBMCTMKa KHK pa3HOBMflHOCTb MHTep.
npeTwpyiomero no^xo^a// Bonpocbi H3biKO3HaHMa. — 1994. — Ns 4.
7. JlaKotyff) ß., ßdicoHcoH M. MeTa<J)opbi, kotopbimm Mbi xmbcm / C6. Teo-
pwa MeTacJjopbi. — M., 1990.
8. Yiuipciüm MeTa(j)opa w peanbHocTb / C6. Teopua MeTa<J)opbi. — M.,
1990.
9. 5l3biK m MoflejiwpoBaHwe couwajibHoro B3awMOfleucTBMa: C6. cTaTeu. —
M., 1987.
10. 5I3MK m MbiniJieHwe: C6. CTaTeft. — M., 1967.
11. Akoöcoh P. PaOoTbi no noaniKe. — M., 1989.
Kapitel 8
DARSTELLUNGSARTEN, TEXTTYPOLOGIEN
§ 33. Allgemeines zu den Darstellungsarten
Bei der Behandlung der funktionalen Stile sind wir davon ausgegan-
gen, dass der Stil eine variable Größe bei der sprachlichen Wiedergabe
von Sachverhalten ist. Der Stil bezieht sich immer auf eine Ganzheit
und stellt einen Merkmalkomplex dar, der jedem Text eigen ist.
Die Darstellungsarten sind ganz allgemein auch als Merkmalkomplex
von Texten zu bestimmen, aber dieser Merkmalkomplex ist nicht allen
Texten zuzuordnen. Der Terminus „Darstellungsart“ bezieht sich im
Gegensatz zum Stil nicht auf die Gesamtheit von Texten. Der Merkmal-
komplex der Darstellungsarten umfasst jene Elemente, die durch den
Charakter des zu gestaltenden Sachverhalts und die Relation Sender—
Sachverhalt bestimmt werden. In diesem Sinne nennt W. Hartung die
Darstellungsarten „relativ isolierte Teilstücke von Kommunikationsvor-
gängen“ [Hartung, 1970, 225],
Die für die Darstellungsarten relevanten Elemente von Texten sind
miteinander ziemlich fest verbunden und treten in einer bestimmten
Anordnung auf. Je nach dem Charakter des jeweiligen Typs der Darstel-
lungsart werden diese relativ festen Kombinationen von Elementen von
einer Gruppe von Stilzügen geprägt. So sind z. B. für den Bericht die
Stilzüge Objektivität, Exaktheit, Klarheit und relative Kürze wesentlich.
Im Textaufbau werden diese Züge durch das Merkmal der chronologi-
schen Abfolge ergänzt. Der Bericht kann entsprechend der Funktion ei-
nes Textes modifiziert werden: z. B. Polizeibericht zur Ermittlung des
150
Sachverhalts an die obere Dienststelle, der Polizeibericht über den glei-
chen Sachverhalt in der Presse, der mündliche Bericht eines Polizeian-
gehörigen in seiner Dienststelle usw. Aber allen diesen Texten ist die Ak-
tualisierung der oben genannten Züge gemeinsam, wenn der jeweilige
Text als Bericht identifiziert werden soll. Das bedeutet zugleich, dass die
Darstellungsarten nicht an bestimmte Funktionalstile gebunden sind.
Das Verhältnis zwischen Darstellungsart und Funktionalstil ist eine
Teil—Ganzes—Beziehung: Stilzüge der Darstellungsarten sind in die
umfassenderen Stilzugkomplexe der Funktionalstile integriert. Die ein-
zelnen Darstellungsarten können als komplexe fakultative Varianten
fungieren. Ein Verkehrsunfall kann sprachlich als Bericht oder als Er-
zählung gestaltet werden. Die Wahl wird vom Sprecher/Schreiber in ei-
ner konkreten kommunikativen Situation getroffen und hängt von den
Bedingungen der jeweiligen Kommunikationssituation ab.
Die Darstellungsarten sind elementare Verfahren der Textgestaltung, die
innerhalb des Textes auf eine bestimmte Weise strukturiert werden und von
denen die Struktur des Textes, dessen kompositorischer Aufbau in wesentli-
chem Maße geprägt werden.
Die Sachverhalte der objektiven Realität, also die Gegenstände mit
bestimmten Eigenschaften und den ihnen zugeordneten Relationen,
können sowohl im Zustand relativer Ruhe und Isoliertheit dargestellt
werden als auch in einer dynamischen Aufeinanderfolge verschiedener
Erscheinungen der objektiven Realität. Daher kann man vereinfachend
von der Darstellung von Gegenständen (Zuständen) und Vorgängen
(Geschehen) sprechen.
Die zweite Dimension für die Klassifizierung der Darstellungsarten
ist das Verhältnis des Senders zu den darzustellenden Sachverhalten.
Unter diesem Aspekt werden objektive und subjektive, nullexpressive und
expressive, sachbetonte und erlebnisbetonte Darstellungsarten unter-
schieden. Die einfachste Koordinatensystem verbindet die beiden Di-
mensionen der Klassifizierung und sieht vereinfacht so aus [vgl. Flei-
scher, Michel, 1977, 273]:
objektiv subjektiv
Gegenstand Beschreibung Schilderung
Vorgang Bericht Erzählung
Dieses Gerüst der Darstellungsarten wird in mehreren Klassifikatio-
nen durch den Darstellungstyp der Erörterung erweitert. Die Erörterung
ist dabei als argumentierende Auseinandersetzung mit bestimmten
Sachverhalten der objektiven Realität angesehen. Den Erörterungen lie-
gen Probleme als Realobjekte zu Grunde. Eine Problemsituation kenn-
zeichnet sich dadurch, dass das erreichte Wissen in einer bestimmten Si-
tuation nicht ausreicht, um den Anforderungen der Praxis genügen zu
können. Die Erörterung enthält unter anderem Elemente des Argumen-
151
tierens, des Kommentierens und der Diskussion. Besonderes Gewicht
enthält bei der Erörterung der kognitive Aspekt. Er zeigt sich darin,
dass der Sender den Empfänger den Weg seines Untersuchens und Be-
weisens mitverfolgen lässt. Das Erörtern nimmt eine Zwischenstellung
zwischen der sachbetonten und der erlebnisbetonten Darstellungsweise
ein.
Das Vorhandensein oder Fehlen von expressiven Elementen kann
aber nur in beschränktem Maße als entscheidendes Kriterium für die
Klassifizierung der Darstellungsarten gelten. Bei der Gegenüberstellung
von Schilderung und Erzählung handelt es sich um das unterschiedliche
Reagieren des Verfassers auf verschiedene Sachverhalte der objektiven
Realität. Der Verfasser kann entweder informieren oder vor allem seine
Eindrücke wiedergeben wollen. Je nachdem wie der Verfasser eingestellt
ist, ergeben sich unterschiedliche Gestaltungstypen, die man bedingt die
Darstellung der Information und die Wiedergabe von Eindrücken nen-
nen könnte. Natürlich werden bei beiden Typen Informationen vermit-
telt; entscheidend ist vielmehr das Dominieren des einen oder an-
deren Aspekts bei der Darstellung von Sachverhalten. Für das unter-
schiedliche Reagieren des Verfassers auf bestimmte Sachverhalte der ob-
jektiven Realität werden die Bezeichnungen „informativ—impressiv“
gebraucht.
Der informative Grundtyp beruht auf solchen Stilzügen wie Objektivi-
tät, Exaktheit, Klarheit und relative Kürze. Die Objektivität wird dabei
als distanzierte Haltung des Verfassers zu den Sachverhalten ver-
standen. Zu diesen obligatorischen Stilzügen treten sekundäre Stilzüge
hinzu, die zwar auftreten können, aber keine textprägende Funktion ha-
ben. Dazu gehören z. B. Emotionalität und Lockerheit bei der Darstel-
lung.
Der impressive Grundtyp kennzeichnet sich durch Subjektivität, d. h.
Kontakthaltung des Verfassers zu den Sachverhalten, stark ausge-
prägte Emotionalität, Lockerheit und relative Breite vor allem beim
kompositorischen und syntaktischen Aufbau.
Innerhalb des informativen Typs lassen sich sachgerichtete und sub-
jektiv gefärbte Subtypen unterscheiden. Das informative Element ist
z. B. sowohl für den Bericht als auch für die Erzählung von großem Wert.
Aber die beiden Darstellungsarten unterscheiden sich voneinander vor
allem durch den unterschiedlichen Anteil subjektiver Faktoren
bei der Darstellung der Vorgänge. In ähnlicher Weise unterscheiden sich
sachgerichtete Beschreibungen und Erörterungen von analogen Varian-
ten mit stärkerer subjektiver Komponente. Der Terminus „Schildern“
soll sich daher nicht nur auf die impressive Gestaltung von Gegenstän-
den, sondern auch von Vorgängen und Situationen beziehen. Die im-
pressive Problemgestaltung könnte auch zum Gestaltungsbereich des
Schilderns hinzugezählt werden. Für diesen impressiven Typ wird oft die
Bezeichnung „Betrachtung“ verwendet. W. Fleischer und G. Mi-
chel bringen in ihrem Buch „Stilistik der deutschen Gegenwartsspra-
152
ehe“ das Schema der Grundtypen der Darstellungsarten und weisen mit
Recht darauf hin, dass die Formen der Darstellung real vielfältiger sein
können, weil konkrete Texte immer neuere Modifikationen herausar-
beiten können.
informativ impressi v
objektiv subjektiv
Gegenstand Zustand Beschreibung -> Schilderung (Zustands-/ Gegenstandsschilderung)
Vorgang Vorgangsbeschreibung Erzählung Vörgangsschilderung
Bericht
Problem Erörterung -> Betrachtung
§ 34. Traditionelle Auffassung von Texten und Textklassifikation
Den Textklassifikationen kam in der Stilistik traditionell eine we-
sentliche Bedeutung zu. Die Klassifizierung hat als wissenschaftliches
Verfahren die Aufgabe Orientierungswerte herauszuarbeiten, die es er-
möglichen würden, sich in einer Vielfalt von Objekten zurechtzufinden
und die Summe von Kenntnissen über diese Objekte wissenschaftlich
fundiert und objektiv nachgewiesen darzulegen. In der Philologie sind
die traditionelle literaturwissenschaftliche Typologie von künstlerischen
Genres sowie die linguistische Klassifikation von Texten in ihrer Zuge-
hörigkeit zu den funktionalen Stilen am bekanntesten.
In der Literaturwissenschaft ist es traditionell üblich drei künstleri-
sche Genres zu unterscheiden: Lyrik, Epos und Drama. Entsprechend
werden zu den lyrischen Textwerken Gedichte, Oden, Balladen u.a.m.
gezählt, zu den epischen rechnet man Erzählungen, Novellen und Roma-
ne zu, dramatische Texte umfassen Lustspiele, Trauerspiele, Bühnenfar-
cen u.Ä.
Die funktionalen Stile werden auf Grund der extralinguistischen
Faktoren herausgegliedert, die in einer dialektischen Einheit mit eigent-
lich linguistischen Gestaltungs- und Ausformungsprinzipien behandelt
werden.
Während im Falle von funktionalen Stilen Sprachfunktionen in den
größeren Bereichen der gesellschaftlichen Kommunikation das stilisti-
sche Spezifikum der Sprachverwendung bewirken und bedingen, beruht
die Klassifikation von W. Ad m o n i auf der Ermittlung verschiedener
Aspekte der kommunikativen Tätigkeit. Dabei versteht er unter Texten
nur wiederholbare Äußerungen, die sich nach einem bestimmten Mus-
ter reproduzieren lassen [s. Ajjmohm, 1994].
Die einmaligen Äußerungen sind auf das Erreichen eines unmittelba-
ren kommunikativen Ziels in der gegebenen kommunikativen Situation
153
gerichtet. Der Hauptbereich, in dem einmalige Äußerungen beheimatet
sind, ist die mündliche Rede in ihrer dialogischen oder polilogischen
Form. Die dialogische Rede tritt in folgenden Arten auf:
1) Alltagsdialog;
2) Produktionsdialog;
3) wissenschaftlicher Dialog oder Unterrichtsdialog;
4) parlamentarischer Dialog;
5) administrativer und Gerichtsdialog;
6) Dialog beim Militärdienst.
Jede der oben angeführten Dialogarten setzt ihrerseits das Vorhan-
densein einer ganzen Menge von Unterarten und Abwandlungen voraus,
je nachdem was die Kommunikationssituation bezweckt und wie sie be-
schaffen ist.
Unter den reproduzierbaren Äußerungen (Texten) unterscheidet
W.Admoni sakrale, künstlerische und Gebrauchstexte, sowie Massme-
dientexte in lautlicher Darbietungsform.
1. Sakrale Texte, vor allem Texte religiösen Inhalts, gehören zu den äl-
testen Textarten. Eine unabdingbare Voraussetzung der kommunikativen
Wirksamkeit dieser Texte wird als Streben angesehen, die lexisch-seman-
tischen sowie syntaktisch-grammatischen Stilelemente und Stilverfahren
einmalig fixiert erhalten zu lassen. Die ursprünglichen mythologi-
schen Vorstellungen verschiedener Völker über die real bestehenden
Sachverhalte haben sich in diesen Texten verankert und wurden allmäh-
lich nach Ablauf längerer Zeitabstände zu mehr oder weniger stabilen Er-
zählformen. Der sakrale Text zeichnet sich durch eine gewisse Distan-
ziertheit von der Gebrauchssprache aus, wie sie geschrieben und gespro-
chen wird. Die klassische Form der sakralen Texte stellt die Bibel dar.
Die fest fixierte lexisch-semantische Ausgestaltung der Bibelsprache,
die ihrerseits das Wesen der magischen Wirkung ausmacht, ließ bekannt-
lich M. Luther sein wichtigstes Übersetzungsprinzip formulieren, das
Prinzip des Verdeutschens. Dieses Prinzip gilt für Luther aber
nicht uneingeschränkt. Da, wo es um wichtige theologische Begriffe
geht, übersetzt er buchstäblich, d. h. wörtlich, was unter Umständen auf
Kosten der unmittelbaren Verständlichkeit und Eingängigkeit im Deut-
schen geht. Beim Übersetzungsvorgang und seiner theoretischen Be-
gründung schwankt M. Luther zwischen Wörtlichkeit und Freiheit, zwi-
schen Auslegung und Übersetzung, denn die Auslegungsmöglichkeiten
sind bei einem sakralen Text recht eingeschränkt.
2. Die Gebrauchstexte schließen nach W. Admoni fast eine unüberseh-
bare Vielfalt von Texten ein, die ein praktisches Bedürfnis des Menschen
im Sozium zu befriedigen vermögen. Außerhalb der praktischen Bedürf-
nisse bleiben nur die Bedürfnisse, die in „Gemüt und Seele“ entstehen,
d. h. vor allem im Bereich der schöngeistigen und sakralen Literatur. Zu
den wichtigsten Arten der Gebrauchstexte gehören (nach Admoni):
1) wissenschaftliche Texte;
2) Produktionstexte;
154
3) administrative und Gerichtstexte;
4) publizistische Texte;
5) Werbetexte.
— In wissenschaftlichen Texten wird das fixiert, was als
menschliche Erkenntnis bestimmt werden könnte. Wissenschaftliche
Texte sind sprachlich codiert, verschlüsselt, vor allem durch begriffli-
che Systeme der Fachwörter, die als Subsysteme der Sprache fungie-
ren.
— Die Produktionstexte sind im Unterschied zu den wissen-
schaftlichen Texten dazu berufen, den Empfänger in einem bestimmten
Bereich seiner Tätigkeit anzuweisen, anzuleiten, zu führen. Je nach Be-
darfkönnen sie als Begründung auch Fragmente der wissenschaftlichen
Texte einschließen. Zu den wichtigsten Abarten der Produktionstexte
gehören Patenttexte und Gebrauchsanweisungen.
— Die wichtigste Abart der administrativen Texte ist das
Gesetz mit all seinen abgewandelten Formen wie Verfassung, Erlass,
Edikt, präsidialer Beschluss usw. Der Verlauf des Gerichtsprozesses er-
bringt auch eine Reihe von kompositorisch und sprachlich spezifisch ge-
normten Texte: Akten, Urteile von Staatsanwälten, Zeugenaussagen, Ge-
richtsurteile, Anklagen, Beschwerden usw. Zu den administrativen Texten
gehören allerlei Verfügungen der Behörden, behördliche Rechenschafts-
briefe, administrative Protokolle und überhaupt eine unzählige Menge
von Päpieren und Unterlagen, die der behördliche Umgang auf allen
Ebenen erforderlich, ja sogar unentbehrlich macht.
— Publizistische Texte sind in äußerstem Maße diversifi-
ziert: Redaktionsartikel, Problemaufsatz, Nachrichten, Berichte, Kom-
mentare, Wettervorhersagen, Arbeitsangebote, Heiratsannoncen, Sportrub-
riken, Rezensionen usw.
— Werbetexte stellen einen recht neuen Texttyp dar. Die Entste-
hung der Werbetexte ist dadurch bedingt, dass im 20. Jahrhundert eine
Massenfertigung von Waren aufgenommen wurde, die eines maximal
großen Absatzes bedurften.
3. Künstlerische Texte sind auf unmittelbare gefühlsmäßig-gegen-
ständliche und begrifflich-anschauliche Erkenntnis der Realitäten sowie
auf die Öffnung der menschlichen Seele bis auf ihre Tiefen gerichtet.
4. Texte in lautlichen Massmedien zeichnen sich dadurch aus, dass
sie von vornherein auf mündliche Wahrnehmung eingestellt sind, und
dieser Umstand nimmt stärksten Einfluss auf ihre sprachstilistische
Ausformung. Für mündliche Darbietungsformen sind vor allem dra-
matische Werke, lyrische Gedichte, Kirchengebete, Opern- und Lieder-
texte gedacht.
Die kurz umrissene Texttypologie von W. Admoni beruht auf tradi-
tioneller Aussonderung verschiedener funktionaler Bereiche: Wissen-
schaft, Produktion, Publizistik, Alltagsrede und schöngeistige Werke,
somit stellt sie (Typologie) eine gesetzmäßige Vertiefung und Weiterent-
wicklung der Lehre über funktionale Stile dar.
155
§ 35. Zum Begriff „Textsorte“, „Textexemplar“.
Texttypologie von B. Sandig
Die kommunikative Redetätigkeit vollzieht sich unter bestimmten
kommunikativen Bedingungen, die sich durch einen Komplex von si-
tuativen Merkmalen kennzeichnen. Einige spezifische Organisations-
formen der Redetätigkeit sind in Situationen eines Typs wiederholbar,
reproduzierbar, was mit der Zeit dazu führt, dass sie stabil werden und
den Charakter eines Rituals annehmen. Im Laufe der historischen Ent-
wicklung wurden für die Realisierung der menschlichen Kommunikati-
on bestimmte Normen zum verbalen Ausdruck des zu vermittelnden In-
halts herausgearbeitet. Für die Charakteristik der beständigen Textfor-
men wird in der modernen Linguistik der Terminus „Textsorte“ ge-
braucht. Textsorten werden dabei als textliche Einheiten aufgefasst, die
außer durch ihren Inhalt durch die Art und Kombination der Stilelemente
bedingt sind. Die Ansätze zu einer Typologie der Textsorten sind recht
alt: sie begegnen uns bereits in der antiken Rhetorik, die verschiedene
Formen z. B. von Verhandlungs- und Parteireden kannte [vgi. Sowinski,
1973, 332], Die antiken Dichtungstheorien differenzierten die Gattun-
gen ebenfalls nach rhetorisch-stilistischen Kategorien wie
Versmaßen, Dialog- und Monologformen.
Die Realisierung einer konkreten Textsorte in der Redekommunikati-
on wird als Textexemplar bezeichnet. Die Textsorte stellt eine Textform
dar, in der die kommunikative Absicht des Sprechers/Schreibers realisiert
wird und die nach bestimmten Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Normen
aufgebaut wird. Jeder konkrete Text (Textexemplar) weist neben seinen
eigenen grammatischen, lexikalischen, fonetischen und anderen Beson-
derheiten auch textsortenspezifische Merkmale und Qualitäten auf.
Nach der Meinung einiger Wissenschaftler stellt die Textsorte ein Phä-
nomen dar, welches den Trägern einer bestimmten Sprachkultur intui-
tiv vertraut ist [s. Weinrich, 1972, 52]. Der Sprachträger ist im Stan-
de verschiedene Textsorten zu identifizieren sowie praktisch die Regeln
anzuwenden, die einer Textsorte zu Grunde liegen. Die Textsorte ist ein
virtualer Begriff, denn das ist eine Gemeinsamkeit von virtualen Texten
mit einem oder mehreren gemeinsamen Zügen oder Eigenschaften.
Die Textsorte ist ein ganzheitliches Gefüge mit einer beschränkten
Anzahl von sprachlichen Elementen, spezifischer Anordnung dieser
Elemente, das auf extralinguistische Faktoren in seiner Ganzheit bezo-
gen ist. In der deutschen Textlinguistik wird heute der Begriff „Rede-
konstellation“ verwendet. Die Germanisten der Universität Freiburg ha-
ben eine Typologie der Redekonstellationen vorgeschlagen, die auf
Grund der extralinguistischen Faktoren aufgestellt worden war, die eine
sozial-kommunikative Situation markieren. Unter Redekonstellation
verstehen sie dabei eine Kombination von konkreten Merkmalrealisie-
rungen in einem bestimmten Kommunikationsakt. Die Merkmalreali-
sierungen kennzeichnen ihrerseits verschiedene Typen von kommunika-
156
tiven Situationen. Zu den Merkmalen der Redekonstellationen gehören
z.B.: Anzahl der Kommunikanten, zeitliche (temporale) Bezüge, Grad
der Öffentlichkeit und des Vorbereitetseins des kommunikativen Aktes,
vorläufige Fixierung des Themas u.a.m. [vgl. Schank, Schwitalla, 1983,
317]. Die Germanisten aus Freiburg gehen davon aus, dass die Rede-
konstellationen, mit denen konkrete Bedingungen einer kommunikati-
ven Situation beschrieben werden, sowohl qualitative als auch frequenti-
clle Entsprechungen in der Sprache haben.
Eine praktische Realisierung der Redekonstellationen bietet B. S a n -
d ig mit ihrer Matrix an, die 20 Merkmale oder Parameter umfasst. Die
Typologie von B.Sandig bezieht sich allerdings nur auf Gebrauchs-
texte. Die aufgestellten Parameter sind Oppositionen von Merkmalen,
die es ermöglichen, eine Textsorte von der anderen abzusondem. Die Pa-
rameter umfassen verschiedenartige linguistische und extralinguistische
Faktoren, und die typologische Beschaffenheit einer Textsorte besteht in
unterschiedlicher Anordnung der Merkmale. Insgesamt werden in der Ty-
pologie von B. Sandig 18 Textsorten erfasst wie: Interview, (Privat)brief,
Telefongespräch, Wettervorhersage, Gesetzestext, Arztrezept, Kochre-
zept, Traueranzeige, Vorlesung, Vorlesungsmitschrift, Reklame, Stellen-
inserat, Rundfunknachricht, Zeitungsnachricht, Telegramm, Gebrauchs-
anweisung, Diskussion, familiäres Gespräch.
In der Matrix werden zahlreiche, aber sehr verschiedenartige Merk-
male zusammengefuhrt, so dass die Aussonderungskriterien auffällig he-
terogen sind. Die relevantesten Merkmale sind die, welche (a) die mate-
rielle Manifestation des Textes, (b) das Verfahren, wie der Text produ-
ziert wird und (c) die Struktur des Kommunikationsaktes berücksichti-
gen. Die Matrix von B. Sandig ist auf Seiten 158—159 dargestellt.
Wenn wir nur die ersten drei relevantesten Merkmale als Klassifikati-
onsbasis heranziehen, so entsteht eine einfachere, aber einheitlichere
Typologie von Texten, die auf der Kombination der oben genannten drei
Parameter beruht:
1) [-^-gesprochen, ^spontan, ^monologisch] — laut gesprochene „innere
Rede“, der innere Monolog;
2) [+gespr., -spon., +mono] — Vorlesung, öffentliche Rede, Rund-
funknachrichten, Gebet;
3) [+gespr., +spon., -mono] — Privatgespräch, Telefongespräch,
Straßengespräch zwischen unbekannten Leuten;
4) [+gespr., -spon., -mono] — wissenschaftliche Diskussion; politi-
sche Auseinandersetzung (Disput);
5) [-gespr., +spon., +/77cwoj — Privatbrief, Tagebuchaufzeichnungen;
6) [-gespr., -spon., +mono] — offizieller Brief (Geschäftsbrief), wis-
senschaftlicher Text, Kochrezept;
7) [-gespr., +spon., -mono] — privater Briefwechsel, stenografische
Aufzeichnung der Diskussion;
8) [-gespr., -spon., -mono] — nachgearbeitete Aufzeichnung der Dis-
kussion, offizieller Briefwechsel [vgl. Sandig, 1972, 115—116].
157
I
SSI
Wetterbericht Kochrezept Arztrezept Gesetzestext Telefongespräch Brief Interview \ Merkmal Textsorte \
H- i+ i i + i + gesprochen
1 1 i i i H- H- i+ spontan
i + + + + 1 1+ i monologisch
i i i 1 1 i dialogische Textform
1 i+ i i 1 1 H- räumlicher Kontakt
+ i+ i i + 1 + zeitlicher Kontakt
H- i+ i i + l + akustischer Kontakt
i + + + + + + 1+ Form des Textanfangs
1 1 i + + + + 1+ Form des Textendes
1 + + i 1 1 1 weitgehend festgelegter Textaufbau
+ + + + H- H- + Thema festgelegt
J i i i + + + Iper
1 i i i + + + 2per
+ + i + + + + 3per
H- i i 1+ 1+ H- Imperativformen
I 1 1 i i 1+ H- 1+ Tempusformen
H- 1+ + i 1+ 1+ H- ökonomische Formen
* J_ 1 i i 1+ 1+ 1+ Redundanz
+ + + H- + + Nichtsprachliches
!□ 1 i i 1+ 1+ 1 gleichberechtigte Kommunikationspartner
Traueranzeige - - + — - - — + + + + ± - + - - ± - ± +
Vorlesung(sstunde) + + + - + + + + ± — + ± ± - ± ± - ± ± —
Vorlesungsmitschrift - — + — - — — ± - — + - - + - - + - ± +
Reklame ± ± + + ± ± ± ± ± - ± ± ± ± ± ± ± ± ± —
Stelleninserat - — + — — — — + + + + ± ± ± + - ± - + -
Rundfunknachrichten + — + — - + + + + - - — - + - + — ± + -
Zeitungsnachricht — — + — — — - + - — + — - + - + - - + —
Telegramm — — + — — — — + + — + ± ± + ± — + - + ±
Gebrauchsanweisung — — + — — - - ± — — + - ± + ± — ± ± ± -
Diskussion + + — — ± + + + + — + + + + ± + - ± + ±
familiäres Gespräch + + — ± + + + ± - - — + + + ± ± + + ± +
^/1
§ 36. Brieflich-mitteilende Textformen
Die üblichen Prosaformen lassen sich nach der Art und Absicht der
sprachlichen Informationsdarbietung in mehrere Gruppen gliedern. Die
Gruppierung stützt sich auf die charakteristische Übermittlungsart be-
stimmter Informationen, zugleich aber auch auf bestimmte Stilkompo-
nenten. Alle Gruppierungen sind durch die Mitteilungsweise und Mit-
teilungsabsicht geprägt [s. Sowinski, 1973, 333— 337]. Die Textklassen
sind auf eine bestimmte Wbise strukturiert. Der Strukturierung der Text-
klassen liegen bestimmte Darstellungsarten zu Grunde, die jeweils in ei-
ner Klasse von Texten Dominanz gewinnen, führend werden.
Der Brief ist die wichtigste schriftliche Gebrauchsform. Seinen Na-
men (lat. brevis = „kurz“) erhielt er von der kurzen schriftlichen Mittei-
lung, die man dem Boten gab. Mit der Zeit hat sich eine große Zahl ver-
schiedener Briefarten entwickelt. Aber die wichtigsten Textkonstituen-
ten sind fast unentbehrlich geblieben: 1) Datum (oft mit Ortsangabe),
2) Anrede, 3) Brieftext, 4) Briefschluss mit Unterschrift. In Verwaltungs-
und Geschäftsbriefen steht vor der Anrede die Anschrift, der Betreff
(Briefthema) und eventuell Hinweise auf vorangehende Briefe und das
jeweilige Aktenzeichen. Informationell und stilistisch wichtig ist der
Brieftext selbst. Private Briefe werden oft stilistisch so ausgeformt wie
ein mündliches Gespräch mit Hin- und Herspringen der Gedanken und
Themen. In Geschäftsbriefen wird zumeist die sachlogische Reihenfolge
eingehalten, verschiedene Gedanken werden durch Absätze hervorgeho-
ben oder nummeriert. Häufig wird ein Anfang des Briefes kurz erwähnt:
z. B. die Bestätigung eines vorangegangenen Briefes, das Argument des
Briefpartners, die Mitteilung über eine gute Ankunft usw. Gewöhnlich
erfolgt die eigentliche Nachricht erst an zweiter Stelle. Der Briefschluss
wird in privaten Briefen oft durch einen Satz vorbereitet und klingt dann
in einer Wunsch- oder Grußformel aus. In nicht privaten Briefen steht
meistens nur eine Höflichkeitsformel am Schluss.
Stilistisch sind Briefe durch kurze bis mittellange Sätze ge-
kennzeichnet. In privaten Briefen werden die Personalpronomen der
1. und 2. Person frequentiert gebraucht und bilden die personale Achse
des Textes. Es überwiegt die normalsprachliche Wörterschicht, die in
privaten Briefen oft durch leicht gesenkte lexikalische Einsprengsel
aufgelockert wird. Der Korrespondenzvorgang wird im Präsens, das
Voranliegende im Perfekt und das Vorhaben im Präsens oder Futurum
dargeboten.
In geschäftlichen Briefen kommen oft noch Besonderheiten des
Funktionalstils zum Ausdruck, während in Privatbriefen die Intenti-
on und der Gemütszustand des Schreibenden stärker pointiert wer-
den. Bei Geschäftsbriefen und Faxen, wie sie heute geartet sind, soll-
ten zwei Gegenpole beachtet werden. Einerseits werden in Ge-
schäftsbriefen oft flotte Sprüche von Werbung und Verkauf verwendet
{Spitzenprodukt, perfektionelle Ausführung, „Just-in-Time“-Lieferun~
160
gen usw.), andererseits finden sich hier steife, eingefrorene Ge-
brauchsweisen, trockenes Bürokratendeutsch. Die deutschen Sprach-
berater entwickeln in ihren Konzepten über die Schreibkultur in Un-
ternehmen den Gedanken, dass die trockene Sprache zum lebendi-
gen Dialog werden soll. Eingefahrene Schreibkanäle sollten verlassen
werden. Man solle heute bildkräftiger und persönlicher schreiben,
auch in Geschäftsbriefen. Solche Floskeln wie „wunschgemäß“, „an-
bei in der Lage“, „unter Bezugnahme auf1 usw. sollten oft gestrichen
werden. Trotz zahlreicher ähnlicher Forderungen bleibt die ganze
Geschäftskorrespondenz aus kompositorisch-architektonischer Sicht
straff organisiert und gliedert sich je nach der Art der
Geschäftskorrespondenz in praktisch feststehende, nur in sehr be-
schränktem Maße abwandelbare kompositorische Teile. Im Nachfol-
genden bringen wir die schematische Gliederung eines Geschäfts-
briefes, in der alle fast verbindlichen Kompositionsteile voneinander
abgesondert und nummeriert sind:
1. Briefkopf
Wenn nicht im Vordruck enthalten, sollten folgende Angaben im
Briefkopf aufgenommen werden:
— Telefonvorwahl aus dem jeweiligen Ausland;
— Interne Telefondurchwahl des Bearbeiters, falls vorhanden;
— Telex- und Telegrammadresse.
2. Datum
- 2. Oktober 1985;
— 2. Oki. 1985 (Jan., Feb., März, April, Mai, Juni, Juli, Aug., Sept.,
Okt., Nov., Dez.);
— 2.10.1985;
— 1985—10—02;
- 19851002.
3. Betreff'
Betreff:/Betrifft:
Häufig wird das Wort „Betreff'/,,Betrifft“ auch weggelassen und nur
der Sachbezug angegeben, z. B. „Oberkleidung“. Der „Betreff“ soll in
kurzer Form den Inhalt des Anschreibens wiedergeben. Er dient dem
Empfänger als Orientierung und kurze Vorinformation etwa zum Zweck
der betriebsinternen Vfeiterleitung (z. B. Einkaufsabteilung etc.).
4. Anrede
Die Anrede dient vor allem dazu, den Leser auf den Brief einzustim-
men. Sie soll den persönlichen Beziehungen zwischen Briefschreiber
und Adressat angepasst sein. Allgemeine Anreden sollten nur gewählt
Werden, wenn keine persönlichen Kontakte vorhanden sind, ansonsten
ist die persönliche Anrede vorzuziehen.
5. Text des Geschäftsbriefes
6. Beförderungsvermerk/Aushändigungsvermerk/Bearbeitungsvennerk
6 EoraTwpena ] b 1
— Luftpost
— Express
— Einschreiben
— Persönlich
— Vertraulich
7. Besondere Vermerke
Sie weisen auf den Bearbeiter {Ihr Zeichen) und vorhergehend
Schriftstücke {Ihre Nachricht vom...) hin.
8. Anlagenvermerk
— Anlage/Anlagen
— 2 Beilagen
— Preisliste
— Stoffmuster
Der Aiilagenvermerk ist in Höhe der handschriftlichen Unterschrift
bei Platzmangel entsprechend höher anzubringen.
9. Schlussformeln
Die nachfolgenden drei Briefe sind dem Roman von Th. Mann „Bud
denbrooks“ entnommen. Jeder der drei Briefe ist an sich genommen ein
Koloritzeichnung des Verfassers, enthält aufschlussreiche Informationei
über die Person, den seelischen Zustand, das Verhältnis zum Empfange
des Briefes, zum Gegenstand oder Thema des Briefes, zu den sie umge
benden Sachverhalten und trägt den Stempel des individuellen Stil
des Verfassers. Da es sich um literarische Privatbriefe handelt, beziehen si
sich auf die künstlerische Absicht, Intention des Autors, der seine Heldei
in ihren wechselseitigen Beziehungen zueinander sowie zu der Welt de
realen Sachverhalte anschaulich präsentiert und charakterisiert. Die Brie
fe sind hier eine Art Selbstdarstellung, „Selbstbildnis“, die es dem Auto
ermöglichen, dem Leser unaufdringlich und indirekt das zu zeigen, wa
die innersten Besonderheiten seiner Helden ausmacht:
Teuerste Demoiselle Buddenbrook!
Wie lange ist es her, daß Unterzeichneter das Angesicht des reizendste!
Mädchens nicht mehr erblicken durfte? Diese so wenigen Zeilen sollen Ihnei
sagen, daß dieses Angesicht nicht aufgehört hat, vor seinem geistigen Auge zi
schweben, daß er während dieser hangenden und bangenden Wochen unabläs
sig eingedenk gewesen ist des köstlichen Nachmittages in Ihrem elterlichen Sa
Ion, an dem Sie sich ein Versprechen, ein halbes und verschämtes zwar noch
und doch so beseligendes entschlüpfen ließen. Seitdem sind lange Wochen ver
flössen, während derer Sie sich behufs Sammlung und Selbsterkenntnis von de
Welt zurückgezogen haben, so daß ich nun wohl hoffen darf, daß die Zeit de
Prüfung vorüber ist. Endesunterfertigter erlaubt sich, Ihnen, teuerste Demoi
seile, mitfolgendes Ringlein als Unterpfand seiner unsterblichen Zärtlichkei
hochachtungsvollst zu übersenden. Mit den devotesten Komplimenten und lie-
bevollsten Handküssen zeichne als
Dero Hochwohlgeboren ergebenster
Grünlich
162
Lieber Papa!
O Gott, wie habe ich mich geärgert! Beifolgenden Brief und Ring erhielt ich
soeben von Gr., so daß ich Kopfweh vor Aufregung habe, und weiß ich nichts
Besseres zu tun, als beides an Dich zurückgehen zu lassen. Gr. will mich nicht
verstehen, und ist das, was er so poetisch von dem „Versprechen“ schreibt, ein-
fach nicht der Fall, und bitte ich Dich so dringend, ihm nun doch kurzerhand
plausibel zu machen, daß ich jetzt noch tausendmal weniger als vor sechs Wo-
chen in der Lage bin, ihm mein Jawort fürs Leben zu erteilen, und daß er mich
endlich in Frieden lassen soll, er macht sich ja lächerlich. Dir, dem besten Vater,
kann ich es ja sagen, daß ich anderweitig gebunden bin an jemanden, der mich
liebt, und den ich liebe, daß es sich gar nicht sagen läßt. O Papa! Darüber
könnte ich viele Bogen vollschreiben, ich spreche von Herrn Morten Schwarz-
kopf, der Arzt werden will und, sowie er Doktor ist, um meine Hand anhalten
will. Ich weiß ja, daß es Sitte ist, einen Kaufmann zu heiraten, aber Morten ge-
hört eben zu dem anderen Teil von angesehenen Herren, den Gelehrten. (...)
Mit tausend Küssen verbleibe ich
Deine gehorsame Tochter Antonie.
PS. Der Ring ist niedriges Gold und ziemlich schmal, wie ich sehe.
Meine liebe Tony!
Dein Schreiben ist mir richtig geworden. Auf seinen Gehalt eingehend, teile
ich Dir mit, daß ich pflichtgemäß nicht ermangelt habe, Herrn Gr. über Deine
Anschauung der Dinge in geziemender Form zu unterrichten; das Resultat je-
doch war derartig, daß es mich aufrichtig erschüttert hat. Du bist ein erwachsenes
Mädchen und befindest Dich in einer so ernsten Lebenslage, daß ich nicht anste-
hen darf, Dir die Folgen namhaft zu machen, die ein leichtfertiger Schritt Dei-
nerseits nach sich ziehen kann. Herr Gr. nämlich brach bei meinen Worten in
Verzweiflung aus, indem er rief, so sehr liebe er Dich und so wenig könne er Dei-
nen Verlust verschmerzen, daß er willens sei, sich das Leben zu nehmen, wenn
Du auf Deinem Entschlüsse bestündest.(...) Meiner christlichen Überzeugung
nach, liebe Tochter, ist es des Menschen Pflicht, die Gefühle eines anderen zu
achten, und wir wissen nicht, ob Du nicht einst würdest von einem höchsten
Richter dafür haftbar gemacht werden, daß der Mann, dessen Gefühle Du hart-
näckig und kalt verschmähtest, sich gegen sein eigenes Leben versündigte. Das
eine aber, welches ich Dir mündlich schon oft zu verstehen gegeben, möchte ich
Dir ins Gedächtnis zurückrufen, und freue ich mich, Gelegenheit zu haben, es
Dir schriftlich zu wiederholen. (...) Wir sind, meine liebe Tochter, nicht dafür ge-
boren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes, kleines, persönliches
Glück halten, denn wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende
Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette, und wir wären, so wie wir sind,
nicht denkbar ohne die Reihe deijenigen, die uns vorangingen und uns die Wege
wiesen, indem sie ihrerseits mit Strenge und ohne nach rechts oder links zu bli-
cken einer eiprobten und ehrwürdigen Überlieferung folgten.(...)
In treuer Liebe
Dein Vater.
In den letzten Jahren ist ein neues Textprodukt informativer Art ent-
wickelt worden: Schreiben fürs Internet. Die geschriebene Sprache ero-
bert den Bildschirm. Die Informationsvermittlung über den Bildschirm
163
unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten als eine Mitteilung über einen
einfachen Brief oder ein Buch oder eine Zeitschrift. Die Informationen
können beim Internettext nicht linear präsentiert werden. Die auf dem
Bildschirm besonders markierten Bereiche, wie einzelne Wörter, Fotos
oder grafische Elemente, sind mit einem Link hinterlegt. Wferden sie
mit der Maus angeklickt, füllt sich der ganze Bildschirm — oder nur ein
Teil davon, ein Fenster oder ein Frame — mit einer neuen Seite. Links
verweisen also auf eine weitere Informationseinheit. Der Nutzer muss
sich per Mausklick immer wieder entscheiden, welchen Wfeg er wählen
und wie tief er sich informieren will. Auf dem Bildschirm ist immer nur
ein kleiner Teil der Gesamtinformation zu sehen. Wie es für alle Medien
ihre eigenen Aufbaumuster des Erzählens gibt, muss auch für das Web
eine spezielle Dramaturgie gefunden werden. Trotz aller Multimediali-
tät bleibt das World Wide Web ein textzentriertes Medium. Alle Elemen-
te, die einen gewöhnlichen Text spannend machen, sind auch für Inter-
net-Schreiben von großer Bedeutung. Der Schreiber aber muss „gra-
fisch“ denken und das Informationsdesign bereits beim Texten berück-
sichtigen. Der Spannungsbogen wird hier von den so genannten „N a-
vigationspunkten“ gehalten, d. h. von denjenigen Elementen, die
mit einem Link hinterlegt sind und vom Nutzer angeklickt werden sol-
len: unterstrichene farbige Wörter, Buttons, Fotos. Die Navigations-
punkte bilden die Startpunkte für ein ganzes Netz aus „Fäden“ und
müssen dem Leser Orientierung bieten. Eine lange Seite sollte über-
sichtlich gegliedert und mit einem eigenen Inhaltsverzeichnis am An-
fang versichert werden, das über seiteninterne Links als „Sprungbrett“
zu den einzelnen Abschnitten dient. Als Gliederungselemente bieten
sich nicht nur Zwischentitel an, sondern auch wiederkehrende Grafiken,
die die Navigation erleichtern. Eine einzelne lange Wbbseite sollte also in
Texthappen gegliedert sein, denn sie wird meist linear, sprunghaft
und selektiv gelesen. Meistens ergibt sich aus dem Inhalt, aus der Funk-
tion und dem Ziel eines Schreibens eine gewisse Informationsstruktur,
wobei die Darstellungsform eine große Rolle spielt. Eine Nachricht wird
auch im Wfeb nach dem Prinzip der umgekehrten Pyramide ge-
schrieben: das Wichtigste kommt zuerst. Für alle Darstellungsformen gilt:
die einzelnen Textpositionen brauchen einen jeweils eigenen Informa-
tionsschwerpunkt. Es muss klar sein, warum eine Texteinheit herausge-
trennt wurde und eine eigene Seite erhielt. Es muss auch auf Anschlüsse
geachtet werden: jede Texteinheit sollte leicht zu verstehen sein.
Zu den brieflich-mitteilenden Textformen gehört unter anderem
auch der Werbebrief. Es muss aber bemerkt werden, dass es anders be-
schaffene Wferbetexte gibt, die sich ihrem Wesen nach den ansprechen-
den Formen nähern, denn sie beruhen vielmehr auf einer Aufforderung
zum Kauf, Erwerb (z. B. Kaufanzeige). Die wichtigste Abart der Werbe-
briefe bildet der deskriptive Werbetext. Der letztere ist als eine besondere
Realisierungsform der Marketingkommunikation anzusehen,
d. h. der Kommunikation, die zwischen den Unternehmen und zwi-
164
sehen dem Unternehmen und dem Publikum in Massmedien zu Stande
kommt. Das Werbeobjekt bilden hier intellektuelle Erzeugnisse und
komplizierte technische Objekte solche wie Telekommunikation, mo-
derne Technologien, Bankservices, Know-How, Computer, komplizier-
te Haushaltstechnik, Bürotechnik u.a. m. Der Rezipient dieses Textes
stellt eine Reihe von Zielgruppen dar, die eine so genannte Fokus-
gruppe bilden. Zwischen dem Autor des Wbrbetextes und dem Mas-
senrezipienten gibt es keinen unmittelbaren zeitlichen und räumlichen
Kontakt. Um kommunikationspragmatische Intentionen zu realisieren,
verwendet der Autor flexible Taktiken und Strategien, die kombiniert
werden können [vgl. Guseynova, 1997, 75— 78], Die wichtigsten Stra-
tegien des Autors können mit der Formel AIDMA zusammengefasst wer-
den, die für die Kundenanwerbung unter marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen häufig verwendet wird:
A — Attention — Aufmerksamkeit
I — Interest — Interesse
D — Desire — Wunsch
M — Motiv — Motivbildung
A — Action — Handlung
Der Autor muss im Rahmen eines Werbetextes folgende Strategien rea-
lisieren: die Fokusgruppe ansprechen, ihr Interesse hervorrufen, den Kauf-
wunsch erwecken, diesen Wunsch motivieren und den Rezipienten zur
Handlung veranlassen. In der kompositorischen Struktur eines Wferbetextes
lassen sich Aufbauelemente aussondern, die den oben genannten Strategien
entsprechen. Der Slogan realisiert die führende Strategie, die Aufmerksam-
keit der Fokusgruppe zu erregen. In der Regel ist es eine verhältnismäßig
kurz gehaltene Fangzeile, sprachlich sehr oft mit abweichenden,
auffälligen, bildkräftigen Mitteln und Verfahren ausgestaltet:
EINE SCHÖNE SIEHT GUT AUS.
EGAL AUS WELCHER PERSPEKTIVE.
(aus der Werbung für Citroen mit Claudia
Schiffer als begleitendes Modell)
GRAND ESPACE. DIE REVOLUTION GEHT WEITER.
(aus der Werbung für Grand Espace)
EURO? DOLLAR? FRANKEN? ZINK.
DER PASSAT.
(aus der Werbung für VW-Passat)
BUNDESWERTPAPIERE HALTEN JUNG.
(aus der Werbung für Bundeswertpapiere)
LEBEN SIE. WIR KÜMMERN UNS UM DETAILS.
(aus der Werbung der Hypovereinsbank)
Die Aufmerksamkeit des Rezipienten soll nicht nur erregt, sondern
auch aufrechterhalten werden, stets angesprochen werden. Das wird ers-
165
tens dadurch erreicht, dass die Sprache, in der die Wferbung ausgestaltet
wird, von gewohnten Denkrastern des Durchschnittsrezipienten ab-
weicht und mehr zu einem Sondergebrauch tendiert (syntaktisch-
lexikalische Antithesen, Beiwörter in ihrer verfremdeten Beziehung auf
das Substantiv, abgewandelte idiomatische Ausdrücke, sprichwörtliche
Redensarten, Tropen, Modewörter, Amerikanismen u.a.m.). Viele
Sprachforscher postulieren sogar das Vorhandensein einer besonderen
Sprache oder einer besonderen Sprachschicht. Zweitens wird die Auf-
merksamkeit des Rezipienten durch verbindliche grafische Abhe-
bung des Werbetextes in Massenmedien, durch eine Kombination von
verschiedenen Schriftarten, durch visuelle Darstellung des Werbeob-
jekts, Fotos der bekannten Persönlichkeiten als „begehrte Werbeträger“
sowie durch die parzellierte Darbietung der Informationen über
den Wferbegegenstand gefesselt, so dass jede einzelne Parzelle informa-
tionell abgeschlossen und abgehoben ist.
Die Herausbildung des Motivs sowie des Wunsches, den Gegenstand
zu erwerben, kommt dank unterschiedlichen Verfahren zu Stande. Bei
der Auswahl dieser Verfahren ist entscheidend, wie der Gegenstand
selbst beschaffen ist (Auto, Kaffeemaschine, Herrenanzug, Bankdienst-
leistung oder etwas anderes), und welche Konsumenten als Fokus-
gruppe in Frage kommen (Männer, Frauen, ältere Leute, jüngere Leute,
vermögende Bürger oder die aus einkommensschwächeren Schichten).
Ein Mann wird sich motiviert fühlen, wenn er die ihn zufrieden stellen-
den technischen Parameter in der Autowerbung liest: Ein Sechszylinder
mit Mehrventil-Technologie, 140 kW {190 PS) und einem maximalen
Drehmoment von 267 Nm. Eine Frau würde höchstwahrscheinlich mehr
Gefallen finden am eleganten Design, am Fahrkomfort, an exklusiver
Farbenpracht, an der schicken Schale des Wagens usw. Ausnahmslos für
alle Konsumenten ist es von großem Belang, inwieweit oder in
wie tief sich die Garantien beim Kauf erstrecken {Das Vertrauenspa-
ket: 14-tägiges Rücktrittsrecht, 3-Jahre-Mobilitätsgarantie, 3-Jahre-Ga-
rantie bis 100.000 Kilometer). Der Preis ist ohne Zweifel entscheidend
und wird nicht zufällig in großen augenfälligen Lettern so platziert, dass
er unbedingt in den Blickfeld des Rezipienten geraten muss. Der Werbe-
gegenstand sowie der Anbieter müssen dem Rezipienten Vertrauen ein-
flößen, vertrauenswürdig sein, damit die Motivation nach dem
überfliegenden Lesen des Wbrbetextes nicht verloren geht {„Citroen. Ei-
ner, dem man vertraut“, das „Citroen— Vertrauenspaket“, „Noch Fragen!
Infoline: 01805/8778“). Erst nachdem das Motiv ausreichend durch
technische, preisliche und sonstige Angaben untermauert ist, kann ein
Wunsch entstehen, den Kauf zu tätigen, aber dazu muss der potenzielle
Kunde angestoßen werden und nicht verdeckt, latent, anonym, sondern
explizit, direkt, namentlich, sehr oft durch den Höflich
keitsimperativ. Die Werbung soll den Schein erwecken, dass nicht
einer der möglichen Kunden angesprochen wird, sondern „S i e“ {„Ent-
decken Sie den neuen Citroen“', „Wenn Sie einen Blick werfen...“', „Sie
166
werden feststellen können...“; „Gönnen Sie sich eine Privatvorstellung bei
Ihrem Renault Partner“). Der Anbieter darf auch kein, obwohl dem
Markenzeichen nach bekannter, Anonym von seiner Person her bleiben.
Er ist „I h r“ Partner, ein kollektives „w i r“, „Haus mit jahrhundertelan-
ger Tradition“, so dass die Interessen des Anbieters haargenau denen des
möglichen Kunden zu entsprechen scheinen, wenn in den Werbetext die
Vertrauensformel unaufdringlich, aber ziemlich konsequent eingebaut
wird. Das dargelegte Aufbauschema des Werbetextes ist zwar nicht das
einzige Darbietungsverfahren im Werbetext, aber bestimmt das verbrei-
tetste.
Der Wferbetext und die Wferbung als solche enthalten auch kulturell
spezifische Eigenschaften, so dass nicht alle Wferbeverfahren außerhalb
der nationalen Grenze in einem anderen Kulturareal adäquat wahrge-
nommen und verstanden werden. Eine Werbeagentur aus Berlin hat sich
1993 überzeugen müssen, dass die Wferbewahrnehmung in Ostdeutsch-
land anders war als in Westdeutschland. Übertriebene Versprechungen
und Werbung mit Superlativen kamen bei den meisten Konsumenten in
den neuen Bundesländern ebenso wenig an wie bunte surreale Lifestyle-
bilder, die über das Produkt und dessen Qualität wenig aussagen. Die
Gründe des mangelhaften Verständnisses liefen darauf hinaus, dass den
Ostdeutschen die langjährige Erfahrung mit der Werbung fehlte, die im-
mer auch ein Ausdruck des jeweiligen Zeitgefühls der Konsumenten ist.
Und den Ostdeutschen fehlte damals die Beziehung zu den traditions-
reichen westdeutschen oder internationalen Marken. Die meisten Ost-
deutschen können sich diese schöne neue Wfelt, die ihre Widerspiegelung
in der Wferbung findet, einfach nicht leisten, hinzu kommen Zukunfts-
ängste und die Sorge um Arbeitsplätze in den eigenen Familien.
Aus rein praktischen Gründen würde uns auch noch eine weitere
brieflich-mitteilende Textform interessieren: das Bewerbungsschreiben.
Es soll aber nicht heißen, dass die anderen Formen im Prinzip weniger
beachtenswert sind: Reklamation, Beschwerde, Mahnung, Antrag. Das
Konzept des Lehrbuches ermöglicht es aber nicht, auf alle Fragen von
stilistischer Relevanz gleich detailliert einzugehen.
Das Bewerbungsschreiben beginnt häufig mit einem Hinweis auf
ein Stellenangebot. Der Bewerber sollte dann erläutern, dass er sich
für die ausgeschriebene Stelle für geeignet hält. Dabei muss er auf
seine bisherige Tätigkeit hinweisen oder sein Interesse an einer neuen
Tätigkeit begründen, eventuell Motive für einen Stellenwechsel an-
geben. Der erste Eindruck ist entscheidend. Das gilt auch für das Be-
werbungsschreiben. In typischen schwachen Brieferöffnungen liefern
die Bewerber für den Leser keine wirkliche oder nur redundante In-
formation. Bessere Eröffnungen zeichnen den informierten und
konstruktiven Bewerber aus. Bereits der erste Satz sollte zeigen, dass
der Bewerber die eine oder andere Anforderung laut Stellenanzeige
biit konkreten Erfahrungen und Qualifikationen abdeckt. So ist die
Einstiegspassagegeeignet, auf Ausbildungs- und Hochschulabschlüs-
167
se, die derzeitige Position oder entscheidende Berufserfahrung hin-
zuweisen. Z. B.: Gerne unterstütze ich Sie mit meinen Berufserfahrun-
gen als Verkaufsgruppenleiter bei der Erschließung neuer Geschäftsfel-
der', oder: Der Aufbau Ihres Qualitätssicherungssystems für Veterinär-
arzneimittel möchte ich als langjähriger Experte für Qualitätsmanage-
mentssysteme und Projektmanagement vorantreiben', oder: Als Diplom-
Kaufmann in spe, mit kurzer Studiendauer, guten Noten und internatio-
nalen Praktika bewerbe ich mich um... — solche Einstiegspassagen
zeigen, dass der Bewerber gut informiert ist. Er hat zum Unterneh-
men oder der zu besetzenden Stelle über Stellenanzeige hinaus re-
cherchiert. Informierte Bewerber heben sich im Anschreiben von der
Masse ab und wecken Interesse: Ihr Engagement auf dem Gebiet des
Umweltschutzes und Risikomanagements habe ich mit großem Interesse
auf der Messe XVZ verfolgt', oder: Die Struktur Ihres Händlerkreises im
Gebiet N. ist mir als Gebietsverkaufsleiter einer marktfuhrenden Firma
gut vertraut', oder: Zunächst vielen Dank für die mir zugesandte Bro-
schüre „Führungsnachwuchs im X-Konzern“. Mich sprachen besonders
die Arbeitsschwerpunkte für das Controlling an.
Der Bewerber sollte sich vor nichts sagenden Sätzen hüten. Wie
bei allen persönlichen Äußerungen ist auch hier das Stilprinzip der
Glaubwürdigkeit von großer Bedeutung. Prahlerei wie auch
ängstliche Bescheidenheit und Verklemmtheit sind hier fehl am Plat-
ze: Um meinen beruflichen Werdegang weiter zu entwickeln, bewerbe
ich mich als derzeitiger Leiter der Entwicklung um die ausgeschriebene
Stelle als Leiter Technik', oder (noch arroganter): Internationale Dyna-
mik und Fähigkeit, ein sehr umfassendes Dienstleistungsangebot bereit-
zustellen sind entscheidende Anforderungen, die ich an meinen zukünf-
tigen Arbeitgeber stelle. Kein Einsteller sehnt sich auch nach einem
frustrierten Mitarbeiter, deshalb wäre auch die nächstfolgende Passa-
ge als eine unangebrachte anzusehen: Sie werden sicherlich mit vielen
Bewerbungen konfrontiert und möglicherweise etwas ermüdet zu dieser
greifen. Es kann sein, dass Sie damit nur noch Ihrer Pflicht genügen
wollen... Das Bewerbungsschreiben ist „eine sachliche Selbstcharak-
terisierung aus einem ausgeglichenen Selbstbewußtsein“ [Sowinski,
1973, 536],
In der letzten Zeit wird aus den Bewerbungsunterlagen in Perso-
nalabteilungen immer öfter eine Datei in der elektronischen Da-
tenbank. Für die Vorauswahl ist nicht mehr interessant, ob eine Be-
werbung schön aussieht, sondern ob sich in den verdateten Infor-
mationen die passenden Schlüsselwörter finden. Personalberater,
die für ein Unternehmen etwa einen Elektroingenieur mit bestimm-
ter Berufserfahrung, Spezialausbildung und Fremdsprachenkennt-
nissen suchen, durchforsten ihre Dateisammlung mit einem Such-
programm, das anschließlich nach Keywords Ausschau hält, die
diesen Anforderungen entsprechen. Wer künftig einen Job sucht,
steht vor der Frage: Was passiert eigentlich mit meinem Bewer-
168
bungsschreiben? Wird es verdatet? Wenn ja, unter welchen Schlüs-
selbegriffen? Es wird ratsam sein, vor dem Bewerbungsschreiben
eine Checkliste mit den voraussichtlich wichtigen Keywords anzu-
legen und diese in die Bewerbung einzuarbeiten, denn auch die
Sachbearbeiter reagieren genau wie ein Computer auf bestimmte
Begriffe und Zahlen.
§ 37. Beschreibende Textformen
Das Beschreiben wird als informatives Darstellen von Gegenständen
und Zuständen verstanden. Beim objektiven Grundtyp soll der
Empfänger sachgerichtet informiert werden; die persönliche Anteilnah-
me des Verfassers tritt zurück. Die Interpretation oder Meinungsäuße-
rung wird als überflüssig betrachtet. Die Merkmale der genannten Sach-
verhalte werden erfasst und sprachlich fixiert. Der Sender gliedert das zu
beschreibende Objekt in seine Teile und macht dem Leser die Einzeltei-
le in ihrer Form, Beschaffenheit und Funktion vorstellbar. Solch eine
Beschreibung kann genaue, oft terminologische Bezeichnungen für die
zu beschreibenden Teile enthalten. Der Aufbau der Beschreibung wird
vor allem durch die Struktur des statischen Objekts bestimmt. Dabei
kann der Verfasser zwei Wege gehen. Entweder beschreibt er zunächst
relevante Merkmale des ganzen Objekts (Form, Farbe, Größe, Funk-
tion) und wendet sich erst danach den Einzelheiten zu, oder er geht
von den Teilen aus und fügt sie zusammen, so dass sie anschau-
lich das Ganze demonstrieren. Hier ein Beispiel für die objektive Ge-
genstandsbeschreibung:
Wixforths Photonenforderband besteht aus einem wenige Millimeter mes-
senden Kristall aus verschiedenen Galliumarsenid-Verbindungen. Das ist die
Basis vieler Halbleiterbauelemente. Im Photonenforderband werden die Elekt-
ronen unter der Oberfläche des Kristalls gefangen. Trifft Licht auf den Halblei-
ter, entstehen positive und negative Ladungen, die wegen ihrer wechselseitigen
Anziehung zusammenprallen. Galliumarsenid ist piezoelektrisch und verformt
sich unter dem Einfluss elektrischer Felder. Fingerförmige Elektroden lösen bei
einer Wechselspannung von etwa einer Milliarde Schwingungen pro Sekunde
Stöße im Kristall aus. Die angeregte Schwingung läuft als Welle über die Ober-
fläche. Die Welle ist einige millionstel Millimeter hoch... Das elektrische Feld
einer Schallwelle fangt die Ladungen ein und transportiert sie weiter. („Der
Spiegel“}
Die sprachlichen Merkmale einer Gegenstandsbeschreibung ent-
sprechen den Wesensmerkmalen dieser Darstellungsart. Auffallend ist
hier der hohe Anteil der Substantive (bei einer anderen Beschreibung
könnten es Adjektive sein). Dabei wird auf Fachausdrücke, die der
Exaktheit der Darstellung dienen, besonderer Wert gelegt. Auch
Maßenangaben sind in beschreibenden Texten gut angebracht. Sie erhö-
hen die Anschaulichkeit der Darstellung. Durchgehend wird das Präsens
169
gebraucht, was die Allgemeingültigkeit der Aussagen untermauert. Der
Stilzug der Kürze zeigt sich im Dominieren von einfachen Sätzen und
kurzen, leicht überschaubaren Satzgefügen.
In der Vorgangsbeschreibung, z. B. einer Bedienungsanleitung für ein
Gerät, werden die zu vermittelnden Informationen so gestaltet, dass je-
der potenzielle Empfänger (Nutzer) dieses Gerät bedienen kann. Des-
halb wird die Information in Portionen, Schritte zerlegt, die aufei-
nander folgend, die Wahrnehmung und das Verständnis sichern sollen.
Zugleich bilden diese Informationsschritte kompositorische Aufbauele-
mente der Vorgangsbeschreibung. Die Vorgangsbeschreibung muss all-
gemein gültig sein, deshalb wird bei dieser Form der Beschreibung alles
Zufällige und Besondere ausgespart. Ein Beispiel aus der Gebrauchsan-
leitung zum PAz/z/w-Toaster:
Zwei Brotscheiben einlegen. Bevor Sie das Gerät einschalten, wählen Sie
die gewünschte Bräunungsstufe. Bei einer mittleren Bräunung drehen Sie den
Bräunungswähler in Stellung 3 — 5. Wählen Sie eine niedrigere Einstellung
(2 oder 1) für eine hellere Bräunung, für kleinere Scheiben, für das Toasten
von nur einer Scheibe Brot oder für sehr trockenes Brot. Wählen Sie eine hö-
here Einstellung (6 oder 7) für eine dunklere Bräunung, für große Scheiben,
für frisches Brot oder für tiefgefrorenes Brot. Wenn mehrere Scheiben
hintereinander getoastet werden, ist keine Neueinstellung erforderlich... Die
Scheiben werden in ein Toaster eingeführt, indem man den Schiebeschalter
nach unten schiebt. Der Toaster schaltet sich nach Beendigung des Toastvor-
gangs automatisch ab...
Die Vorgangsbeschreibung kennzeichnet sich durch Exaktheit und
Wissenschaftlichkeit, die durch einen fachspezifischen Wort-
schatz sprachlich ausgeformt werden. Im Gegensatz zur Gegenstands-
beschreibung steigt hier der Anteil der Verben, die entweder im Höflich-
keitsimperativ oder passivisch gebraucht werden. Durch die Verben wer-
den die Informationen schrittweise vermittelt. Das Präsens steht hier in
seiner generalisierenden Funktion. Der objektive Charakter der Darstel-
lung wird durch passivische Ausformungen herausgestrichen, während
der Höflichkeitsimperativ dem Text eine persönliche Note verleiht. Re-
lative Kürze der syntaktischen Einheiten sorgt nicht nur für ein leichte-
res Verständnis, sondern auch ist zugleich ein Verfahren zur Parzellie-
rung der Information.
Gegenstands- und Vorgangsbeschreibungen sind als selbstständige
Texte in verschiedenen Bereichen der menschlichen Kommunikation
anzutreffen: im Bereich der Produktion bei der Vorbereitung der Her-
stellungsabläufe, bei Anleitungen für den Umgang mit verschiedenen
Maschinen und Geräten, bei der Wferbung für diverse Erzeugnisse, im
öffentlichen Verkehr, bei Ausbildungs- und Schulungslehrgängen und
nicht zuletzt im Alltagsverkehr, wenn neue Haushaltsgeräte zu handha-
ben sind. Beschreibende Elemente oder Fragmente werden auch in Tex-
te anderen Charakters integriert: in Erzählungen, Berichte, Erörterungen
usw.
170
§ 38. Berichtende Textformen
Das Berichten dient der informativen Darstellung der Vorgänge und
ist in seinen Grundtypen objektiv geprägt. Hier werden kommentie-
rende Elemente weit gehend vermieden. Das wesentlichste Merkmal des
Berichtens ist das Erfassen des Besonderen, des Einma-
ligen eines Vorgangs. Das Berichten ist auf die Spezifizierung der In-
formation gezielt. Der Autor konzentriert sich darauf, was berichtens-
wert ist und wählt in Abhängigkeit von der kommunikativen Intention
wesentliche Einzelmomente aus dem komplexen Geschehen. Die Be-
sonderheiten des Vorgangs werden präzise mit Bindung an Zeit, Ort und
Personen ausgestaltet. Beim Berichten gibt es keine explizite Vvfertung,
dennoch wertet der Autor durch die Auswahl und Anordnung von Fak-
ten. Die Vorgänge werden objektiv und adäquat wiedergegeben. Die
Fakten werden chronologisch angereiht. Objektive Berichte über Vor-
gänge hat z. B. die Verkehrspolizei oder der Versicherer vorzulegen, sie
sind auch in manchen Zeitungsrubriken zu lesen, z. B. in lokalen Nach-
richten, aber auch nicht nur:
Kairo {dpa/AP) — Beim Einsturz eines Hochhauses in Kairo sind in der
Nacht zu Dienstag 14 Menschen getötet und 43 weitere verletzt worden. Das
zwölf Etagen hohe Gebäude fiel nach einem Brand im Keller zusammen. Di-
rekt nach dem Einsturz begann in Kairo eine Debatte über die Verantwortung
für das Unglück. Zwölf der Toten sind Feuerwehrleute und Polizisten, die mit
der Brandbekämpfung und Evakuierung beschäftigt waren.
Für bestimmte spezielle Aufgaben des Berichtens haben sich in der
gesellschaftlichen Praxis entsprechende Sonderformen entwickelt: das
Protokoll mit schematischer Gliederung mit dem Ziel des schnellen In-
formierens. Das Protokoll über eine Versammlung oder Beratung be-
ginnt mit dem Protokollkopf, der stichwortartige Angaben über die Art
der Veranstaltung, Ort und Datum, die Teilnehmer, den Beginn der Ver-
anstaltung und die Tagesordnung enthält. Im zweiten Teil wird dann in
klar gegliederter Form der Verlauf der Veranstaltung wiedergegeben. Der
Protokollant kann dann auch Beschlüsse oder Ergebnisse fixieren. Der
Schluss des Protokolls enthält stichwortartige Angaben über den Zeit-
punkt der Beendigung der Veranstaltung und die Unterschrift des Proto-
kollanten.
Der Rechenschaftsbericht nimmt kommentierende und argumentie-
rende Elemente auf. Er kann daher für die Einschätzung der Arbeit der
Belegschaft dienen. Daraus ergeben sich auch bestimmte Veränderun-
gen im kompositorischen Aufbau und in der sprachlichen Ausgestaltung.
Die Detailangaben, Daten, Zahlen werden zu Gunsten von Zusammen-
fassungen verdrängt, die als verallgemeinernde Teile vorwiegend im Prä-
sens abgefasst werden.
Beim Berichten können beschreibende, schildernde, kommentieren-
de oder argumentierende Elemente in einem Text zusammengefügt wer-
171
den. Es entsteht eine komplexe Darbietungsform, wie es z. B. bei der
Reportage der Fall ist. Aber die pragmatische Ausrichtung der Reporta-
ge ist anders beschaffen, denn es handelt sich schon um ein Genre der
Publizistik.
§ 39. Erzählende Textformen
Das Erzählen ist wie das Berichten eine informative Xforgangsdar-
Stellung. Beim Erzählen wird ein einmaliges Geschehen nicht sach-
lichregistrierend dargestellt, sondern subjektiv umgeformt.
Die Vorgänge können vom Empfänger nacherlebt werden. Der Erzäh-
ler ist vom Erzählstoff ergriffen. Die Erzählung ist nicht sachgerichtet,
braucht nicht objektiv zu sein. Die Erzählstoffe können sogar häufig
frei erfunden sein und daher im Prinzip nicht überprüfbar. Die Auf-
merksamkeit des Erzählers richtet sich nicht auf präzise Herausarbei-
tung von Ereignissen, sondern vielmehr auf die Gestaltung von Stim-
mungen, Gefühlen, Gedanken. Die Erzählung ist dazu berufen,
emotional auf den Empfänger einzuwirken. Unter diesem Aspekt
schichtet der Autor nebensächliche und wichtige Faktoren um. Die
Einzelheiten reiht er aber nach einem bestimmten Gesetz aneinander,
nach dem so genannten Gesetz der Steigerung. Der Erzähler bemüht
sich darum, den Empfänger in Spannung zu halten, mindestens bis
zum Kulminationspunkt. Erst nach dem Kulminationspunkt löst sich
die Spannung. Diese Aufbauphasen sind ein wesentliches Merkmal des
Erzählens und nicht nur im Bereich der Belletristik. Die Erzählung ist
stets ein Erlebnis und wir bieten so eins mit einem Fragment aus
W. Borcherts „Marguerite“:
Sie war nicht hübsch. Aber sie war siebzehn und ich liebte sie. Ich liebte sie
wirklich. Ihre Hände waren immer so kalt, weil sie keine Handschuhe hatte.
Ihre Mutter kannte sie nicht und sie sagte: Mein Vater ist ein Schwein. Außer-
dem war sie in Lyon geboren....
Einmal saßen wir in einem Cafe. Die Klarinette hüpfte wie zehn Hühner bis
in unsere Ecke. Eine Frau sang sinnliche Synkopen und unsere Knie entdeck-
ten einander und waren unruhig. Wir sahen uns an. Sie lachte und darüber wur-
de ich so traurig, daß sie es sofort merkte. Mir war eingefallen — ihr Lachen
war so siebzehnjährig — daß sie einmal eine alte Frau sein würde. Aber ich sag-
te, ich hätte Angst, daß alles vorbei sein könnte. Da lachte sie ganz anders, lei-
se: Komm...
Jemand störte uns. Es war ein Leutnant und der hatte kein Gesicht. Nase,
Mund, Augen — alles war da, aber es ergab kaum ein Gesicht. Aber er hatte
eine schöne Uniform an und er meinte, wir könnten uns doch nicht am hel-
lichten Tage (und das betonte er) auf der Straße küssen.
Ich richtete mich auf und tat, als ob er recht hätte. Aber er ging noch nicht.
Marguerite war wütend: Wir können nicht? Oh, wir können! Nicht wahr,
wir können.
Sie sah mich an.
172
Ich wußte nichts und die Uniform ging immer noch nicht. Ich hatte Angst,
daß er etwas merken würde, denn Marguerite war sehr wütend:
Aber Sie! So ein Mensch! Ihnen würde ich nicht mitten in der Nacht Küsse
geben! Oh!
Da ging er. Ich war glücklich. Ich hatte eine Heidenangst gehabt, daß er
merken würde, daß Marguerite Französin war. Aber Offiziere merken wohl
auch nicht immer alles.
Dann war Marguerite wieder vor meinem Mund.
Für das Erzählen ist die Person des Erzählers selbst am bedeutsams-
ten, denn er formt eigenständig die Sachverhalte aus. Er expliziert
sich in seinem sprachlichen Verhalten, in seinen Einstellungen zu dem
und zu denen, die er abbildet. Die Wortwahl und die Syntax hängen von
Einstellungen und Sehweisen des Erzählers ab und werden vor allem
durch die Stilzüge Lockerheit, Expressivität, Anschau-
lichkeit und Pointiertheit der Darstellung geprägt. Der Erzäh-
ler zeichnet beim Erzählvorgang Ortskolorit, Zeitkolorit und
sonstige Kolorite. Er will glaubwürdig sein bei der Wiedergabe der Sach-
verhalte. Die sprachlichen Mittel sind dabei vielfältig: Wörter mit emo-
tionaler Färbung, Bilder, Vergleiche, Antithesen, Wiederholungen, di-
rekte Rede, erlebte Rede, Variationen in der syntaktischen Struktur,
syntaktische Expressivstellung usw. Die dominierende Tempusform ist
das Präteritum, das „das vollkommen Vergangene“ bezeichnet und ei-
nen epischen Abstand zum Erlebten schafft, der die Vvfertung des Ver-
gangenen ermöglicht. Aber der Wunsch des Erzählers, das Vergangene
lebendig und gegenwärtig erscheinen zu lassen, ermöglicht auch den
Gebrauch von Präsens als dominierende Erzählform (historisches Prä-
sens). Häufig ist die Erzählung mit schildernden, reflektierenden, be-
schreibenden und kommentierenden Elementen durchsetzt. Daher wird
das Erzählen oft als kombinierte Darstellungsart bezeichnet.
§ 40. Erörternde Textformen
Das Erörtern gehört zu den informativen Darstellungsarten, es handelt
sich beim Erörtern um eine kombinierte Darbietungsform, denn
kommentierende und argumentierende Elemente werden hier häufig
durch beschreibende und berichtende ergänzt, aber kommentierende und
argumentierende Teile bleiben grundlegend. Das Erörtern bezieht sich auf
das Erfassen der Problemsituation, die möglicherweise einer Analyse un-
terzogen wird. Mit Hilfe des Argumentierens werden mehrere Varianten
bei der Lösung des Problems miteinander verglichen und bewertet. Eine
besondere Rolle spielen dabei die Beweisführung, das Definieren von Be-
griffsinhalten, das Urteilen und das Schlussfolgern. Das Erörtern kann in
zweierlei Vvfeise kompositorisch aufgebaut werden:
1) konkrete Sachverhalte können verallgemeinert werden und dann
zu Schlussfolgerungen führen;
173
2) Ausgangspunkt einer Erörterung können auch theoretische Frage-
stellungen sein, die durch Beispiele konkretisiert werden, am Ende steht
dann wieder eine verallgemeinernde Schlussfolgerung.
Die Gliederung des Textes ist klar, übersichtig und logisch durch-
dacht. Die Erörterung richtet sich darauf, dem Empfänger eine Prob-
lemlösung verständlich zu machen, die pragmatische Ausrich-
tung dieser Darstellungsart ist äußerst stark ausgeprägt, alle Teiltechni-
ken sind einem Ziel untergeordnet, der Absicherung eines möglichst
vollständigen rationellen Verstehens seitens des Empfängers. Ein Bei-
spiel aus der „Einführung in die Übersetzungswissenschaft“ von
W Koller:
Übersetzungen sind Resultate der textverarbeitenden, oder eingeschränkter:
textproduzierenden Tätigkeit Übersetzen. Textverarbeitende Aktivitäten fuhren
von einem Ausgangstext zu einem Resultattext; G. Wienold nennt als Beispiele
kommentieren, zusammenfassen, inteipretieren, für eine andere Rezipienten-
gruppe bearbeiten, in ein anderes Medium transponieren — und übersetzen.
Bei den die einzelnen textverarbeitenden Aktivitäten spezifizierenden Relatio-
nen, d.h. den Beziehungen zwischen Ausgangs- und Resultattexten, zählt er
auf: zitieren, kondensieren, referenzialisieren, eine metatextuelle Beschreibung
geben, bewerten, begründen, eine Bedeutung zuschreiben, zum Leserengage-
ment auffordem, expandieren. Im Blick auf die textverarbeitende Aktivität des
Übersetzens wäre die Liste zu erweitern mit: Äquivalenz herstellen zwischen
einem Resultattext in der Sprache L2 und einem Ausgangstext in der Sprache
LI. Wenn wir die Frage stellen, wie sich Übersetzen und Übersetzung von an-
deren Formen und Resultaten der Textverarbeitung unterscheiden und welche
Bedingungen ein Text erfüllen muß, damit er als Übersetzung gelten kann,
dann setzt dies die Klärung des Äquivalenzbegriffs voraus.
Wie lassen sich Übersetzen und Übersetzung von anderen Formen und Re-
sultaten der Textverarbeitung/-reproduktion unterscheiden? Welche Bedingun-
gen muß ein Text erfüllen, damit er als Übersetzung gelten kann? Als empiri-
sche Wissenschaft muß die produktorientierte Übersetzungswissenschaft ange-
ben können, welche Texte zu ihrem Gegenstandsbereich gehören. Eine Defini-
tion, die bloß besagt, daß Übersetzungen Produkte einer textverarbeitenden
Aktivität sind, die eine ausgangssprachliche Vorlage in „irgendein“ zielsprach-
liches Produkt überführt, das für „irgendwelche“ Empfänger „irgendeinen“
Zweck erfüllt, würde bedeuten, daß auch eine Zusammenfassung (abstrakt, Re-
sümee), ein (inteipretierender) Kommentar, eine für eine spezielle Lesergrup-
pe zu einem speziellen Zweck vorgenommene Bearbeitung oder eine teilweise
mediale Umsetzung (Text -> Bild und Text) eines Textes in eine andere Spra-
che als Übersetzungen gelten müßten. Eine solche weite Definition von Über-
setzung hätte zur Folge, daß sich die Übersetzungswissenschaft mit einem
durch extreme Heterogenität gekennzeichneten, geradezu grenzenlosen Ob-
jektbereich beschäftigen müßte.
Die sprachliche Gestaltung der Erörterung wird von den Stilzügen
geprägt, die für alle informativen Texte charakteristisch sind: Objek-
tivität der Darstellung, Exaktheit, Klarheit, relative
Kürze. Hinzu kommt die Folgerichtigkeit der Gedan-
174
kenführung. Die Gedanken des Autors werden durch einen arttypi-
schen Kompositionsaufbau expliziert. Zu den beinahe verbindlichen
Elementen gehören:
1) Explikation der Ausgangsthese durch das Erfassen und exaktes
Vorstellen des Problems oder eines seiner Aspekte;
2) kommentierende Explikation der möglichen und realen (schon
vorhandenen) Schwierigkeiten auf dem Wfege zur Problemlösung;
3) argumentierende Auseinandersetzung mit möglichen Varianten
der Problemlösung;
4) zusammenfassende, schlussfolgernde Ausführungen des Autors als
Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit dem Problem oder als ein neuer
Anfang für eine eingehendere Befassung mit dem umrissenen Problem.
Für die Darstellungsart „Erörtern“ ist auch das Appellieren an
den Empfänger typisch, der in die gedankliche Logik des Autors
eingeweiht werden soll. Der Empfänger wird oft direkt angesprochen,
sehr oft übernehmen die Funktion des Kontakts mit dem Empfänger
rhetorische Fragen, die zugleich auch den Text anschaulich in einzelne
Aufbauteile gliedern. Die Folgerichtigkeit der Gedankenführung wird
auch durch ein stärkeres Hervortreten von Stilelementen getragen, die
auf die Charakterisierung von Relationen spezialisiert sind: kausale,
temporale, konditionale u.a.m. Konjunktionen, Adverbien und adver-
biale Fügungen. Der Anteil der Substantive ist auffällig groß, Verben tre-
ten dagegen zurück und sind oft in ihrer Bedeutungsbasis verblasst.
Fachwörter sind für fundierte Argumentationen unentbehrlich.
In den meisten Fällen kennzeichnet sich das Erörtern durch die
kritische Untersuchung eines Sachverhalts; sehr oft entsteht
die Notwendigkeit der Wartungen verschiedener Art, aber überwiegend
handelt es sich um sachliche, nüchterne, abwägende Wfertungen und um
emotional-expressive. Der Autor kann mit seinen Wertungen entweder
das ganze Kritikfeld beherrschen oder sich mehr oder weniger zurück-
haltend äußern. Die subjektive Variante der Erörterung setzt einen
größeren Anteil von parteilichen Stellungnahmen von der Seite des Au-
tors voraus und ist in polemisch zugespitzten Genres der Publizistik an-
gebracht. Die Erörterung dient als Basis des Rezensierens (Erörterung
von Büchern und Kunstwerken), Interpretierens, Beurteilens und Cha-
rakterisierens.
§ 41. Schildernde Textformen
Das Schildern ist der wichtigste Typ der impressiven (gefühlsbeton-
ten) Darstellung. In den informativen Darstellungsarten ist der Verfasser
selbst aktiv tätig, beim Schildern reagiert er, er bringt sein Beein-
drucktsein von den Sachverhalten der objektiven Realität zum Ausdruck
[vgl. Fleischer, Michel, 1977, 292}. Der Verfasser ist hier bestrebt den
Empfänger in seine Erlebniswelt hineinzuziehen. Der Empfänger emp-
175
findet nach, die Eindrücke der anderen werden zum eigenen Erlebnis,
zur eigenen Erfahrung, und diese Erfahrung prägt dann in gewisser Wei-
se das eigene Handeln. Beim Schildern wini sich der Verfasser seiner
Eindrücke bewusst, er löst auf Grundlage des Gesamteindrucks seine
Gefühle und Haltungen aus. Das Schildern wendet sich sowohl auf be-
stimmte Merkmale von Sachverhalten als auch auf deren Wirkung auf
das eigene „Ich“. Das Schildern von Gegenständen hat z. B. die gleiche
Grundlage wie das Beschreiben, nämlich das genaue Beobach-
ten des Objekts. Beim Beschreiben aber strebt der \ferfasser nach
der Xbllständigkeit und Genauigkeit der Detailswiedergabe, während
das Schildern auf jene Sachverhalte besonderen Wert legt, die den Ge-
samteindruck tragen und Stimmungen, Gedanken und Gefühle
auslösen. Zu den Gegenstandsschilderungen werden die impressiven
Gestaltungen von Gegenständen, Bauwerken, Lebewesen, Bildern,
Landschaften. Zu den größten Meistern der impressiven Gestaltung von
Gegenständen, Landschaften, Lebewesen und Vorgängen gehören un-
verkennbar H. Bö 11 und W. Borchert. Bei H.Böll gibt es in seinen
Erzählungen zumeist nur eine schwach ausgeprägte äußere Handlung,
die dramatische Spannung stützt sich auf die impressive Schilderung
dessen, was der Erzähler sieht, tut, fühlt, denkt, mutmaßt, woran er sich
erinnert usw. Der Erzähler verarbeitet die Sachverhalte zuerst zu einer
textprägenden einheitlichen Metapher, die für die Art und Weise steht,
wie er die Sachverhalte empfindet und weiter setzt er diese Metapher in
Teilmetaphern um. Somit zerlegt er seinen Gesamteindruck in einzelne
Impressionen, um den Empfänger seine (des Verfassers) Gefühlsgänge
nachvollziehen zu lassen. Hier bringen wir zwei Beispiele aus der Erzäh-
lung von H. Böll „Die Botschaft“:
1. Etwa zehn Meter weit lief noch die Mauer, dann begann ein flaches,
grauschwarzes Feld mit einem kaum sichtbaren grünen Schimmer, das irgend-
wo mit dem grauen himmelhohen Horizont zusammenlief, und ich hatte das
schreckliche Gefühl, am Ende der Welt wie vor einem unendlichen Abgrund zu
stehen, als sei ich verdammt, hineingezogen zu werden in diese unheimlich
lockende, schweigende Brandung der völligen Hoffnungslosigkeit.
Links stand ein kleines, wie plattgedrücktes Haus, wie es sich Arbeiter nach
Feierabend bauen; wankend, fast taumelnd bewegte ich mich darauf zu. Nach-
dem ich eine ärmliche und rührende Pforte durchschritten hatte, die von einem
kahlen Heckenrosenstrauch überwachsen war, sah ich die Nummer, und ich
wußte, daß ich am rechten Haus war.
Die grünlichen Läden, deren Anstrich längst verwaschen war, waren fest ge-
schlossen, wie zugeklebt; das niedrige Dach, dessen Traufe ich mit der Hand
erreichen konnte, war mit rostigen Blechplatten geflickt. Es war unsagbar still,
jene Stunde, wo die Dämmerung noch eine Atempause macht, ehe sie grau und
unaufhaltsam über den Rand der Feme quillt.
2. Sie rutschte auf das Sofa und stützte sich mit der Rechten auf den Tisch,
während ihre Linke mit den ärmlichen Dingen spielte. Die Erinnerung schien
sie wie mit tausend Schwertern zu durchschneiden. Da wußte ich, daß der
Krieg niemals zu Ende sein würde, niemals, solange noch irgendwo eine Wun-
176
de blutete, die er geschlagen hat. Ich warf alles, Ekel, Furcht und Trostlosigkeit
von mir ab wie eine lächerliche Bürde und legte meine Hand auf die zuckende,
üppige Schulter, und als sie nun das erstaunte Gesicht zu mir wandte, sah ich
zum ersten Mal in ihren Zügen Ähnlichkeit mit jenem Foto eines hübschen,
liebevollen Mädchens, das ich wohl viele hundert Male hatte ansehen müssen,
damals...
Im ersten Fragment aus der Erzählung sehen wir die Schilderung einer
Stadt, in die der Held (hier auch der Erzähler) mit der tristen Botschaft
über den Tod seines Kriegskameraden kommt. Unglaublich schwer ist
ihm zu Mute und um sich herum sieht er nur das, was diese bedrückende
seelische Schwere noch klarer und deutlicher hervortreten lässt (tote
Fenster, schwarze Mauer, Totenhäuser, zerbröckelnder Verputz, düstere
Mauer, grauschwarzes Feld usw). Stellten wir die Liste der charakterisie-
renden Beiwörter aus diesem Fragment zusammen, würde sie uns ermög-
lichen, die Gefühlsatmosphäre, in der sich der Held befindet, zu er-
schließen. Das Düstere, das Schwarze, das Zerbröckelnde bilden den
Hintergrund, vor dem der Held seine Botschaft überbringen soll.
Im zweiten Beispiel handelt es sich um eine Vorgangsschilderung.
Die Vorgangsschilderung steht der Erzählung nahe und ist häufig in die
Erzählung eingebettet. Hier fehlt eine genaue Darstellung der Hand-
lungsabläufe, denn sie sind für den Erzähler gar nicht so wichtig. Viel
wichtiger ist für ihn die Gestaltung der Gefüh 1 e und Gedanken,
die ihn bei der Beobachtung der Vorgänge bewegen. Er gibt den äußeren
Rahmen der Handlungen wieder, die Details, die aber in seiner Seele
Anklang finden und stärkste Gefühle auslösen. Der Erzähler schafft
Stimmungsbilder, die auf den Empfänger übertragen werden müssen.
Die Darstellungsart Schilderung kennzeichnet den individuellen Stil
von H. Böll und W. Borchert und lässt zu, dass die Stilforscher in der
Schilderung genreprägende und genrebildende Züge vermerken, die der
so genannten Stimmungsnovelle zu Grunde liegen.
§ 42. Betrachtende Textformen
Das Betrachten ist nach der Schilderung der zweite Grundtyp der
impressiven Darstellung. Beim Betrachten werden Eindrücke wiederge-
geben, die sich auf Probleme beziehen. In gewissem Sinne handelt es
sich beim Betrachten um das impressive Gegenstück des Erörterns.
Während die Schilderung von Vorgängen unmittelbare Eindrücke zeich-
net, die bei der Wahrnehmung entstehen, spielt bei der Betrachtung das
rationale Element eine bedeutendere Rolle. Hier werden Einzelim-
pressionen miteinander verglichen, das Für und Wider von Wfertungen
erwogen. Hier ein veranschaulichendes Beispiel aus dem „Stern“- Auf-
satz „Der Umgang mit dem Tod“:
Plötzlich und unerwartet: In der Post ist ein Brief mit Trauerrand. Eine
schlechte Nachricht. Wer denn diesmal? Eine alte Freundin, Mutter zweier
177
Kinder, im besten Alter. Man fasst es nicht. Sie war doch gesund. Und wenr
das nun deine eigene...
Die Frage wird nicht zu Ende gedacht. Wir sind virtuose Verdränger. Einen
anderen Umgang mit Sterben und Tod haben wir ja nicht gelernt. Wir versi-
chern uns gegen alle Risiken, wir kennen jede Katastrophe aus dem Fernsehen,
wir sind auf alles gefasst, nur nicht auf das einzige, was wirklich sicher ist: aul
den Verlust unseres Lebens — also auch nicht auf den Verlust des Menschen,
der Teil unseres Lebens ist. (...)
In einer Gesellschaft, die Jugendlichkeit zum Maßstab macht, obwohl sie
immer älter wird, ist der Tod systemwidrig. Er wird zum Betriebsunfall dei
modernen Medizin, eine „verdammte Schweinerei“, wie der Schlau köpf Ba-
zon Brock formuliert, die endlich aufhören muss. Das sehen wir in Wahrheit
genau so.
Es nützt nur nichts. Unsere Weigerung, das Ende des Lebens als naturnot-
wendig zu akzeptieren, hat genau das Gegenteil dessen erreicht, was sie errei-
chen soll. Sie hat den Abschied vom Leben schwerer gemacht. Krankenhäuser
wollen keine Sterbehäuser sein, obwohl die meisten Menschen dort sterben.
Ärzte, die „nichts mehr tun“ können für ihre Patienten, wollen oft auch nichts
mehr mit ihnen zu tun haben. Gestorben wird gefälligst allein. Ratsch, man
zieht den Vorhang zu. (...)
Es ist ja gar nicht wahr, dass der Tod ein einmaliges Ereignis im Leben sei.
Jeder Abschied bei Lebzeiten ist ein kleiner Tod. Und es geht im Leben immer
auch um Trennung, um Abschiednehmen. Unsere Lebenszeit beginnt mit der
Trennung vom Mutterleib, und sie endet mit der Trennung vom eigenen Kör-
per. Und die vielen großen und kleinen Trennungen dazwischen nehmen diese
letzte vorweg. (...)
Sprachlich hat die Betrachtung wesentliche Züge mit der Schilde-
rung gemein. Der Text ist subjektiv geprägt, das Erleben des Verfas-
sers wird deutlich wiedergegeben. Die Auswahl der lexischen und gram-
matischen Mittel wird durch das Streben nach Expressivität, Anschau-
lichkeit und Bildhaftigkeit bestimmt. Die Betrachtung beruht auf dem
Reflektieren, dem Nachsinnen über Probleme, Gegenstände, Vorgänge
oder Situationen, deshalb handelt es sich bei dieser Darstellungsart um
eine ganz andere Einstellung des Verfassers zu den Sachverhalten der
objektiven Realität, als bei der Schilderung.
Die meisten konkreten Texte sind vom Standpunkt der Darstellungs-
art als Mischtypen zu interpretieren, da in ihnen Elemente verschiede-
ner Darstellungsarten verknüpft werden, aber die Gewichtung dieser
Darstellungsarten kann unterschiedlich ausfallen, so dass es in den
meisten Fällen möglich und ratsam ist von nominanten Darstel-
lungsarten zu sprechen. Die Lehre von den Darstellungsarten rüstet den
Sprecher/Schreiber mit wichtigen Mitteln und Verfahren aus, um Texte
in zahlreichen Bereichen der sprachlichen Kommunikation stilgerecht
und situationsangemessen zu gestalten. Durch die Darstellungsarten
oder, genauer gesagt, dank den Darstellungsarten werden Kommunika-
tionspläne und Kommunikationsstrategien realisiert. Man muss aber
betonen, dass die Planung einer kommunikativen Strategie stets ein
178
' schöpferischer Prozess bleibt. Er muss auf der Grundlage der jeweiligen
situativen Bedingungen und Intentionen immer wieder neu vollzogen
werden. Bei den Strategien selbst handelt es sich vielmehr um eine Ver-
allgemeinerung und Typisierung. Die Darstellungsarten selbst stellen
Orientierungshilfen dar, für die Aufstellung angemessener kommunika-
tiver Strategien. Es soll auch nicht heißen, dass wir in diesem Kapitel
eine erschöpfende Klassifikation von Texten dargeboten haben. Be-
stimmt gibt es auch andere Klassifikationsmuster, die auf anderen Aus-
gangskriterien beruhen. Aber aus unterrichtsmethodischen Gründen
scheinen uns die oben aufgefuhrten Klassifizierungstypen hinlänglich zu
sein um den Studierenden Anstöße zum weiteren Nachdenken und zur
praktischen Hinwendung zum oben umrissenen Problem zu verleihen.
Literaturnachweis
1. Fleischer WC, Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —
Leipzig, 1977.
2. Gülich E., Raible W. Linguistische Textmodelle. Grundlagen und Mög-
lichkeiten. — München, 1977.
3. Guseynova L. Argumentationsstrategien im modernen Werbetext. — Kau-
nas, 1997.
4. Hartung W. Muttersprachunterricht und die gesellschaftliche Funktion
der Sprache / Deutschunterricht. — 1970. — N° 23.
5. Sandig B. Zur Differenzierung gebrauchssprachlicher Textsorten im
Deutschen. — Frankfurt/M., 1972.
6. Schank G., Schwitalla J. Gesprochene Sprache und Gesprächsanalyse:
Lexikon der Germanistischen Linguistik. — Tübingen, 1983.
7. Sowinski B. Deutsche Stilistik. — Frankfurt/M., 1973.
8. Weinrich H Thesen zur Textsorten-Linguistik. — Frankfurt/M., 1972.
9. Weinrich H. Wege der Sprachkultur. — Stuttgart, 1985.
10. ÄdMOHU B, CncreMa <j)opM peneßoro BbiCKa3biBaHMM. — CI16., 1994.
Teil II
TEXTGRAMMATISCHE ASPEKTE
DER STILISTIK
Kapitel 9
DER TEXT ALS OBJEKT TEXTLINGUISTISCHER
FORSCHUNG
§ 43. Textlinguistik und ihre Bestandteile
Der weltberühmte Sprachforscher E.Benveniste erklärte einmal:
„Es gibt keine größere Redeeinheit als den Satz“. Einige Jahrzehnte
später, im Jahre 1967, erwiderte ihm der deutsche Linguist H. We i n -
rieh in einem Diskussionsbeitrag: „Wir sprechen in Texten“ und beti-
telte sein Buch, das im Jahre 1976 erschien, „Sprache in Texten“.
Die Textlinguistik als eine selbstständige Disziplin ist ziemlich jung
und nimmt ihren Anfang in unserem Land in den 40er Jahren in den
Beiträgen von A.J. Belic, N.S.Pospelov und im Ausland in den
Werken von K. B o o s t, Z. S. H a r r i s und später von K. L. P i k e,
W. Dressier, M. Bierwisch u.a. In den 60er und 70er Jahren
sprach man von einer Explosion der textlinguistischen Interessen
[s. Moskalskaja, 1984, 12], P. Hartmann, R. Steinitz, H. Isen-
berg, F. Dane§ und H. Weinrich haben viel dazu beigetragen,
dass die Textlinguistik zu einer eigenen sprachwissenschaftlichen
Disziplin wird. Die Textlinguistik hat also den Text als Forschungsob-
jekt.
B. S o w i n s k i definiert die Textlinguistik als eine Wissenschaft, die
weniger auf sprachliche Einzelphänomene achtet, vielmehr Regularitäten
ermittelt, die sich aus dem kommunikativen Gebrauch und der Produktion
sowie Rezeption von Texten und ihrer Einzelelemente ergeben. Sie vermag
Einblicke in die Kommunikation und Struktur von Texten zu bieten
[vgl. Sowinski, 1983, 9].
Mit dem Text als Forschungsobjekt beschäftigen sich zahlreiche Dis-
ziplinen. Jede davon hat gegenüber den Texten ihre eigenen Interessen
entwickelt, manche schon seit der Antike. Zu diesen Disziplinen gehö-
ren die Theologie, die älteste textgebundene Disziplin, die Gesell-
schaftswissenschaft, die Rechtswissenschaft und die Rechtspraxis, die
Journalistik, die Psychologie und Sozialwissenschaft, die Philologie und
die Literaturwissenschaft. Die Textinteressen der Textlinguistik sind
aber nicht nur auf den Textinhalt gerichtet, wie bei den oben genannten
Disziplinen, sondern vor allem auf die regelhaften Vorgänge der Text-
180
konstruierung, auf das Zustandekommen, das Zusammenwirken der
Textelemente, auf die kommunikativen Funktionen und Wrkungen von
Texten [s. Sowinski, 1983, 77].
Die Textlinguistik teilt sich in die allgemeine Texttheorie, die Text-
grammatik und die Textstilistik.
1. Die allgemeine Texttheorie beschäftigt sich mit den Fragen des
Textaufbaus, der Textdelimitation (Bestimmung der Textgrenzen),
der Textgliederung in seine Bestandteile (Mikrotexte, superphrasti-
sche Einheiten, die komplexen syntaktischen Ganzen usw.), mit der
Textkohärenz (Textzusammenhang) und mit der Bestimmung der an-
deren Textkategorien (Informativität, Abgeschlossenheit, Integration
usw.).
2. Die Textgrammatik untersucht das Funktionieren der traditionel-
len grammatischen Kategorien und Strukturen (Zeit, Modus, Person,
Bestimmtheit/Unbestimmtheit, syntaktische Satzmodelle u.a.) im
Rahmen eines Ganztextes und des Mikrotextes sowie mit ihrer Wirkung
im Bereich der Textkonstruierung und der Textgliederung.
3. Wenn die traditionelle Stilistik sich auf das Ermitteln von Stilfigu-
ren und auf die Beschreibung der Stilistika und ihrer Distribution be-
schränkte und ihren Stellenwert im Text untersuchte, so erforscht die
Textstilistik ihre textkonstruierende Funktion. Die wichtigste Aufgabe
der Textstilistik sieht B. Sowinski in der Ermittlung, Erklärung und In-
terpretation der Wahl bestimmter Textkonstituenten und ihrer variieren-
den Einzelelemente in individuellen und funktionalen Texten. Dabei
kann die Stilistik von der Textlinguistik textgrammatische Kategorien
und Einsichten über die Regelhaftigkeit der Substitutionen und Refe-
renzbeziehungen (Pronominalisierung und Kohärenzbeziehungen) zur
stilistischen Analyse und Interpretation nutzen. Es werden auch die
Aufbauformen von Texten, die Auswirkung bestimmter Erzählhaltungen
und Erzählperspektiven, Bildbereiche, die Wähl bestimmter Darstel-
lungsarten, Redeformen, Charakterisierungsweisen usw. untersucht
[vgl. Sowinski, 1983, 722].
§ 44. Der Makrotext und der Mikrotext. Ihre Kategorien
Heutzutage unterscheidet man zwischen zwei Arten des Textes:
dem Ganztext und dem Mikrotext. Unter dem Ganztext (Makrotext,
Gesamttext, Text im weiten Sinne des Wortes) versteht man ein gan-
zes sprachliches Werk. Unter dem Mikrotext versteht man einen
Teil text, eine Satzfolge, eine Satzgemeinschaft, einen Bestandteil
des Makrotextes.
Der Makrotext (Ganztext) und der Mikrotext sind durch unter-
schiedliche Kategorien und Eigenschaften gekennzeichnet. Zu den Ka-
tegorien des Makrotextes gehören nach I.R.Galperin [s. Tajibne-
Pmh, 1977]:
181
1) Informativität (führende Kategorie; sie wird durch die inhaltlich-
faktuale und inhaltlich-konzeptuale Information vertreten);
2) Abgeschlossenheit;
3) Integration (jeder Satz ist dem Hyperthema untergeordnet);
4) Kohärenz (Textzusammenhang, die Verflechtung der Sätze mit-
einander durch sprachliche Mittel, auch „Kohäsion“ genannt);
5) Retrospektive (Sprung in die Vergangenheit);
6) Prospektive (Sprung in die Zukunft);
7) Kontinuum (etwas Ununterbrochenes, Zusammenhängendes);
8) Tiefe;
9) Pragmatik (Wirkungsmöglichkeiten und Wirkungsbedingungen
von Texten);
10) Präsupposition (Vorwissen, bestimmte Informiertheit des Le-
sers).
E. I. Schendels zählt zu den Textkategorien auch die so ge-
nannten pragmalinguistischen Kategorien, darunter die Ka-
tegorie der kategorischen/nichtkategorischen Äußerung, der direkten/
indirekten Äußerung und die Kategorie der Kontaktaufnahme. Das
Wesen dieser Kategorien besteht darin, dass sie die Synthese aller
sprachlichen Aspekte unter Einbeziehung der außerlinguistischen
Faktoren unterschiedlichster Art verwirklichen. Sie treten erst im
Kommunikationsprozess, im Redeakt in Erscheinung und können
durch außerlinguistische Analysen unterstützt werden [vgl. Schen-
dels, 1985, 87].
Spricht man vom Mikrotext, so betont man in erster Linie seine
Hauptcharakteristiken: der Mikrotext ist eine inhaltliche, kommunikative
und strukturelle Ganzheit.
1. Die inhaltliche G a n z h e i t des Mikrotextes beruht auf sei-
nem einheitlichen Thema. Das Thema wird als begrifflicher Kern des
Textes, sein kondensierter und verallgemeinerter Inhalt verstanden. Alle
Sätze des Mikrotextes sind auf dasselbe Teilthema bezogen. Sie ergän-
zen einander bei der Erschließung des Teilthemas.
2. Die kommunikative Ganzheit des Mikrotextes beruht
auf der kommunikativen Kontinuität zwischen den Komponenten. Für
die Beschreibung der kommunikativen Ganzheit wurden von F. D a n e§
fünf „thematische Progressionen“ ausgearbeitet und zu fünf Modellen
zusammengefasst:
1) einfache lineare Progression: das Rhema (R) der ersten Äußerung
wird zum Thema (T) der zweiten:
I
T2(=R() —> R2
2) Progression mit einem durchlaufenden Thema: das Thema läuft
über mehrere Äußerungen hinweg, das Rhema ändert sich:
182
(T.-R.)
1
t2 (=r() -> r2
1
t2->r3
i
t2->r«
3) Progression mit abgeleiteten Themen: die Themen der einzelnen
Äußerungen sind von einem „Hyperthema“ abgeleitet:
T
4*
T । —> Rj T2 —> R2 T3 —> R3
4) Progression mit der Entwicklung eines gespalteten Themas: das
Rhema wird in der folgenden Äußerung teilweise dargestellt:
TI-RI(=RI' + R,")
p p
T2 ~ R-2 T2 ~ R2
5) Progression mit einem thematischen Sprung: ein Glied der thema-
tischen Kette, das aus dem Kontext erschlossen werden kann, wird aus-
gelassen:
T^Ri
1
T2->R2
1
... T4 —> R4
Danes betont, dass die aufgezeigten Typen der Textprogression nur
Schematisierungen darstellen. In den Texten erscheinen sie oft variiert
oder kombiniert.
3. Die strukturelle Ganzheit des Mikrotextes hat als ihr
wichtiges lexikalisches Merkmal die lexikalische Isotopie.
Das einheitliche Thema äußert sich in Schlüsselwörtern, die sich im
Rahmen des Textes wiederholen. Diese Wiederholung (die Rekurrenz)
der Wörter verbindet Einzelsätze miteinander und schafft ein Ganzes.
Wörter und feste Wortverbindungen in den aufeinander folgenden Sät-
zen, die den gleichen Gegenstand, die gleiche Erscheinung, den glei-
chen Sachverhalt bezeichnen, werden Topiks genannt (Terminus von
183
E. Ag r i c o 1 a). Unter den Topiks in verschiedenen Sätzen bestehen se-
mantische Beziehungen. Mehrere Topiks bilden eine Topikkette. Die
Gesamtheit der Topiks ergibt die Isotopie, d.h. die Kontinuität, das
Fortschreiten des Inhalts und des Themas.
Der Text kann mehrere nebeneinander laufende Topikketten haben.
E. Agricola unterscheidet mehrere Arten von Topiks, darunter auch fol-
gende (Beispiele von den Autoren ausgewählt):
1) die wörtliche Wiederholung eines Wortes:
Großvaters Tischschublade enthielt merkwürdige Dinge... Nach Großvater^
Berichten steckte in jedem Wirbelwind, der sommers über die Felder küselte,
ein Teufel... Ja, wenn es überall so beherzte Männer wie Großvater gegeben
hätte, hätte es nirgendwo in der Welt zu Wirbelsturmteufeleien kommen kön-
nen... (E. Strittmatter)
2) variierte Wiederholung eines Wortes oder einer Wbrtgruppe:
Es begann zu regnen, und eine kleine Mücke setzte sich auf die Unterseite
eines Birkenblattes ... es war ein Glück für sie, dass kein Wind aufkam, der die
Blattunterseite nach oben kehrte... (E.Strittmatter)
3) Wiederholung durch Pronomen:
Vor dem bitumengrauen Parkplatz zwischen Haus und Haus... lehnt sich
ein Junge auf sein Rad... Vor ihm schräg seitlich wie Gezweig herunter eine
mittelalte Frau... (E.Erb)
4) Wiederaufnahme durch Synonyme:
Sie trafen sich unter den Bäumen und nahmen die Blüten in die Hand.
Über ihnen lagerte das dunkle Geäst... (PK Trampe)
5) Wechsel von Kompositum und Grundwort:
In einer Dämmerung sah ich einen Zug Vögel nach Süden fliegen. Es waren
kleine Vögel. Es war ein Schlauch von Vögelleibern... Wo die flinken Anführer
des Vogelzuges aus unerkennbaren Gründen einen Bogen schlugen...
(E. Strittmatter)
6) Bezeichnung des Gattungsbegriffs und der Artbegriffe:
Die Tiere hatten für ihn eine ins Menschliche übersetzte Sprache:
Der Kater vor dem Scheunentor sagte zur Katze auf dem Heubogen:...
Der Hengst rief der Stute zu:... und die Kohlmeise sang:...
Die Krähen ermunterten im Winter einander:... und die Schwalbesang...
(£. Strittmatter)',
7) artgleiche Elemente:
Klar ist das Wasser in Tümpeln und Teichen... alles, was sommers im Wasr
ser schwebte, sank in die Tiefe, lebt dort im Sumpf. (E. Strittmatter)
Zu den grammatischen Merkmalen der Ganzheit zählt man:
1) einheitliche temporale Gestaltung;
184
2) Gebrauch des bestimmten Artikels als Anapher (Rückverweisung
auf die Vorerwähnung eines Gegenstandes oder einer Person im Text);
3) Gebrauch der Pronomen als Ersatzmittel für die Substantive in
anaphorischer (zurückverweisender) Funktion;
4) den kataphorischen (vorwärtsweisenden) Gebrauch mehrteiliger
Konjunktionen wie „bald... bald“, „teils... teils“ u. Ä.;
5) Umstandsbeziehungen mit temporaler, lokaler oder kausaler Be-
deutung, Konjunktionen und Pronominaladverbien;
6) Ellipse im dialogischen Text;
7) syntaktischen Parallelismus.
Bei der Gestaltung des Mikrotextes als syntaktischer Einheit mit
kommunikativer Funktion kommt der Stimmführung eine wichtige Rol-
le zu. So wird der Anfangssatz des Mikrotextes in einem höheren Regis-
ter gesprochen. Die Pause am Schluss des Textes übertrifft die Pause am
Satzende an Länge. Im Textinnem wechselt die Stärke der Betonung bei
der Ersterwähnung eines Gegenstandes und bei seiner wiederholten
Nennung [vgl. Moskalskaja, 2004, 331].
Der Stil eines Textes als seine spezifische Ausdrucksform leistet
bei der Gestaltung eines Ganztextes auch andere Dienste. Die Ge-
samtheit des Stils eines Textes, die stilistische Einheit der Ausdrucks-
weise festigt die Kohärenz eines Textes. Die Kohärenz wird durch
Mittel verschiedener Ebenen (der morphologischen, syntaktischen,
lexikalischen und fonologischen) gesichert. Der bevorzugte Stil, sei-
ne funktionalen, gattungsgemäßen und individuellen Eigenheiten so-
wie ihre Wiederholungen verleihen dem Text eine Stilprägung und
schaffen den Textzusammenhang. Je nach den Aufgaben, die vom
Autor des Textes gestellt wurden, kann der Text folgende Stilzüge
aufweisen: das Sachliche, das Geschäftliche, das Preziöse, das Ge-
fühlvolle, das Schaurige, das Dynamische, das Überladene usw.
[s. Sowinski, 1983, 123].
Stilzüge sind immer eine textliche Erscheinung. Verfolgen wir nun
die Wirkung verschiedener Einheiten im Text, indem wir den Ganztext
als die größte Einheit im Auge haben.
Grundsatzfragen der Stilistik können vom Standpunkt der Mikrosti-
listik und der Makrostilistik aus behandelt werden. Zu den Aufgaben der
Mikrostilistik gehören Erkennung und Systematisierung der stilistischen
Leistung der sprachlichen Einheiten aller Ebenen. Zu den Aufgaben der
Makrostilistik gehört die Erforschung des Stils als komplexe Erschei-
nung und Organisationsprinzip von Ganzheitsstrukturen. Ihren Unter-
suchungsgegenstand bilden „grundsätzlich abgeschlossene sprachliche
Großeinheiten“. Dabei muss die Wechselbeziehung zwischen dem Gan-
zen und seinen Teilen beachtet werden [vgl. Riesel, Schendels, 1975,
11—12].
Jeder Funktionalstil verfügt wie gesagt über seine Besonderheiten,
seine Eigenartigkeit, seine Kombinationen von Sprachmitteln. Obwohl
die genannten Textkategorien jedem Text eigen sind, unabhängig von
185
Funktionalstil, Genre und Textsorte, werden sie in jedem Fall transfor-
miert oder anders rangiert, was von den pragmatischen Aufgaben des
Textes abhängt.
Dies soll nun am Beispiel der Kategorie der Informativität, die in je-
dem Text als seine führende Kategorie erhalten bleibt, gezeigt werden.
Im Unterschied zu den anderen Funktionalstilen verfugt der künstle-
rische Text über drei Arten der textualen Information [s. Pajn>nepuH
1981]:
1) die inhaltlich-faktuale Information, die im Text explizit, durch
Worte ausgedrückt ist;
2) die inhaltlich-konzeptuale Information, die nicht verbal zum Aus-
druck kommt, sondern aus dem Ganztext, aus dem gesamten Inhalt er-
schlossen werden kann;
3) die inhaltlich-subtextuale Information, die fakultativ ist; wenn sie
aber im Text vorhanden ist, so bildet sie zusammen mit der expliziten,
inhaltlich-faktualen Information den Kontrapunkt des Textes.
Es ist noch einmal zu betonen, dass diese Arten der Information
nur aus dem Ganztext zu erschließen sind.
Die schöngeistige Literatur ist wie bekannt eine besondere Art der
Kommunikation und hat eine Reihe von Aufgaben, die sie auf ihre Wei-
se und mit den ihr zugänglichen Mitteln erfüllt. J. R. B e c h e r betonte:
Die Literatur wendet sich an den ganzen Menschen, sie hat vor allem
die Macht, den Menschen bis ins tiefste Innere hinein, bis in die Regio-
nen des Unbewussten und des Unbewusstseins zu erschüttern und um-
zugestalten. Das verursacht also auch die Funktionen, die der Literatur
eigen sind. Zwar sind ihre Liste und ihre Rangordnung bis heute nicht
endgültig bestimmt, aber die meisten Forscher sprechen von der ästheti-
schen, emotionellen, erzieherischen, kognitiven, kathartischen Funkti-
on. Als wichtigste wird die ästhetische Funktion anerkannt, weil
sie einen großen Einfluss auf die Gefühle des Lesers ausübt. Die Vielfalt
und die Eigenartigkeit der Funktionen beeinflussen also den Charakter
der Textkategorien, darunter auch der Kategorie der Informativität, die
im künstlerischen Text in ihren drei Arten existiert. Es sei noch einmal
betont, dass die inhaltlich-konzeptuale und die inhaltlich-subtextuale
Information in diesem Funktionalstil von besonderer Bedeutung für die
Erschließung des Textinhalts sind.
Im Unterschied zu dem Stil der schöngeistigen Literatur ist die Kate-
gorie der Informativität im Stil der Wissenschaft grundsätzlich anders.
Die pragmatische Aufgabe eines wissenschaftlichen Textes besteht da-
rin, neue Kenntnisse mitzuteilen. Dabei spielt die inhaltlich-faktuale
Information die Hauptrolle, indem die inhaltlich-konzeptuale und in-
haltlich-subtextuale Arten entweder in den Hintergrund treten oder gar
verschwinden.
Die Entwicklung der Sprachwissenschaft in allen ihren Bereichen
führte also zur Umwertung vieler sprachlicher Erscheinungen und zur
Entdeckung neuer Kategorien, die erst auf einer neuen Stufe der lin-
186
guistischen Forschungen sichtbar wurden. So existieren neben den her-
kömmlichen grammatischen Kategorien (Kategorie der Zeit, des Ge-
nus, der Zahl, der Prädikativität, der Redeabsicht u.a.), den lexisch-
grammatischen und funktional-semantischen Kategorien (Kategorie der
Temporalität, der Modalität u.a.) auch die so genannten „globalen Ka-
tegorien“, z.B. die Kategorie „Mensch“, die in jeder Sprache ihre
spezifischen Ausdrucksmittel hat: eine besondere Wahl der Substantive
und Pronomen, der Verben und Satzmodelle sowie auch der wortbilden-
den Elemente. Sie bezeichnen den Menschen und seine Tätigkeit und
gehören sowohl zur morphologischen als auch zur syntaktischen Ebene
der Sprache. Diese Kategorie durchdringt also den gesamten Bau der
Sprache [vgl. Schendels, 1980].
In den wissenschaftlichen Beiträgen wurden mehrmals die engen
Wechselbeziehungen zwischen Textliguistik und traditioneller Stilistik
betont. Was die oben genannten Kategorien anbetrifft, so ist es die Auf-
gabe der Textlinguistik, diese Kategorien aufzudecken und zu erfor-
schen, ihren Charakter und ihre Rolle für die Textgestaltung zu bestim-
men. Die Aufgabe der Textstilistik aber besteht darin, die Wirkung dieser
Kategorien in verschiedenen Funktionalstilen zu ergründen. Damit be-
fassen wir uns in den nächsten Abschnitten.
Literaturnachweis
1. Agricola E. Semantische Relationen im Text und im System. — Halle
(Saale), 1972.
2. Danes F. Zur linguistischen Analyse der Textstruktur // Textlinguistik /
Hrsg, von W.Dressier. — Darmstadt, 1978. — S. 185—192.
3. Isenberg H. Texttheorie und der Gegenstand der Grammatik // Linguisti-
sche Studien, Reihe A. — Berlin, 1974. — H. 11.
4. Klimonow G. Überlegungen zu einigen definitorischen Kriterien des Text-
begriffes // Studia grammatica XVIIL Probleme der Textlinguistik II. — Berlin,
1977.-S. 181-185.
5. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. — M.,
2004.
6. Moskalskaja O.I. Textgrammatik. — Leipzig, 1984.
7. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. — M., 1975.
8. Schendels E. I. Die Kategorie Mensch in der deutschen Gegenwartsspra-
che // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsfor-
schung. - 1980. - Bd. 33. - H. 3. - S. 371-378.
9. Schendels E. I. Pragmatik, Semantik und Konnotation in der Grammatik
// Deutsch als Fremdsprache. — 1985. — H. 2. — S. 84—88.
10. Sowinski B. Textlinguistik. Eine Einführung. — Stuttgart; Berlin; Köln;
Mainz, 1983.
11. lajibnepuH M.P. TpaMMaTHHecKHe KaTeroprm TeKCTa: (ontiT oöoöme-
hhh) // W3BecTHH AH CCCP. Cepna JiHTeparypH n H3biKa. — 1977. — T. 36. —
No 6.- C. 522-532.
12. IdribnepuH H.P. Teiccr kbk oöbeKT JiMHrBMCTMMecKoro nccjiejxoBaHHH. —
M., 1981.
187
Kapitel 10
DIE KOMPOSITION DES MAKROTEXTES
§ 45. Die Komposition und die Architektonik
Diesen Abschnitt beginnen wir mit der Frage: Warum heißt die Lite-
ratur auch „schön“, „schöngeistig“? Was beinhaltet in diesem Fall das
Attribut „schön“? Im synonymischen Ausdruck, der der französischen
Sprache entlehnt wurde — „die Belletristik“ — ist auch das Wort
„schön“ — belle vorhanden.
In vielen stilistisch orientierten Beiträgen finden wir Überlegungen
über den Begriff des Schönen in Bezug auf den Text. So betont V. Otto,
dass Wilhelm von Humboldt als einer der ersten über die äs-
thetische Wirkung der Sprache auf den Menschen gesprochen hat. Zwar
dehnte er den Begriff der Kunst auf die gesamte Sprache aus, aber er er-
kannte in der Sprache Aspekte des Schönen, des Harmonischen, des
Wohlklangs, der Bildhaftigkeit und der Ausdrucksfahigkeit [vgl. Otto,
1980].
Nach der Meinung von V. 011 o besteht das Spezifische des Schönen,
bezogen auf den Text, unter anderem in Folgendem:
1. Ein Text wird vom Rezipienten nur dann als ästhetisch positiv be-
wertet, wenn der Textproduzent seine Kommunikationsabsicht in einem
passenden Kommunikationsplan manifestiert. Man spricht dabei von
der so genannten „Wo hlgeformtheit“ des Textes.
2. Eine bedeutende Rolle spielt dabei auch die Art der Thema-
entfaltung, unter anderem auch folgende Momente:
— logischer Aufbau des Ganztextes und der Teiltexte;
— Besonderheiten in der kompositorischen Gestaltung des Textes
(Rahmenbau/Ringfigur, antithetischer Aufbau, Steigerung/Graduie-
rung u.a.);
— deutliche Motivierung der architektonischen Besonderheiten
durch thematisch-kompositorische Textmomente.
3. Ein Text wird vom Rezipienten nur dann als ästhetisch positiv be-
wertet, wenn er für ihn inhaltlich bedeutsam und zugleich
kommunikativ zweckmäßig gestaltet ist, d. h. auf kommunika-
tiv Unnötiges verzichtet.
4. Ein Text wird nur dann als ästhetisch positiv bewertet, wenn er im
Rahmen einer Kommunikationsaufgabe stilistisch ausdrucks-
reich ist und wenn sein Informationsgehalt vom Rezipienten opti-
mal erfasst werden kann.
Es ist aber selbstverständlich, dass das Schöne als Begriff nicht abso-
lut sein kann und mit der ökonomischen, politischen, ethisch-morali-
schen Entwicklung der Gesellschaft verbunden ist. In dem Werturteil,
ob etwas „schön“ oder „hässlich“ ist, prägen sich soziale Positionen aus.
188
Der Schriftsteller denkt also nicht nur an die Klarheit, Verständlich-
keit und Wirksamkeit der Sprache. Er bemüht sich um eine wo h 1g e-
formte, schöne Aussage, denn gerade so eine Aussage rührt das
Schönheitsempfinden des Lesers an.
Greifen wir zu Texten, die zu anderen Funktionalstilen gehören, so
entdecken wir in ihrer Struktur auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die
diese Texte zu wohlgeformten Gebilden machen. Es besteht kein Zwei-
fel daran, dass diese Gesetzmäßigkeiten im Text eines offiziellen Briefes
oder eines wissenschaftlichen Beitrags ganz anders sind als in einer No-
velle. Das lässt sich dadurch erklären, dass diese Texte verschiedene
Funktionen und verschiedene pragmatische Wirkung auszuüben haben.
Die allgemeine Texttheorie geht davon aus, dass den Text von zufälli-
gen Satzfolgen eine bestimmte Eigenschaft abhebt — die Wohlgeformt-
heit, oder die Wohlkomponiertheit. Der Text hat also eine bestimmte
Komposition, die bei einer zufälligen Satzfolge fehlt. Diese These gilt
für alle Texte mit zwei Ausnahmen. Als Sonderfall können Dialog-
texte gewertet werden sowie auch Texte, die nur aus einem oder
zwei Sätzen bestehen. Sie sind durch kompositionelle Nichtgeformt-
heit gekennzeichnet.
Die Komposition als stilistischer Begriff hat im Laufe von wenigen
Jahrzehnten eine breite Verwendung gefunden und verfügt über einige
Definitionen. Eine der Definitionen lautet:
Die Komposition eines Werkes ist die Einheit von innerem {thematisch-
gedanklichem) und äußerem {architektonisch-formalem) Aufbau sowie der
Verbindung zwischen beiden [vgl. Riesel, 1974, 178].
Man unterscheidet zwischen Makrokomposition (Komposition eines
ganzen Kunstwerkes) und Mikrokomposition (Komposition der einzel-
nen Textteile — Kapitel, Teilkapitel, Absatz). Die Makrokomposition
eines Werkes ist seine Architektonik, die Entfaltung der Hauptinhaltsli-
nien, ihre Verflechtung und gegenseitige Anordnung [s. Moskalskaja,
1984, 78].
Wie aus der Definition folgt, unterscheidet man auch zwischen der
Komposition und der Architektonik, indem man auch eine entgegenge-
setzte Meinung vertritt. M. M. B a c h t i n betonte mehrmals die Not-
wendigkeit, diese Begriffe auseinander zu halten. So schrieb er: „Der
Roman ist eine rein kompositionelle Form der Organisation von Wort-
massen. Durch diese Form wird im ästhetischen Objekt die architekto-
nische Form der künstlerischen Vollendung eines historischen oder so-
zialen Ereignisses verwirklicht.... Das Drama ist eine kompositionelle
Form (Dialog, Akteinleitung u.a.), das Tragische und das Komische
sind architektonische Formen der Xbllendung... Die Form des Lyrischen
ist architektonisch, doch gibt es kompositionelle Formen lyrischer Ge-
dichte... Humor, Heroisierung, Typus, Charakter sind architektonische
Formen, doch werden sie natürlich durch bestimmte kompositionelle
Verfahren verwirklicht; Poem, Kurzroman [povest’], Novelle sind kom-
positionelle, generische Formen; Kapitel, Strophe, (Vers-)Zeile bilden
189
kompositionelle Gliederung (wenn sie auch rein linguistisch verstanden
werden können, das heißt, unabhängig von ihrem ästhetischen Telos)“
[Bachtin, 1979, 106-107].
Architektonische Formen sind nach M. M. Bachtin Formen des seeli-
schen und körperlichen Wertes des Menschen in der Ästhetik, Formen
der Natur wie seiner Umwelt, Formen des Ereignisses in seinem sozia-
len und historischen Aspekt und dem Aspekt des persönlichen Lebens
u.a.m.
Kompositionelle Formen dagegen organisieren das Material, haben ei-
nen dienenden Charakter. Sie können folgenderweise bewertet werden:
in welchem Maße sie die architektonische Aufgabe verwirklichen.
Die architektonischen Formen bestimmen die Auswahl der komposi-
tionellen Formen: so wählt die Form der Tragödie (die Form des Ereig-
nisses, teilweise der Person — der tragische Charakter) die adäquate
kompositionelle Form, die dramatische Form (ebenda).
In der linguistischen Literatur gibt es mehrere Versuche kompositio-
nelle Einheiten der Texte zu bestimmen. Es wurden verschiedene funk-
tionale Stile analysiert und folgende Schlussfolgerungen gezogen:
1. Das Kompositionsschema einer Fabel sieht (nach E. R i e s e 1) fol-
genderweise aus: Exposition — Dialog und Handlungen der Tiere —
Moral [vgl. Riesel, 1974, 101].
2. Die Komposition eines Märchens besteht (nach CI. Bremond)
aus drei Teilen: Anfang — Handlung — Resultat [s. Bremond, 1970].
3. In den Beiträgen von H. Isenberg und E. Lang wird das
Kompositionsschema der Nachrichtensendungen angeführt: Ankündi-
gung der Mitteilungsabsicht — Mitteilung 1 — ... — Mitteilungen —
Ankündigung des Endes der Sendung (Coda).
4. Das Kompositionsschema eines Gesuches hat folgende Elemente:
l) Kopf mit Angabe: a) des Namens des Ersuchenden (links), b) seiner
Anschrift und des Datums (recht), c) der Bezeichnung des Angespro-
chenen; 2) Betreff; 3) Text des Gesuches, bestehend aus: a) dem Inhalt
des Gesuches, b) der Begründung, c) dem Schlusssatz; 4) Grußformel
und Unterschrift [s. Moskalskaja, 1984, 80],
5. Im wissenschaftlichen Artikel unterscheidet man vier Bestandteüe:
Einleitung — Theorie/Problem — Experiment — Besprechung/Schluss-
folgerungen.
Auch die Texte der gesprochenen und der geschriebenen interperso-
nalen Kommunikation haben ein bestimmtes einigermaßen präzises
Kompositionsschema.
So lassen sich im Privatbrief folgende Elemente unterscheiden:
1) Datum; 2) Anrede des Adressaten; 3) Bezugnahme auf den letzten
Brief des Adressaten oder ein Kommentar zur Situation (Entschuldi-
gung für die verspätete Antwort, Hinweis auf die Umstände, unter denen
der Brief geschrieben wird); 4) Hauptteil des Briefes (Mitteilungen);
5) Fragen an den Adressaten (oder Darlegung von Gedanken und Ge-
fühlen des Briefschreibers); 6) Schlussteil (Grüße, Unterschrift).
190
Die Komposition eines Textes ist nicht nur mit den Charakteristiken
des Funktionalstils oder des Genres verbunden. Manchmal verlangen
kulturelle Traditionen einen strengen Rahmen. So ist die Komposition
eines höflichen japanischen Briefes sehr streng konventionalisiert. Fol-
gende Elemente sind obligatorisch: 1) Symbol der Saison, der Jahres-
zeit; 2) Gruß; 3) Beschreibung der Natur; 4) Fragen über das Leben und
Angelegenheiten des Adressaten; 5) Erzählen über sich selbst; 6) Ent-
schuldigung, falls der Autor des Briefes lange nicht geschrieben hat;
7) Bitte; 8) Abschied; 9) Datum; 10) an wen der Brief geschrieben wird;
11) wer geschrieben hat [vgl. AKimiMHa, 1979].
Ein Telefongespräch in Deutschland wird nach folgendem Schema
gebaut: 1) kontaktherstellender Teil des Gesprächs (eine Formel);
2) Angabe des Anrufenden; 3) wen man sprechen möchte; 4) Begrüßung
und gegenseitige Vorstellung der Gesprächsteilnehmer; 5) Hauptteil
(Dialog); 6) Schluss/Verabschieden. Telefongespräche weisen in ver-
schiedenen Kulturen ihre eigene Spezifik auf. So unterscheidet sich die
Struktur des Telefongesprächs im russischen Kulturraum von dem oben
angeführten Kompositionsschema durch den zweiten Punkt: die Russen
stellen sich nur vor, wenn sie dem Gesprächspartner gut bekannt sind.
Zwei weitere Begriffe, die in der modernen Linguistik verbreitet
sind — Absatz und Mikrotext — sind ebenfalls auseinander zu halten.
Der Text ist, wie schon betont wurde, ein inhaltliches, kommunikati-
ves und strukturelles Ganzes. Die Vereinigung der einzelnen Sätze in ein
Ganzes wird durch verschiedene Mittel gesichert. Ihr Zusammenwirken
eigibt eine der wichtigsten Charakteristiken des Ganztextes — seinen
Zusammenhang, oder seine Kohärenz.
Aber man kann auch über einen entgegengesetzten Prozess sprechen:
über die Gliederung des Ganztextes in seine Bestandteile (die Segmen-
tierung des Textes) und über die Bestimmung seiner Grenzen (die Deli-
mitation).
Die Bestimmung der Grenzen eines schriftlichen Ganztextes ruft
keine Schwierigkeiten hervor. In den meisten Fällen hat der Ganztext
einen Titel, der die obere Grenze des Textes bildet. Die untere Grenze
ist durch den Abstand des letzten Satzes vom nächsten Text markiert.
Es bestehen auch große Meinungsunterschiede in der Frage über die
Textsegmentierung. Heutzutage spricht man über das transphrasti-
sche Ganze, über das komplexe syntaktische Ganze,
über die prosaische Strophe,den Mikrotext, den Absatz.
Wenn das transphrastische Ganze, das komplexe syntaktische Ganze
und der Mikrotext Begriffe der textlinguistischen Analyse sind, so findet
der Absatz in der Stilistik seine Verwendung. Aber auch da kommen Un-
terschiede in der Deutung dieses Terminus zum Vbrschein.
So behandelte T. I. S s i 1 m a n den Absatz als einen typografischen,
syntaktischen und literarisch-kompositionellen Begriff und definierte
ihn als eine syntaktisch-intonatorische Einheit, die aus einem oder einigen
Sätzen besteht. Diese Sätze sind miteinander durch syntaktische Mittel
191
(Konjunktionen, Adverbien) verbunden, von lexikalisch-pronominalen
Wederholungen durchdrungen und durch ein einheitliches Thema ver-
einigt [s. CmibMaH, 1967, 412]. Der Absatz ist also nach Meinung von
T.Ssilmaneine monothematische Einheit.
L. Friedman unterscheidet zwischen literarisch-kompositionel-
lem, stilistischem und syntaktischem Aspekt des Absatzes. Darunter ver-
steht er einen Redekomplex, der inhaltlich und intonatorisch einheitlich
ist. Seiner Meinung nach kann der Absatz sowohl monothema-
tisch als auch polythematisch sein [vgl. Friedman, 1972, 2<57],
Der Absatz kann auch als kleinste kompositionelle Einheit gel-
ten, die in mündlichen Texten von anderen Absätzen durch eine längere
Pause getrennt wird, über ein relativ geschlossenes Thema verfugt und in
schriftlichen Texten grafisch durch Abstände von anderen Textteilen ab-
gegrenzt wird.
G. S o 1 g a n i k hält die Termini „Absatz“ und „komplexes syntakti-
sches Ganzes“ für untauglich und schlägt stattdessen den Terminus
„prosaische Strophe“ vor. Er versteht darunter eine „enge semantisch-
syntaktische Einheit der Sätze in der Prosa“. Die prosaische Strophe ist
monosemantisch [vgl. CoJiraHMK, 1973, 187].
Die Frage über die Einteilung des Textes in seine kompositionellen
Elemente (Textdelimitation) ist eine umstrittene Frage. Wenn die Be-
stimmung der Grenzen bei dem Titel und dem Epigraf keine Schwierig-
keiten bereitet (sie sind grafisch vom eigentlichen Text getrennt), so fällt
die Grenze zwischen dem Anfang und der Mitte, zwischen der Mitte
und dem Ende nicht immer auf. In diesem Fall müssen sprachliche Sig-
nale identifiziert werden, die diese Grenze verzeichnen.
Diese Signale lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
1) lexikalische Signale des Übergangs: Ende einer Topikkette
und Anfang einer anderen; Erscheinung der so genannten Pro-For-
men, d. h. Wörter, die früher erwähnte einzelne Wörter, Sätze, sogar
Absätze im Text ersetzen können (das, damit, deshalb, so usw); die
Pronominalisierung (der Ersatz des Substantivs durch ein Pronomen);
2) grammatische Mittel: Artikelwechsel (bestimmt —unbe-
stimmt); Zeitformenwechsel; Moduswechsel; Genuswechsel; Über-
gang zu einem anderen syntaktischen Satzmodell; Veränderung der
Satzlänge; Veränderung der Wortfolge.
§ 46. „Starke Positionen“ im Text
(der Titel, das Epigraf, der Anfang, der Schluss)
Nicht alle genannten Kompositionsteile haben in der inhaltlichen
Textstruktur den gleichen Wert. Einige Elemente nehmen im Text eine
besondere Position ein. Sie sind vorgeschoben, manche auch grafisch,
und lenken deswegen die Aufmerksamkeit des Lesers viel stärker auf sich
als die anderen.
192
Zu solchen vorgeschobenen Elementen gehören Titel, Epigraf, An-
fang und Schluss. Die Positionen, die diese Kompositionselemente im
Text bekleiden, nennt man „starke Positionen“. Titel und Textanfang
bilden den Ausgangspunkt für die Prognostizierungsoperationen.
Der Titel
Eine der grundlegenden Kategorien des Ganztextes ist seine Abge-
schlossenheit. Dieses Merkmal des Makro- oder Ganztextes stößt (nach
Meinung von I. R. Galperin) den Titel auf die Textoberfläche herauf.
Ohne Titel kann man kein Textmodell aufbauen. Zwar gibt es Texte
ohne Titel — lyrische Gedichte, Zeitungsberichte, Briefe u. a., aber auch
in diesen Texten erfüllt die erste Zeile die Funktion ihres Titels
[s. rajn>nepi4H, 1981, 7#].
Der Titel ist also das erste kompositionelle Element des Ganztextes, das
vorgeschobene Element, mit dem die Bekanntschaft des Lesers mit dem Text
beginnt.
Es gibt verschiedene Standpunkte in Bezug auf den Titel und seine
Rolle im Text. Einige Sprachwissenschaftler sind der Meinung, dass der
Titel der Name des Textes ist. Er sei ein Element, das außer dem Text
steht. Die anderen nennen den Titel „die inhaltliche Dominante des
Textes“, die den ganzen Aufbau des Textes bestimmt. Er ist der Inhalt
des Textes, in zwei — drei Wörtern zusammengefasst. Wieder andere be-
handeln den Titel als eines der Elemente in der formalen, kompositio-
nellen und inhaltlichen Struktur des Textes. Laut dieser Meinung gehört
der Titel zum Text. H. We i n r i c h vertritt den Standpunkt, dass jeder
Titel eine Art der Vorinformation in Bezug auf den ganzen Text ist, denn
er informiert in einer knappen Form über den Inhalt des Textes. Außer-
dem ruft er in dem Leser die Erwartung einer neuen, vollständigen In-
formation hervor, lenkt diese Erwartung und bestimmt ihre Richtung.
Deswegen nennt H. Weinrich den Titel auch „makrolinguistische Er-
wartungsinstruktion“ [Weinrich, 1976, 7#].
In der einschlägigen Literatur werden folgende Funktionen des Titels
genannt:
1) nominative Funktion, 2) informative Funktion, 3) reklamierende
Funktion, 4) überzeugende Funktion, 5) zusammenfassende Funktion,
6) delimitierende (abgrenzende) Funktion, 7) sensationelle Funktion,
8) dekorative Funktion, 9) repräsentative Funktion.
Welche Funktion im konkreten Text in den Vordergrund tritt, hängt
davon ab, zu welchem Funktionalstil der Text gehört.
Bei der Titelgebung wirken semiotische, semantische und pragmati-
sche, dazu noch syntaktische und stilistische Aspekte zusammen. Unter
semiotischem (d. h. zeichentheoretischem) Aspekt ist der Titel eines
Textes (einschließlich möglicher Unter- und Zwischentitel) nach der
Meinung von B. S o w i n s k i eine Form der Kennzeichnung eines Tex-
tes. Ein literarischer Texttitel ist ein auf der Konvention beruhendes
Eorafbipeua
193
Symbol. Er betont, dass heute symbolisierende oder andeutende Kurzti-
tel beliebt sind [vgl. Sowinski, 1983, 95—96].
Bei der Beschreibung des Titels als eines Kompositionselementes
muss man einige wesentliche Momente berücksichtigen: 1) Besonder-
heiten des Titels im Vergleich zu den anderen starken Positionen (Epi-
graf, Anfang, Schluss); 2) Besonderheiten der Titelgestaltung in den
Texten verschiedener Funktionalstile; 3) Besonderheiten der Titel in
einzelnen Textsorten in einem Funktionalstil.
Im Vergleich zu den anderen starken Positionen weist der Titel fol-
gende Merkmale auf: Streben nach Knappheit und Kürze, Bevorzugung
der Substantive als Wortart mit der größten Informativitätspotenz, Ori-
ginalität der grafischen Gestaltung (in der Regel ist der Titel in einer an-
deren Schrift gedruckt, als der ganze Text, mit einem bestimmten Ab-
stand vom eigentlichen Text). So heißt ein Werk von St. Hermlin
„Abendlicht“ und die Monografie von G. Helbig „Geschichte der neue-
ren Sprachwissenschaft“.
Selbstverständlich kann der Titel auch stark erweitert werden, aber
dann soll diese Erweiterung eine bestimmte inhaltliche Aufgabe erfül-
len. Der Autor will bei dem Leser entweder Assoziationen zu einem an-
deren Werk hervorrufen („Die Leiden des jungen Schlossers“ in einer
Kabarettszene) oder einen Stil nachahmen, wie es z. B. I. Morgner mit
ihrem Romantitel erzielt — „Leben und Abenteuer der Trobadora Bea-
triz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura“. Der Roman hat dazu noch
einen Untertitel: „Roman in dreizehn Büchern und sieben Intermez-
zos“. In diesem Fall dürfen wir wohl über die Nachahmung eines Titels
aus der mittelalterlichen Literatur oder der Barockzeit sprechen.
Die Zahl der syntaktischen Modelle des Titels ist heute nicht unbe-
grenzt. Insgesamt sind es wohl sechs oder sieben Modelle, die regel-
mäßig in dieser starken Position erscheinen:
1) Substantiv^ — „Abschied“ von J. R. Becher; „Textgrammatik“ von
O.I. Moskalskaja;
2) Adjektiv + Substantiv x — „Die linkshändige Frau“ von P. Handke;
3) Substantiv + (präp.)1 2 Substantiv-^ — „Die Abenteuer des Werner
Holt“ von D. Noll; „Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für den
Ausländerunterricht“ von G. Helbig und J. Buscha;
4) präp. Substantiv2 3 4 — „Zwischen den Rassen“ von H. Mann;
„Zum Lesen und Schmunzeln“ (Rubrik in einer Zeitung);
5) Satz — „Der Tag ist in die Nacht verliebt“ von W. Steinberg;
„Dann brennt Nahost“ (Artikel in der Zeitschrift „Der Spiegel“);
6) Substantiv + Partizip — „Schatztruhe geöffnet“, „Scheuklappen
angelegt“.
Solche Strukturen wirken wie Bruchstücke von Sätzen und sind nicht
selten mit Absicht mehrdeutig.
1 Die Zahlen bei dem Substantiv zeigen den Kasus: 1 — Nominativ, 2 — GenitN
3 — Dativ, 4 — Akkusativ.
2 präp. = präpositional
194 £
Beträchtliche Unterschiede kommen zum Vorschein, sobald wir
Texte aus verschiedenen Funktionalstilen analysieren. Unterschiedli-
che pragmatische Aufgaben, die der Autor mit Hilfe des Textes zu lö-
sen hat, diktieren die Wähl der Titelgestaltung. Damit sind nicht nur
Unterschiede in der Thematik, sondern auch in der syntaktischen
Struktur des Titels gemeint. Er kann aus einem einzigen Wort
bestehen, dabei erscheint im Titel eines belletristischen Wer-
kes jede Wortart ohne weitere Ergänzung, z. B. eine Konjunktion
(„Deshalb“ bei E. Strittmatter) oder ein Adverb („Zu früh“). Gut be-
kannt ist der englische Film mit dem Titel „If“ („Wenn“). Hier er-
scheinen Modelle, die in anderen Funktionalstilen nicht zu gebrau-
chen sind, z. B. Substantiv + zu + Infinitiv („Zeit zu leben und Zeit zu
sterben“ bei E. M. Remarque).
In den Zeitungsartikeln findet in den letzten Jahren das syn-
taktische Modell mit dem Doppelpunkt („Nachbarländer: Irak
den Irakern“; „Begegnungen: Der Rohtabaker“) eine immer größere
Xferbreitung.
In Texten, die ursprünglich für die mündliche Überlieferung be-
stimmt waren, können auch einige Tendenzen verzeichnet werden. Es
ist bekannt, dass die Fabel, die nach A.Jolles zu den so genannten
„einfachen Formen“ gezählt wird und nach G. E. Lessing „der gemein-
schaftliche Raine der Poesie und Moral“ ist, auf dem Zusammenstoß
von zwei oder mehreren Charakteren aufgebaut ist. Diese Gegenüber-
stellung widerspiegelt sich nicht nur auf lexikalischer Ebene („Der Löwe
und der Hase“, „Der Esel und das Jagdpferd“), sondern auch im syn-
taktischen Modell, das für die Fabel charakteristisch ist — „Substantiv +
und + Substantiv („Der Mann und der Hund“, „Der Adler und der
Fuchs“ von Lessing). Wird ein Charakter dargestellt, so erscheint ein
anderes Modell: Substantiv („Der Hirsch“, „Die Wasserschlange“, „Die
Taube“ von Lessing).
Außer den oben genannten Funktionen erfüllt der Titel eine Reihe
von Aufgaben, die unmittelbar mit dem Textinhalt verbunden sind. Die
Auswahl der Texte, die gelesen werden, hängt wesentlich von der Attrak-
tivität, der Aktualität, der geschliffenen sprachlichen Formulierung, also
von den Wirkungsfaktoren der Überschrift ab [s. Starke, 1982, 2]. Um
diesen Effekt zu erzielen, greift der Autor eines künstlerischen oder pub-
lizistischen Werkes zu folgenden wirksamen Mitteln:
— Gebrauch eines vieldeutigen Wortes. Um zu bestimmen, in welcher
Bedeutung das Wort gebraucht wird, wendet sich der Leser an den Text.
So heißt eine Kurzgeschichte von E. Strittmatter „Der Umschlag“. Die-
ses Lexem hat wie bekannt sechs Bedeutungen: 1) der Umschlag eines
Buches (ofijioMKa); 2) der Briefumschlag (Koneepm); 3) der Umschlag
als Heilmittel (KoMnpecc); 4) der Umschlag als Element der Bekleidung
(omeopom); 5) der Umschlag als eine unerwartete Veränderung
(ueoztcudaHHaH nepeMena); 6) der Umschlag als eine Art des Transportie-
rens (nepezpy3Ka moeapoe c oöhozo euda mpancnopma Ha dpyzoü). Erst
195
der Anfang des Textes schafft Klarheit: es geht um eine rasche Wetter-
veränderung.
— Verletzung der semantischen Kongruenz. Dieses Verfahren ist in der
schöngeistigen Literatur sowie im Stil der Zeitung und
Publizistik sehr beliebt. Es besteht darin, dass zwei oder mehrere
Wörter, die nach ihrer Bedeutung miteinander nicht zu verbinden sind,
doch als eine Einheit gebraucht werden. So finden wir bei E. Kästner ei-
nen Text unter dem Titel „Die einäugige Literatur“. „Das Leipziger Ka-
barett“ führt Programme unter den Titeln: „Scherz in moll“, „Mit Tul-
pen und Pasteten“ auf. In einer russischen Zeitung erscheint eine Ge-
schichte mit dem Titel «Hy/it nod coycoM».
— Einführung in den Titel einiger emotional gefärbter Elemente, da-
runter einer Wiederholung („Die lange, lange Straße entlang“; „Der
viele, viele Schnee“; „Maria, alles Maria“ bei W. Borchert).
— Gebrauch der synsemantischen Wörter, die die Erwartung nach ei-
nem weiteren Wort, d. h. nach weiterer Information, hervorrufen („Des-
halb“, „Zu früh“ bei E. Strittmatter).
— Einführung in den Titel eines Fremdwortes („Cosi non fan tutte“,
„Comeback“ in den satirischen Theaterstücken).
— Gebrauch einer Autorenbildung, die nach einem in der Sprache
existierenden Modell aufgebaut ist („Verschärft die Lachsamkeit!“,
„Schlaglöchriges“ als Titel einiger Kabarettstücke).
Manchmal scheint der Titel ein Zitat aus demselben Text zu sein
(„Als der Krieg ausbrach“; „Steh auf, steh doch auf“ bei H. Böll).
Eine weitere Aufgabe besteht darin, Assoziationen mit anderen Wer-
ken hervorzurufen. So heißt eine lyrische Miniatur bei E. Strittmatter
„Die Bremer Stadtmusikanten“. Da erwartet der Leser schon bestimmte
Parallelen im Sujet zu dem berühmten Märchen.
Der Titel kann lediglich auf ein anderes Werk vage anspielen. So
wirkt der Titel eines Kabarett-Stücks „Lob der Partei“, der die Titel der
Brecht’schen Gedichte „Lob des Lernens“, „Lob der Partei“, „Lob des
Revolutionärs“ nachahmt.
Es gibt auch Titel, die einen poetischen Wert haben. Sie enthalten die
Bezeichnungen von Blumen, Jahreszeiten, Wettererscheinungen („Veil-
chen“, „Nach dem Gewitter“, „Septembermorgen“). Sie wirken „poe-
tisch“, weil sie nicht nur Gegenstände und Erscheinungen bezeichnen,
sondern auch als Symbole bestimmter Zustände oder Stimmungen des
Menschen in der gegebenen Kultur anerkannt sind.
Im Unterschied zur schöngeistigen Literatur und zum Zeitungstext
steht der wissenschaftliche Beitrag vor anderen pragmati-
schen Aufgaben, darunter auch Informationsaustausch im
professionellen Bereich. Diese Information ist für einen engen
Leserkreis, für Sachkundige bestimmt, deshalb enthält der Text Berufs-
lexik, die schon im Titel erscheinen kann. Die Forderungen an den Titel
sind: möglichst genau, voll und eindeutig den Inhalt des Textes zu prä-
sentieren („Warten und Wartenkönnen. Zu einem Leitmotiv im Werk
196
von Anna Seghers“ von B.Leistner oder „Linguistische Aspekte der
Komposition im künstlerischen Text“ von G. Michel).
Dasselbe gilt auch für Titel von Texten des öffentlichen Ver-
kehrs. Der Inhalt von Instruktionen, Anleitungen, Annotationen wird
schon im Titel erläutert („Trixo: Kräuterbalsam, dreifach wirksam, für
natürliche Hautpflege mit Collagen“).
Es wird betont, dass die semantische Beziehung zwischen Titel und
Text in den meisten journalistischen Textformen und in Gebrauchstex-
ten viel deutlicher erscheint als in den belletristischen Texten. In der
Presse und Publizistik sowie in verschiedenen Dokumenten besitzt der
Texttitel häufig noch die Funktion der thematischen Kenn-
zeichnung des Textes. In der Zeitung erscheinen dabei auch Mehr-
fachtitel, von denen die Schlagzeile (oder head-line) oft das Publikums-
interesse weckt, während der Vortitel und Untertitel differenzierter in-
formieren:
TAIWAN - BÖRSE ÜBERKOMMT WAHL - BLUES
Experten empfehlen*. Investoren sollen sich vorerst
vom Taiwanischen Paket fern halten
Bei anderen Gebrauchstexten kennzeichnet der Texttitel häufig zu-
gleich die pragmatische Funktion des Textes (z. B. Telegramm, Antrag
auf Erteilung eines Reisepasses usw). Die besondere Information tritt
hier zu Gunsten der Zielsetzung oder Textbestimmung zurück [vgl. So-
winski, 1983, 97\.
Das Epigraf
Das Epigraf ist ein fakultatives Element der Textstruktur. Es steht nach
dem Titel vor dem Textanfang, erläutert die Hauptidee des Werkes und
spielt die Rolle einer Stimmgabel in dem Musikbereich: es gibt den Ton
an und erzeugt bei dem Leser eine besondere Stimmung.
Als Epigraf werden gewöhnlich Zitate aus anderen Werken ge-
braucht sowie auch Sprichwörter, Sprüche, geflügelte
Worte u.a. Einmal entstanden, wandern sie durch Jahrzehnte und
Jahrhunderte. Dank ihrem schlagwortartigen Charakter, der einprägsa-
men Form und der treffsicheren Ausdrucksweise sind sie auch auf ande-
re Situationen und Zeiten anwendbar.
Das Epigraf ist hauptsächlich in Werken der schöngeistigen
Literatur zu treffen. So hat das prosaische Werk von Stephan Herm-
lin „Abendlicht“ als Epigraf die Worte von Robert Walser:
„Man sah den Wegen am Abendlicht
an, dass es Heimwege waren“.
Es stimmt den Leser lyrisch und deutet den Titel des Buches: das
Abendlicht ist eigentlich die Abschiedsstimmung. Der Autor spricht
über die eigene Vergänglichkeit, kehrt in seinen Gedanken in die Jugend
197
zurück und versucht „Wahrheit und Dichtung, Andeutung und poeti-
sches Symbol“ aneinander zu fügen.
Wissenschaftliche Monografien und sogar Nach-
schlagewerke können auch mit Epigrafen versehen werden. So fin-
den wir in dem von U. Eichelberger zusammengestellten Zitatenlexikon
das folgende Epigraf aus Egon Erwin Kirsch:
„Nichts ist verblüffender als die einfache
Wahrheit, nichts ist exotischer als unsere Umwelt,
nichts ist phantasievoller als die Sachlichkeit.“
Diese Worte helfen dem Leser sich auf eine bestimmte Information
einzustellen.
Für die Textlinguistik ist es wichtig, festzustellen, wie das Epigraf mit
dem einheitlichen Text verbunden ist: durch Wiederholung einer und
derselben lexikalischen Einheit, durch ein einheitliches Thema, oder es
stellt nur einen absichtlich fragmentar eingebauten fremden Text dar,
der mit dem eigentlichen Text kontrastiert [s. JIoTMan, 1992, 121].
Der Anfang
Der Anfang des Textes, der zu dessen starken Positionen gehört,
spielt bei der Textaufnahme eine außerordentlich wichtige Rolle: er
führt den Leser in die fiktive Welt ein, in die Welt des künstlerischen
Werkes.
„Mit dem ersten Wort löst sich die Fiktion von der Wirklichkeit ab,
um eine Welt eigenen Gesetzes zu formieren. Damit hebt sich auch das
Spiel an zwischen dem Autor, der listenreich das Publikum in seinen
Bann zu ziehen versucht, und dem Leser, der ihm halb widerstrebend,
halb wissbegierig ins Garn geht. Und dieses Spiel ist nirgends so klar zu
erkennen, wie hier, wo es gilt, den ersten und stärksten Reibungswider-
stand des außenstehenden Lesers zu überwinden, ihn teilnehmend in die
Welt der Fiktion hineinzuziehen“ [Müller, 1968, 9].
Der Umfang des Textanfangs ist unterschiedlich. Im Roman er-
streckt sich dieses „Spiel mit dem Leser“ über einige Abschnitte, sogar
Seiten. „In der Kurzgeschichte hat der Autor nicht soviel Zeit. Er wird
mit dem ersten Satz in die Geschichte springen, und der Leser, gefangen
durch den Titel und den ersten Satz, wird ihm unbedingt folgen. Der
Leser glaubt sich noch in der Wirklichkeit aufzuhalten, wenn er schon
längst in die Fiktion versetzt ist“ [Rohner, 1976, 140].
J. L. L e w i t o v nennt den Anfang „Exposition“ und unterscheidet
folgende Arten: die Exposition der Unbestimmtheit („Sie war
nicht hübsch. Aber sie war siebzehn und ich liebte sie.“ W. Borchert); die
Exposition, die die Handlung oder den Prozess betont („Die Tür
ging hinter mir zu.“ W. Borchert); die Exposition des unmittelbaren
Appellierens an den Leser („Du. Mann an der Maschine und
Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Was-
198
serrohre und keine Kochtöpfe mehr machen — sondern Stahlhelme und
Maschinengewehre, dann gibt es nur einst Sag NEIN!“ W. Borchert); die
Exposition der Pseudoreportage und der Pseudogegenwart
(„Ein Morgen im Juni. Es ist fünf Uhr. Mein Nachbar mäht, sein Schwie-
gersohn mäht und auch ich mähe“ E. Strittmatter) [vgl. JIcbutob, 1975].
N. K. Danilova unterscheidet drei Arten der Anfänge.
1. Der expositive Anfang erzählt die Vorgeschichte, zeigt retrospektiv
das, was vor der eigentlichen Handlung geschah.
2. Der introduktive Anfang berichtet über die Ereignisse mit, die
gleichzeitig mit der Handlung im Text geschehen. Er enthält Erklärun-
gen des Autors oder seine Überlegungen, eine Anrede an den Leser.
3. Der erzählende Anfang, der den Leser gleich in die Handlung ein-
fuhrt, beginnt gleich mit der unmittelbaren Schilderung der Ereignisse
[s. /faHimoBa, 1981].
Eine andere Klassifikation der Anfänge schließt vier Arten der An-
fänge in sich ein:
1) faktualen Anfang — er macht den Leser mit einer Tatsache bekannt
und bildet den Ausgangspunkt in der Entwicklung der Handlung: „Es
war vier Uhr und noch dunkel draußen, und wirführen in die Hauptstadt. “
(E. Strittmatter);
2) generalisierenden Anfang — er enthält eine Verallgemeinerung, die
später im Text erörtert wird: „Nichts, wenn man es sich überlegt, kann
dazu verlocken, in einem Wettrennen der erste sein zu wollen.“ (F. Kafka);
3) retrospektiven Anfang — er teilt die Vorgeschichte mit: „Als junger
Mann hatte sich Großvater auf einer Aktion einen alten Pelzmantel gekauft,
einen alten Mantel aus ungeschorenem Schaffell.“ (E. Strittmatter);
4) prospektiven Anfang — er teilt mit, was später geschah, nach den
Ereignissen, die im Text beschrieben werden: „Eines Tages stand ein Vo-
gelkäfig aus fingerstarken Birkenzweigen in unserer Stube. Ein lustiger Kä-
fig, die weiße Birkenrinde glänzte wie Seide und die Fürscharniere aus
Weidenruten schimmerten gelb und braun“ (E. Strittmatter). Weiter folgt
die Erzählung darüber, was vor diesem Tag geschah [vgl. Ho3ApnHa,
1981].
Eine besondere Art bilden die Textanfänge, die den Leser ohne jegli-
che Vorbereitung gleich in die Mitte der Handlung einfüh-
ren. E. TA. Hoffmann schrieb: „Es war einmal — welcher Autor darf es
jetzt wohl noch wagen, sein Geschichtlein also zu beginnen. — Veral-
tet! — Langweilig! — so ruft der geneigte oder vielmehr ungeneigte Le-
ser, der nach des alten römischen Dichters weisem Rat gleich in medias
res versetzt sein will“ (zit. nach: Rohner, 1976, 139).
„In medias res“ oder anders gesagt „in die Mitte der Handlung“ ist
ein verbreitetes Verfahren in der künstlerischen Literatur. „Sie
sahen ihn schon von weitem auf sich kommen, denn er fiel auf. Er hatte ein
ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, daß er erst zwanzig
war“ — so beginnt die Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ von W. Bor-
chert. W. Rasc h nennt solche Anfänge „ab r u p t“. Im Unterschied
199
zum epischen Anfang (nach Raschs Terminologie „Eingang“), der un-
verrückbar an der Stirne der Erzählung steht, scheint der abrupte Anfang
beliebig verschiebbar zu sein. Er ist geformt, dass er seinen Charakter als
Anfangssatz verleugnet und den Eindruck erweckt, in einem Zusam-
menhang zu stehen. „Der abrupte Anfangssatz ist wie das plötzliche
Wegzeichen des Xörgangs...“[Rasch, 1959, 452—453].
W. Schneider nennt dieses Verfahren „Verführungskunst“.
Der Leser ist gewohnt, dass mit den Pronomen „er“ und „sie“ auf etwas
bereits Genanntes und ihm Bekanntes hingewiesen wird. Er lässt sich
leicht täuschen und empfindet die Person oder Sache als vertraut, ob-
wohl er noch nichts Genaues darüber erfahren hat [s. Schneider, 1963,
142]. Es entsteht eine bestimmte Spannung. Die Lösung dieser Span-
nung wird hinausgezögert. Der Leser sucht die Antwort auf die Frage,
wer diese „er“ und „sie“ sind, im nachstehenden Text.
Um diesen Effekt zu erreichen, greift der Autor zu verschiedenen
Mitteln:
— zum unmotivierten Gebrauch von Personalpronomen: „Er tappte
durch die dunkle Vorstadt.“ (W. Borchert);
— zum unmotivierten Gebrauch eines Eigennamens: „Heute nacht
war Radi bei mir.“ (W Borchert);
— zum unmotivierten Gebrauch des Pronominaladverbs: „Dabei war
mein Onkel natürlich kein Gastwirt.“ (W. Borchert);
— zum Gebrauch des Substantivs bei der Ersterwähnung mit dem
bestimmten Artikel: „Der nackte Schädel schwamm wie ein blankgeboh-
nerter Mond unterderblassen Nachtbeleuchtung.“ (W.Borchert);
— zum Gebrauch einer Konstruktion, die als Antwort auf eine Frage
gelten kann, die überhaupt nicht gestellt wurde: „Ich weiß nicht“, rief ich
ohne Klang, „ich weiß ja nicht. Wenn niemand kommt, dann kommt eben
niemand.“ (F. Kafka);
— zum Gebrauch eines Fügewortes in der Anfangsposition: „Denn
wir sind wie Baumstämme im Schnee“ (F. Kafka) u. a.
Der Anfang eines dramatischen Werkes ist von solchen Mit-
teln durchdrungen. Sie verweisen auf Äußerungen, die außerhalb des
textlichen Rahmens stehen:
Clara: Noch keine Antwort? Martin: Nein. Clara: Wie lange sind die
Telegramme weg? Martin: Zwei Stunden schon. (H. Böll)
In diesem Fall nimmt der Autor keine Rücksicht auf die Präsupposi-
tion des Lesers oder des Zuschauers und baut den Anfang des Stückes
nur auf der Präsupposition der handelnden Personen auf. Der Zuschau-
er ist nur ein zufälliger Zeuge, der in medias res versetzt wird und sich
nur langsam in die Verhältnisse einlebt. Jedes Theaterstück ist bekann-
termaßen nur eine kleine Episode, die aus dem langen Lebensprozess
der handelnden Personen ausgeschnitten ist.
Ein Telefongespräch beginnt, wie bereits erwähnt, mit einem kon-
taktaufnehmenden „Hallo!“, ein Privatbrief mit „Lieber N./liebe N.l“,
200
ein Märchen mit „Es lebte einmal...“, „Es war einmal...“. Ein wissen-
schaftlicher Beitrag beginnt in der Regel mit einer Verallgemeinerung:
„In diesem Beitrag geht es um die Getrennt- und Zusammenschreibung, ei-
nen Teilbereich der Rechtschreibreform, die 1998in den deutschsprachigen
Ländern in Kraft getreten ist“ (M. Walch. „Orthographiereform und
Wortbildung“).
Der Schluss (das Ende)
Obwohl der Schluss sowie auch der Titel und der Anfang zu den star-
ken Positionen gehört, wurde ihm leider nicht so viel Aufmerksamkeit
geschenkt, wie den anderen Positionen. Aristoteles definierte es
kurz und bündig: „Das Ende ist das, aus dem nichts Weiteres mehr ent-
steht“ [zit. nach: Rohner, 1976, 246].
In der modernen Stilistik unterscheidet man je nach dem Genre eini-
ge Typen von Schlüssen. In den literarischen Werken sind es
Epilog, Moral, Epipher (mehrfache Wiederholung eines Wortes, einer
Wortgruppe, eines Satzes oder eines Absatzes).
Die Interpreten der Kurzgeschichte, die heute den ersten Platz
unter den literarischen Genres belegt, sprechen über ihre „UnVer-
schlossenheit“. Man unterscheidet 1) das schlusspunktartige Ende,
2) den problematisch-offenen Schluss, 3) den symbolhaft-vorausdeuten-
den Schluss. Dabei wird nachdrücklich betont, dass keine direkten Be-
züge zwischen einer bestimmten Form der Erzählung und einer be-
stimmten Form des Erzählschlusses bestünden [P.O. Gutmann; zit.
nach: Rohner, 1976, 246—248],
Das Märchen endet oft mit einer Schlussformel, die mit dem In-
halt eines konkreten Märchens nicht verbunden ist und aus einem Mär-
chen in das andere wandert. In den russischen Märchen sind es die be-
rühmten Worte: Mn maM 6bia, nted-nueo nun, no ycaM metcno, da e pom He
nonano. Manche deutsche Märchen enden mit den Warten: Mein Mär-
chen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, datf sich eine große, große
Kappe daraus machen. Oder: Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der
Mund noch warm.
Die Parabel und die Fabel als belehrende Texte enden oft mit
einer Moral: „Wer keine Dankbarkeit kennt, ist der Hilfe nicht wert“.
Das Rätsel kann mit einer Frage enden: „Zwei Dinge stehen, zwei
Dinge gehen, zwei Dinge kommen, hast du’s vernommen?“ (Himmel
und Erde, Sonne und Mond, Abend und Morgen).
In einigen Texten der schöngeistigen Literatur greift der
Autorzum Effekt der „getäuschten Erwartung“. Darunterver-
steht man etwas für den Leser oder Hörer völlig Unerwartetes, einen
Bruch der Vorhersehbarkeit, eine völlig unerwartete Lösung am Ende
der Geschichte. Dieser Terminus wurde von M. R i f f a t e r r e in die
Stilistik eingeführt und von vielen Linguisten beschrieben. I. W. A r -
n o 1 d betont, dass diese Erscheinung auf jeder sprachlichen Ebene zu
201
treffen ist. In der Lexik sind es Wörter, die selten vorkommen, z. B. Ar-
chaismen oder Entlehnungen, in der Stilistik — Wörter oder Konstruk-
tionen aus einem anderen Stil. Es können auch grammatische Kategori-
en sein, die in dem gegebenen Text nicht vorgesehen sind [s. ApHojita,
1981],
Auf dem temporal-thematischen Kriterium basierend, könnte man
alle Enden in vier Gruppen einteilen:
1. faktualer Schluss — er berichtet von einer Tatsache, die als letzte
in einer Reihe von Erscheinungen vorkommt, in einer natürlichen Rei-
henfolge und in der gleichen Zeitform wie die vorhergehenden Sätze:
„Und um halb zehn kam Hildegard und fragte... Sie strich sich die Haare
aus dem Gesicht.“ (P. Bichsei);
2. das Ergebnis — es enthält eine Idee, eine Moral, eine Verallgemei-
nerung, die ihre Aktualität nicht verloren hat, und hat das Prädikat im
Präsens: „Förster haben mit dem Wald zu tun. Frauen haben mit dem War-
ten zu tun. Häuser sind Häuser.“ (P. Bichsei);
3. prospektiver Schluss — er ist in die Zukunft gerichtet und hat die
Verben im Futur oder im futurischen Präsens: „Auch im nächsten Jahr
werde ich die Hirsche nicht hören, es sei denn, man verlegt die Woche des
Buches, aber das kann ich nicht verlangen.“ (E. Strittmatter);
4. retrospektiver Schluss — er ist in die Vergangenheit gerichtet und
berichtet von einer Erscheinung, die der Handlung in der Mitte voran-
geht; die Verben stehen im Plusquamperfekt oder im Präterit in der Be-
deutung des Plusquamperfekts — Mitte: „Gestern entdeckte ich eine rote
Blüte auf dem Abgrund. Schluss: die Gräser hatten den Weiher besiegt und
eine Blumenfahne gehißt“ (E. Strittmatter).
Ein Telefongespräch endet mit der Abschiedsformel „Tschüs!“
oder „Auf Wiederhören!“.
Der Privatbrief hat die Schlussformeln „Mit herzlichen
Grüßen“, „Herzliche Grüße von N.“, „Mit Hoffnung auf ein baldiges
Wiedersehen“.
Der wissenschaftliehe Beitrag endet mit einer Schlussfol-
gerung, einer Zusammenfassung, einer Verallgemeinerung, z. B. „Mit
den fünf genannten Hauptauswahlkriterien für literarische Texte ist ge-
wiss nur der Rahmen abgesteckt, in dem weitere Untersuchungen erfor-
derlich sind“.
Die Analyse der sprachlichen Mittel, die für die Gestaltung der An-
fänge und Enden im Ganztext dienen, setzt also die Berücksichtigung
der Besonderheiten, die den Funktionalstil, das Genre, die Textsorte
kennzeichnen, voraus. Diese Parameter bedingen oft die Wahl der lexi-
kalischen Mittel, der stilistischen Figuren. Oft ist ihre Wahl auch durch
die Komposition des Textes bestimmt: linguistische Mittel, zu denen
der Autor bei der Gestaltung des Anfangs greift, unterscheiden sich in
bedeutendem Maße von den Mitteln, die das Ende des Textes kenn-
zeichnen. Einige Mittel sind universell, d.h. für jeden Typ des Anfangs
oder für jeden Typ des Schlusses charakteristisch, andere erscheinen
202
nur in Texten eines bestimmten Genres oder in einer bestimmten
Textposition.
Zwischen den Kompositionsteilen des Ganztextes entstehen Verbin-
dungen verschiedener Art.
I. Verbindung des Titels mit dem Text. Das Thema, im Titel bereits
formuliert, erfüllt nicht nur die Funktion der Themenankündigung,
sondern bildet auch einen Rahmen für die Zielstellung von Seite des
Autors.
Die thematische Verbindung des Titels mit dem Text lässt sich durch
den Begriff des Topiks erklären. Die Topikketten, die den ganzen Text
durchdringen, beginnen oft schon im Titel. Das zweite Glied der Topik-
kette erscheint am Anfang des Textes oder in seiner Mitte. Wenn das
zweite Glied erst im Schluss auftaucht, entsteht im Prozess des Lesens
eine bestimmte Spannung. Die Lösung findet der Leser im letzten Satz.
Die Retardation (Verzögerung), zu der der Autor greift, verstärkt das In-
teresse für den Inhalt und stellt Ähnlichkeiten des Textes mit einem
Rätsel her:
Der blinde Passagier
(E. Strittmatter)
Ich zupfte blaue Weinbeeren von einer Traube. Im Gewirr der Beerenstiele
saß ein rotes Beerlein, das sich bewegte. Ich entdeckte einen Marienkäfer, ei-
nen Gast aus Ungarn, in unserer Küche im Wald.
Die im Titel gebrauchte Metapher wird erst im letzten Satz enträt-
selt: der blinde Passagier ist ein Marienkäfer.
Manchmal beteiligt sich der Titel an der Bildung von zwei Topik-
ketten. Das geschieht, wenn der Titel ein Kompositum ist. Dann wird
im Text jeder Bestandteil des Titels entwickelt. So nehmen im Texttitel
„Grasmähen“ (E. Strittmatter) zwei Topikketten ihren Anfang. Die ers-
te Kette beginnt mit dem Teil „Gras-“ und läuft durch den ganzen Text:
...Kamille... Hahnfuß... Schwingel... Knaulgras... Blumen... Blumen. Die
zweite beginnt mit „-mähen“ und wird durch die Wiederholung eines
Wortes fortgesetzt: ...mäht... mäht... mähe.
Der Titel kann mit einem anderen Satz des Textes, auch mit dem
Schlusssatz, eine Frage-Antwort-Einheit bilden. So heißt eine
Kalendergeschichte von E. Strittmatter „VVäs sagt der See?“. Die Ant-
wort enthält der letzte Satz: „Wenn ich gesagt haben werde, was ich zu
sagen hatte, wird er immer noch reden'.,Flick, flock, flick, flockV “
Im Text „Das Vogelnest im Pferdeschwanz“ bildet den Schluss eine
Frage:
Das Vogelnest im Pferdeschwanz
(E. Strittmatter)
Der Blauschimmelhengst stürmte durch die Koppel. Er sielte sich im Sand,
er schabte sich den Schwanz. Lange Haare flogen im Winde davon. Ein Bach-
stelzenweibchen fing sie ein.
203
Wir entdeckten das Nest der Bachstelze. Sechs Vogelschlünde reckten sich
uns entgegen. Das Nestnäpfchen war aus Schimmelschwanzhaaren geflochten.
Habe ich gelogen?
Der Titel des Textes verspricht dem Leser etwas Ungewöhnliches.
Mit der Frage im Schluss versucht der Autor herauszufinden, ob er die
Erwartungen des Lesers nicht enttäuscht hat, die nach dem Lesen des
Titels entstanden.
Von einer engen inhaltlichen \ferbindung zwischen dem Titel und an-
deren kompositionellen Einheiten des Ganztextes zeugen solche Bei-
spiele wie in der Erzählung von W. Borchert „Schischyphus oder der
Kellner meines Onkels“. Der Text beginnt folgenderweise:
Dabei war mein Onkel natürlich kein Gastwirt. Aber er kannte einen Kell-
ner. Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner Treue und
mit seiner Verehrung, daß wir immer sagten: Das ist sein Kellner. Oder: Ach so,
sein Kellner.
Wenn wir den Titel des Textes nicht gleich in die Analyse einbezie-
hen, so scheint der Gebrauch des Pronominaladverbs „dabei“ unmoti-
viert zu sein. Schwer zu erklären wäre auch die Verneinung „kein Gast-
wirt“ sowie das Modalwort „natürlich“. Nur die Berücksichtigung des
Titels lässt uns die Zusammenhänge richtig erkennen.
II. Die Verbindung zwischen Anfang, Mitte und Schluss. Zwischen
Anfang, Mitte und Schluss bestehen auch hinsichtlich des Themas ver-
schiedene Arten der Verbindung.
1. Der vollständige formal-thematische Ring: Der Satz aus dem Anfang
oder aus der Mitte wird wortwörtlich im Schluss wiederholt. So beginnt
und endet der Satz „Manchmal wünsch ich mir die Kraft einer Gänseblume“
die Kalendergeschichte von E. Strittmatter „Die Gänseblumen“.
2. Der nicht vollständige formal-thematische Ring: Nur ein Teil des
Anfangssatzes oder eines Satzes aus der Mitte wird im Schluss wieder-
holt. Dabei handelt es sich um die teilweise Wiederholung des lexikali-
schen Bestandes und der syntaktischen Struktur:
Es liegt ein Großbauernhof dorfab in der Feldmark, und er vergeht, obwohl
er breit wie ein gut verwurzelter Baum aus der Erde wächst. — Es liegt ein
Großbauernhof hinter Holunder... (E. Strittmatter)
3. Thematischer Ring: Er entsteht, wenn der Schluss thematisch be-
sonders eng mit dem Anfang oder der Mitte veibunden ist. Das kommt
durch das Aufnehmen früher unterbrochener Topikketten zum Aus-
druck:
Der See leuchtete noch vom Abendrot, dann wurde der Himmel stumpf,
und auch der See wurde stumpf... — Da zeugte der See einen zweiten See. Der
zweite See war aus Nebel und schwebte. (£. Strittmatter)
4. Ring — Antithese: Dieser Ring wird aus Einheiten mit entgegengC'
setzten oder kontrastierenden Bedeutungen gebildet:
204
In einer Mainacht ritt ich lange umher, doch die Rauhfußkäuze, auf die ich
aus war, ließen sich nicht hören. — Das Gewitter zog ab. Leiser Wind tat sich
auf. Iri den Fichten klagten die Rauhfußkäuze. (£. Strittmatter)
Literaturnachweis
1. Bachtin M.M. Das Problem von Inhalt, Material und Form im Wort-
kunstschaffen // Die Ästhetik des Wortes/M. Bachtin. — Frankfurt a. M., 1979.
2. Bremond CI. Morphology of the French Folktale // Semiotica. — 1970. —
Vbl. 2. - No 3. - P. 247-276.
3. Fridman L. Einige Besonderheiten polythematischer Absätze und ihrer
Komponenten in der deutschen Gegenwartssprache // Zeitschrift für Phone-
tik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. — 1972. — H. 4—
5. — S. 270-286.
4. JollesA. Einfache Formen. — Halle (Saale), 1929.
5. Moskalskaja O.I. Textgrammatik. — Leipzig, 1984.
6. Müller K. Der empfindsame Erzähler: Untersuchungen an den Roman-
anfangen des 18. Jhs. — München, 1968.
7. Otto V. Sprachstilistische Aspekte bei der Kommunikationsplanung und
stilistischen Gestaltung von Texten // Beiträge zur Textlinguistik der künstleri-
schen Literatur/ Hrsg, von G.Michel, L.Wilke. — Potsdam, 1980. — S. 163—
170.
8. Rasch W. Eine Beobachtung zur Form der Erzählung um 1900. Das
Problem des Anfangs erzählender Dichtung // Stil und Formprobleme in der
Literatur. — Heidelberg, 1959.
9. Riesel E. Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation. —
M., 1974.
10. Rohner L. Theorie der Kurzgeschichte. — Wiesbaden, 1976.
11. Schneider W. Stilistische deutsche Grammatik. — Freiburg; Basel;
Wien, 1963.
12. Sowinski B. Textlinguistik: Eine Einführung. — Stuttgart; Berlin; Köln;
Mainz, 1983.
13. Starke G. Titelgestaltung im sozialistischen Journalismus // Sprachpfle-
ge. - 1982. - H. 1.
14. Weinrich H. Sprache in Texten. — Stuttgart, 1976.
15. ÄKuiuuHa A.A. Crpyicrypa ijejioro TeKCTa. — M., 1979. — Bbin. 2.
16. ApHO/ibd H.B. CTMjiMCTKKa coßpeMeHHoro aHrjinftCKoro H3biKa. — JL,
1981.
17. EaxmuH M.M. ScreTMKa cjiOBecnoro TBOpqecTBa. — M., 1979.
18. FanbnepuH H.P. Tckct kbk oGbckt JiMHrBMcnwecKoro wccjieÄOBaHMH. —
M., 1981.
19. ffüHu/ioea H. K. CrpyKTypno-ceMaHTKnecKaH xapaKTepncTKKa aöcojuoT-
Hbix 3a<iKHOB b xanpe KOpOTKoro paccKasa: AßTope^. ämc. ... Kami. 4)mjioji.
HayK. — M., 1981.
20. Jleeumoe IO.JI. HeKOTopbie rpaMMaTMKO-CTKJincTtwecKiie ocoöchhoctk
3Kcno3KUnn HOBejui Bojib^ranra Bopxepra // CbopnnK /jOKJiajjOB n cooßmeHMü
JiHHrawcTMuecKoro oömecTBa. — KajinHMH. — 1975. — Bbin. V. — C. 183—194.
21. JIomMaH K).M. KyjibTypa n B3pbiB. — M., 1992.
22. MocKOJibCKax O.H. fpaMMaTMKa Teiccra. — M., 1981.
205
23. HoidpuHa JLA. Komhoskukh h rpaMMaTHHeCKKe cpoucTBa cbhshoctk xy-
AOxecTBeHHoro tckcth: AßTOpecJ). akc. ... Kana- (f)mioji. HayK. — M., 1981.
24. CuAbMaH T.H. npoöiieMbi cwHTaKcunecKOH cthjihcthkk. — JE, 1967.
25. ComaHUK F.JI. CwHTaKCtpjecKafl cTUJiKCTMKa. — M., 1973.
Kapitel 11
SPRACHLICHE EINHEITEN IM TEXT
UND IHRE STILISTISCHE LEISTUNG
Der Text als höchste Stufe der sprachlichen Einheiten schließt Ein-
heiten aller anderen Ebenen als Komponenten in sich ein. Dazu gehö-
ren Einheiten der fonologischen, morphologischen und syntaktischen
Ebenen. Andererseits ist der Text keine einfache Summe der Einheiten.
Sobald sie in einem Text zusammengefasst sind, beginnen sie mitzuwir-
ken und schaffen ein Ganzes, das wir „Text“ nennen.
Wenn wir diese Einheiten in ihrer Hierarchie anordnen, so bekom-
men wir die Reihe: Fonem — Morphem — Wort — Wortfügung — Satz.
Ein findiger Autor kann mit jeder dieser Einheiten ein wahres Wunder
tun, das uns den Text genießen lässt und ihn als ein wahres Kunstwerk
einzuschätzen erlaubt. Versuchen wir nun dieses Spiel mit den Bestand-
teilen des Textes an einigen Beispielen zu verfolgen.
§ 47. Das Fonem
Das Spiel mit dem Laut ist ein weit verbreiteter Griff im künstleri-
schen Text, der auf die mündliche Wahrnehmung gerichtet ist. Tonfülle
und Wohlkiang werden in erster Linie in der Poesie angestrebt und
messen den Worten eine besondere Bedeutung in der Semantik des Wer-
kes bei. Denken wir an das schöne Gedicht „Verfall“ von Georg Trakl.
Hier die erste Strophe:
Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten,
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen,
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen,
Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.
Die Hauptkombination der Konsonanten ist schon im Titel gegeben:
Sie wiederholt sich mehrmals in verschiedenen Positionen (Ver-
fall — Glocken—Frieden — läuten —folg— Vogel—... — vollen — Flügen)-
Diese mehrmalige Wiederholung der Konsonanten, anders gesagt, die
Alliteration, hebt die inhaltsschweren Wörter hervor und macht sie ZU
Stützpunkten beim Interpretieren des Gedichtes. Außerdem kann die
Alliteration auch eine andere Aufgabe erfüllen, zum Beispiel Assoziatio-
206
nen hervorrufen. So erinnert uns das oben angeführte Gedicht von
G.Trakl an das bekannte Rätsel mit Wiederholung derselben Konso-
nanten und fast derselben Wörter:
Flog Vogel federlos auf Baum blattlos.
Kam Frau fußlos, fing ihn handlos,
briet ihn feuerlos, fraß ihn mundlos.
(Der Schnee und die Sonne)
Der zu ratende Gegenstand oder Vorgang wird in verwirrender, teils
plausibler, teils paradoxer Wfeise poetisch-formelhaft umschrieben, ver-
hüllt, verdunkelt. Manche Rätsel beschreiben den zu ratenden Gegen-
stand durch lautmalende Wörter:
Vier Räddeditänz,
Vier g’hörige Schwänz,
Es Hobbermaendeli
Und es Nohwaendeli.
Mit diesem Typ, der „Vo 11 r ä t s e 1“ genannt wird, korrespondieren be-
stimmte formale Eigenschaften: die Bevorzugung der Spruchform mit
Päarreimen, die überwiegende Zwei- oder Vierzeiligkeit u.a. [vgl. Bentzien,
Burde-Schneidewind, 1987, 243—245]. Diese Charakteristiken tragen
dazu bei, dass das Rätsel als mündliche Überlieferung leicht behalten wird.
Nach denselben Prinzipien werden auch manche Kinderge-
dichte gebaut: sie lassen die Kleinkinder „schwere“ Laute einüben
und richtig aussprechen und bleiben im Gedächtnis gut haften:
Ri, ra, risch,
Im Winter ist es frisch,
Im Sommer schlägt die Nachtigall,
Da singen die kleinen Vöglein all!
Da die Stilistik verschiedene funktionale Stile, Genres und Textsor-
ten untersucht, darf sie auch nicht die äußersten Fälle und Formen des
Ganztextes außer Acht lassen. Ein solches Genre, das sich vollkommen
an der Lautwiederholung orientiert und darauf basiert, ist der Zun-
genbrecher: „Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer
Postkutschkasten. “
Wir suchen keinen tiefen Sinn in diesen aufeinander folgenden Wör-
tern. Sie sind nur ein Behelf in der Arbeit an der Aussprache. Die prag-
matische Seite dieser Ein-Satz-Texte sieht eine „mechanische“ Wieder-
holung vor, so dass die semantischen und syntaktischen Strukturen sich
mit dem Einfachsten begnügen.
In der Linguistik gilt die These als unumstritten, dass das Fonem
keine Bedeutung hat. In der Wblt der Kunst herrschen aber andere
Vorstellungen. So sieht eine schöpferische Natur auch in jedem Laut einen
tiefen Sinn und misst jedem Element eine Bedeutung bei. Wfenden wir uns
an ein gut bekanntes Beispiel. Im Jahre 1871 hat der damals noch nicht so
207
weit bekannte siebzehnjährige französische Dichter Arthur Rimbaud
[re'bo:] ein kleines Sonett geschrieben mit dem Titel „Voyelles“ („Voka-
le“), in dem er jedem Vokal eine Farbe beigemessen hat (das A ist schwarz,
das O — blau, das I— rot usw). Das war ein Gedicht, das dem Charakter
des Symbolismus vollkommen entsprach, und zwar seinem Hang zu den so
genannten „Entsprechunge n“. Die Symbolisten verglichen gern mit-
einander, was der Mensch mit seinen fünf Sinnen wahmimmt: die Farben
mit Lauten, die Düfte mit Farben usw. Das finden wir auch bei den anderen
Dichtern, die zu verschiedenen Kulturen gehörten: bei Ch. Baudelaire
[boda'tee], E.T.A. Hoffmann, A.Blok. Dabei spricht Rimbaud über die
Vokale, die in den meisten Sprachen zu finden sind.
Nachdem der russische Gelehrte J. S.Stepanov dieses Sonett in-
terpretiert hatte, entdeckte er darin ein ganzes philosophisches System,
eine Lehre vom Sein: die Welt besteht aus Licht und Dunkelheit, die
einander durchdringen [s. CrenaHOB, 1984].
Aber auch in einem prosaischen Werk, hauptsächlich in der lyri-
schen Prosa,dte von den Gefühlen und Empfindungen des Autors voll
ist, kann das Spiel mit den Lauten vorkommen. So schafft E. Strittmatter
durch die Wiederholung einiger Konsonanten und Vokale einen Rhyth-
mus, der diesen prosaischen Text einem Gedicht ähnlich macht:
Wintererwarten
Die Äpfel glänzen wie Messing, und das Jahr zwinkert schon müde. Das Gras
horcht in sich hinein, und das blühende Heidekraut ist wie eine große Abendröte.
Laß uns unter den Birken entlanggehn, wenn die Luft nach Pilzen und
Nüssen duftet, wenn der Nebel wie Pulver von Sternenmeeren sich auf die
bräunenden Baumblätter legt, wenn die Reiher ziehn, wenn die Wildgans nach
Süd stößt, wenn das Schilf vom Schrei des Kranichs erzittert — laß uns den
Winter erwarten und ihn wie die Bäume benutzen — unter den Rinden.
Die Wiederholung der Laute beginnt schon im Titel — „Winterer-
warten“ (-er-er-ar-en), wird in der Mitte aufgegriffen — „Laß uns unter
den Birken entlanggehn“ (er-en-ir-en-en-eri) und klingt besonders be-
deutsam im Schluss — „... laß uns den Winter erwarten... unter den Rin-
den“ (en-er-er-ar-en-er-en-in-en).
Eine hohe Konzentration der Lautwiederholung in dem Text, der
nur aus einigen Zeilen besteht, schafft ein prägnantes Bild, das zu der
Hauptmelodie des Textes wird, zu seinem Leitmotiv.
Vom Standpunkt der Textlinguistik aus spielt die Wiederholung eines
Lautes auch die Rolle eines Bindemittels: sie verbindet die Sätze miteinan-
der, die nicht nur nebeneinander im Text stehen, sondern auch diejenigen,
die voneinander durch andere Sätze getrennt sind. Die wiederholten Laute
treten in diesem Fall als Mittel der Distanzveibindung und damit auch als
Mittel der Kohärenz auf. Sie spielen also eine textgestaltende Rolle.
Wenn wir bei der Analyse der Lautform eines Wortes die künstleri-
schen Bilder, Vorstellungen und Empfindungen der Dichter berücksich-
tigen, so müssen wir einen hohen Grad der Subjektivität ihrer Dichtun-
208
gen mit in Kauf nehmen. Die Linguistik als Wissenschaft hat aber mit
objektiven Tatsachen zu tun, die bewiesen werden können.
In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begann die rasche
Entwicklung einer neuen linguistischen Disziplin — Fonosemantik. Sie
hat als Gegenstand das lautdarstellende (lautnachahmende und
lautsymbolische) System der Sprache [s. Bopohuh, 1990, 5],
Die Fonosemantik hat ihre Wurzeln bereits in der Antike. Im
19- Jahrhundert beschäftigte die Idee über die Symbolik der Laute viele
Gelehrte, darunter M.W. Lomonossow, W. von Humboldt,
A. Schleicher, J.Grimm, A. Potebnja und O.Jespersen.
In der traditionellen Linguistik gilt die Lauthülle des Wortes als will-
kürlich und unmotiviert. Die fonetische Form ist also inhaltsleer.
Die Anhänger der neuen Richtung vertreten den Standpunkt, dass
die Wörter eine motivierte Lautform haben, die über eine sym-
bolische Bedeutung verfugt. Die symbolische Bedeutung soll
die begriffliche, lexikalische Bedeutung des Wortes unterstützen und be-
tonen. Die Entstehung einer engen Verbindung zwischen Laut und Be-
deutung erklären sie auf folgende Wfeise: Der Urmensch hörte das Rol-
len des Donners, das Heulen des Gewitters, das Getöse des Vulkans, das
Zischen der Schlange und setzte die gefährlichen Erscheinungen mit be-
stimmten Geräuschen in Verbindung. Er hatte für sie unter den Lauten
der menschlichen Sprache Entsprechungen gefunden. So bekamen die
tiefen, zischenden und rollenden Laute eine negative Schattierung in
den Vorstellungen des Urmenschen. Hohe, helle, melodische Töne wie
das Singen der Vögel, das Rieseln der Bäche waren dagegen mit gefahr-
losen Erscheinungen verbunden. So bekamen auch hohe, helle Laute
der Sprache eine positive Einschätzung. Einmal entstanden, blieben sie
im Bewusstsein des Menschen verankert und wurden später auch auf die
anderen Laute übertragen [vgl. JKypaBjieB, 1974, 5/J.
In der Fonosemantik unterscheidet man neben der lexikalischen und
der grammatischen auch die fonetische Bedeutung (ebenda).
Das sei ein neuer Aspekt in der Semantik des Sprachzeichens, der einige
Probleme lösen ließe, wie z. B. das Problem des Inhalts und der Form,
das Problem der Entstehung der Sprache, der Entwicklung und des
Funktionierens der Wörter u. a.
§ 48. Das Morphem
Sowohl in der Poesie als auch in der Prosa kann man die Wir-
kung eines Morphems (Präfix, Suffix, Wurzel, Endung) auf das Schaffen
eines ausdrucksvollen Bildes verfolgen. So beschreibt R. M. Rilke im
Gedicht „Einsamkeit“ die Stimmung und die Gefühle eines einsamen
Menschen. Das ist ein Gemütszustand, der dem Autor gut bekannt ist.
Im Text finden wir zwei Lexeme mit dem Präfix ent- und ein Lexem mit
dem korrespondierenden entgegen-'.
209
Einsamkeit
Die Einsamkeit ist wie ein Regen.
Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen;
Vbn Ebenen, die fern sind und entlegen,
geht sie zum Himmel, der sie immer hat.
Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt.
Regnet hiernieder in den Zwitterstunden,
wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen
und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,
enttäuscht und traurig von einander lassen;
und wenn die Menschen, die einander hassen,
in einem Bett zusammen schlafen müssen:
dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen...
Das Präfix ent- bringt in die Semantik des Wertes die Bedeutung der
Entbehrung, des Fehlens hinein. Es stimmt mit dem psychischen Zu-
stand des lyrischen Helden überein, der an Einsamkeit leidet. Dieses
Morphem funktioniert in dem Text auch als ein Mittel der Satzver-
f 1 e c h t u n g: es wirkt kataphorisch und verbindet einzelne distanzierte
Zeilen inhaltlich miteinander. Es ist eine Art Leitmotiv. Das Präfix ent-
wird thematisch durch die Wörter unterstützt, die zum Thema „Einsam-
keit“ gehören: Regen, nichts gefunden, traurig, einander lassen, hassen.
So gut wie mit dem Präfix, kann man auch mit dem Suffix spielen. In
dem oben angeführten Rätsel („Flog Vogel...“) wird das Suffix -los ver-
schiedenen Wurzeln hinzugefügt. Die mehrmalige Wiederholung der
Lexeme mit demselben Suffix (federlos, blattlos, fußlos, handlos, feuerlos,
mundlos) klingt wie ein Zauberspruch; es wirbelt und kreiselt, es entsteht
der Eindruck des Geheimnisvollen und des Magischen. Eine andere
Leistung des Suffixes -los besteht darin, dass es die Zeilen reimen lässt.
Es entsteht eine feste Verbindung zwischen den einzelnen Teilen des
Satzes und zwischen den Sätzen, die den Text bilden. Die textlinguisti-
sche Funktion dieses Suffixes ist deutlich zu erkennen: es trägt zur I n-
tegration der Sätze bei. Dabei versteht man unter Integration
nicht nur die Unterordnung der einzelnen Textteile unter das Hyperthe-
ma, den Hauptgedanken, sondern auch die Wechselwirkung zwischen
den einzelnen Teilen des Textes. Die Integration ist mit der Hervorhe-
bung eines Hauptwortes oder seines Teils (in unserem Fall — des Sems
„Verneinung“) verbunden, um das herum der ganze Text gebaut ist.
Einige Schriftsteller erfinden neue Wörter und konstruieren sie
nach den in der Sprache existierenden Modellen. Sie stützen sich auf die
Eigenschaft der Morpheme, über eine Bedeutung zu verfügen. Das Prä-
fix Mit- bringt in die Semantik des Substantivs die Bedeutung des Zu-
sammenseins, einer gemeinsamen Beschäftigung: die Substantive „Mit-
bürger“, „Mitschüler“ enthalten diese Seme und haben sich im deut-
schen WDrtschatz verankert. Deshalb ist „die Neuerfindung“ von E.
Strittmatter, die er in den Text seines Romans „Ole Bienkopp“ einführt,
210
für jeden Leser verständlich, obwohl man dieses Substantiv in keinem
Nachschlagewerk finden kann:
Bienkopp liegt im Krankenhaus. Sein Bein ist heil... aber jetzt ist seine
Lunge krank... Bienkopps Schreie erschrecken die Mitkranken.
Das neu erfundene Substantiv verleiht der heiklen Situation Humor
und erspart dem Autor eine lange und ausführliche Beschreibung der
Personen, die diese Situation miterleben müssen. Weitere Beispiele aus
diesem Roman werden unten behandelt.
Das Verbalpräfix hinauf- hat die Bedeutung der Bewegung nach oben
und das Präfix hinunter- bezeichnet die entgegengesetzte Richtung —
nach unten. So entstehen neue Verben, die den Wortschatz der deut-
schen Sprache bereichern und der Sprachökonomie dienen:
Die Freunde phantasieren sich zu den Sternen hinauf oder die Sterne zu
sich herunter.
Einen komischen Effekt erreicht der Autor, wenn er mit dem gut be-
kannten Verb „husten“ experimentiert. Der Hauptheld des Romans will
einer unerwünschten Bekanntschaft mit Frau Senf entgehen. Er findet
keinen besseren Ausweg, als dass er zu husten beginnt:
Bienkopp verschluckt sich, hustet und hustet. Bullert klopft ihm besorgt
den Rücken. Der Husten hört trotzdem nicht auf. Bienkopp hustet sich langsam
zum Hause hinaus.
Ein eindrucksvolles Bild entsteht vor den Augen des Lesers, wenn er
die Beschreibung der folgenden Szene mit dem nicht existierenden Verb
liest:
Das glücklichste Paar sind Bienkopp und Märtke. Sie tanzen schon ihren
zehnten Tanz. Sie sagen einander kein Wort. Was gibt’s auch zu reden? Märtke
hat Ole gewählt. Sie zertanzen die Zweifel.
Darin besteht das Streben des Autors, „eine unverbrauchte Sprache“
zu sprechen [s. Hillich, 1977,104].
Nicht weniger ausdrucksvoll sind auch die Suffixe. Das Suffix -in, ei-
nem Substantiv hinzugefugt, bezeichnet eine weibliche Person. So ent-
steht ein neues Wart, dessen Bedeutung jedem klar ist:
Hast also wieder mal wie Gottvater
aus der Rippe des Mannes
eine Männin geschaffen?
(O. Leist)
Selbstverständlich kommt dem Wurzelmorphem als Träger der lexika-
lischen Bedeutung ein zentraler Platz unter den stilistisch bedeutsa-
men Wartbildungsmitteln zu. Das Spiel mit der Wurzel hebt die Bedeu-
tung der gleichlautenden Lexeme hervor, kann aber manchmal den Le-
ser bei der Dekodierung des Inhalts absichtlich auf den Holzweg brin-
gen, wie z. B. im Gedicht von O. Leist:
211
Menschensache
Indessen man die Weiber weibisch
Und die Damen dämlich schilt
(was von damisch kommt),
lobt man die Herren als herrlich
und die Männer als mannhaft.
§ 49. Das Wort. Das Substantiv.
Ausdrucksmittel des Nominalstils
Das Wort ist die nächste Stufe in der Hierarchie der sprachlichen
Einheiten. Bekanntermaßen spielen die Wortarten nicht die gleichen
Rollen unter stilistischem Aspekt der Texte. Je nach Wörtart, die in der
Textstruktur vorherrscht, unterscheidet man zwischen dem Nominalstil
und dem Verbalstil. In diesem Abschnitt behandeln wir Besonderheiten
und Ausdrucksmittel des Nominalstils und verfolgen den stilistischen
Wert jeder Wortart, die diesen Stil prägt.
Wir beginnen unsere Abhandlung mit dem Substantiv, obwohl es
in der grammatischen Struktur des deutschen Satzes bei weitem nicht
die Hauptrolle spielt. Aber die Substantive sind zahlenmäßig die
reichste Wortart, der 50 bis 60 % des Gesamtwortschatzes zuzurech-
nen sind [vgl. Erben, 1972, 96]. Die Substantive nennen die Namen
der Dinge, Wesen und Gegenstände [s. Glinz, 1965, 30]. Die No-
men, zu denen außer dem Substantiv das Pronomen, das Ad-
jektiv und das Adverb gehören, schaffen den so genannten No-
minalstil. Wenn beim Verbalstil die Verben den Mitteilungsgehalt
maßgeblich bestimmen, so dominiert beim Nominalstil „der Aussa-
gewert der Nomina“ [vgl. Faulseit, Kühn, 1975, 136—137], Der
Text, der im Nominalstil geschaffen ist, wirkt sachlich, informierend,
exakt. Der Nominalstil ist sowohl in den Texten der schöngeisti-
gen Literatur als auch in anderen Funktionalstilen zu treffen. In
Christa Wolfs „Medaillons“ finden wir:
Szenenwechsel. Zweite Einstellung. Kamera am Fuß der Treppe zum Haus
von Ich. Schwenk zum Lastwagen auf der Straße: Die Koffer und Säcke, die
eben gepackt wurden, werden eingeladen, dann die Personen, die es schon im
Schlafzimmer gab, geschoben, gehoben: auch Ich. Streitende Stimmen, Kla-
gen, Schluchzen. Fragen, Antworten. Tränen, Winken. Das Auto fährt an, ein
paar Nachbarn bleiben zurück.
Dieser Text gleicht einem Drehbuch, das eben sachlich und exakt
sein soll, um in einem relativ engen Raum möglichst viel Information zu
geben. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird auf die Gegenstände (Ka-
mera, Treppe, Haus, Koffer, Säcke) und auf die vergegenständlichten
Prozesse (Klagen, Schluchzen, Winken) gerichtet. Diese Technik gleicht
der Technik des Malens: einzelne Substantive wirken wie Pinselstriche:
212
jeder von ihnen hat seinen Wert, aber nur alle zusammengenommen er-
geben ein einheitliches Bild.
Eine ganz andere Wirkung auf den Leser können wir in der bekann-
ten Erzählung W Borcherts „Hamburg“ feststellen. Stilistisch gesehen
ist der ganze Text im Nominalstil geschaffen: die Anhäufung von Sub-
stantiven sollte die Stimme des Autors sachlich und trocken klingen las-
sen. Ganz im Gegenteil ist der Text von solch einem innigen Liebesge-
fühl, einem tief empfundenen Dank der Heimatstadt gegenüber durch-
drungen, dass diese Empfindung auch den Leser mitreißt:
Hamburg!
Das ist mehr als ein Haufen Steine, Dächer, Fenster, Tapeten, Betten,
Straßen, Brücken und Laternen. Das ist mehr als Fabrikschornsteine und Au-
togehupe — mehr als Möwengelächter, Straßenbahnschrei und das Donnern
der Eisenbahnen — das ist mehr als Schiffssirenen, kreischende Kräne, Flüche
und Tanzmusik — oh, das ist unendlich viel mehr.
Der erste Absatz lässt den Leser sich ganz klar vorstellen, wie emo-
tionell und gefühlsbetont der Autor über seine Lieblingsstadt spricht.
Die Tatsache selbst, dass das Substantiv „Hamburg“ mehrmals als ein
Substantivsatz mit dem Ausrufezeichen erscheint, zeugt von einer hel-
len emotionalen N o t e, die die Atmosphäre der Erzählung be-
stimmt. Die mehrmals wiederholten Ein-Wort-Sätze werden durch eine
Reihe von weiteren Ausrufesätzen sowie durch die Wiederholung einzel-
ner Lexeme, Wortgruppen und Satzmodelle unterstützt:
Das geben wir zu, ohne uns zu schämen: Dass uns die Seewinde und die
Stromnebel betört und behext haben, zu bleiben — hierzubleiben, hier zu bleiben!
...Stadt: Urtier, raufend und schnaufend, Urtier aus Höfen, Glas und Seuf-
zern, Tränen, Parks und Lustschreien — Urtier mit blinkenden Augen im Son-
nenlicht: silbrigen, öligen Fleeten! Urtier mit schimmernden Augen im Mond-
licht: zittrigen, glimmernden Lampen!
...Das ist unser Wille, zu sein: Hamburg!
In den Vordergrund treten aber die Substantive, deren Aufzählung
dem Text eine bestimmte Dynamik, Rhythmus und Ergriffenheit in ei-
ner gedrängten Form beimessen.
Diese gedrängte Wiedergabeform, die Komprimierung der Aussage
kennzeichnen auch Texte des Zeitungsstils mit seinem Streben
nach Verdichtung und maximaler Informativität:
Abstimmung zur Trennung von Amt und Mandat
Berlin, 21. April (dpa.). An diesem Dienstag beginnt Bündnis 90/Die Grü-
nen mit einer Urabstimmung über die Trennung von Amt und Mandat. Die
etwa 44000 Parteimitglieder sollen darüber entscheiden, ob zwei der sechs
Mitglieder des Grünen-Bundesvorstandes künftig gleichzeitig auch Abgeord-
nete des Bundestages oder eines Landtages sein dürfen. Das Ergebnis der Ab-
stimmung über die seit der Parteigründung 1980 geltende Unvereinbarkeit von
Parteiamt und Parlamentsmandat soll am 23. Mai vorliegen.
213
Diese Ausdrucksweise finden wir auch in der modernen Prosa
besonders in der Kurzprosa, die heutzutage einen bedeutenden
Platz unter den anderen Genres der künstlerischen Literatur gewinnt.
Der niederländische Sprachwissenschaftler Jan van Dam behaup-
tet: „Ich bin der Überzeugung, daß nicht an erster Stelle die großen
Schriftsteller, sondern die Presse neben dem Rundfunk in immer
größerem Maße die Sprache des Volkes beeinflußt, ja in gewissem Sin-
ne macht“ [zit. nach: Weinrich, 1985, 20]. H. Weinrich, der deut-
sche Linguist, fügt hinzu: „Es stellt sich die Frage: ob Presse, Hörfunk
und Fernsehen für unsere Epoche entweder neben der Literatur oder
an ihrer Stelle die Rolle einer normgebenden, mindestens aber norm-
verstärkenden Instanz für die deutsche Sprachkultur spielen könnten“
(ebenda).
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Sprache der
Massenmedien eine immer größere Rolle in unserer Sprachkultur
spielt, werden wir uns auch diese Tendenz — das Streben nach Kürze,
Exaktheit und Nominalisierung — merken und in unserer
Sprache nach denselben Qualitäten trachten.
Obwohl die Phänomene, die man verbal ausdrücken könnte, im heu-
tigen Deutsch vorzugsweise nominal ausgedrückt werden, wird in vielen
Stilistikbüchem nachdrücklich betont, dass verbale Ausdrücke als kraft-
voller und besser verständlich gelten [vgl. Weinrich, 1985, 350].
Die Stilforscher warnen vor den Gefahren, die eine unüberlegte No-
minalisierung verursachen kann. Zu zählen sind:
— Verschachtelung durch Substantivierungen bei aufzählender Aus-
sage — ...die Übereinstimmung über die Notwendigkeit, Bemühungen um
die Abrüstung mit neuen Bemühungen um die Beseitigung der Ursachen der
Spannung zu verbinden...;
— Überdehnung des prädikativen Rahmens — Der Unterricht wird
auch in diesem Fach auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse mit Zielrichtung auf die Entwicklung selbständigen, logischen
Denkens der Schüler und verantwortungsbewußten Herangehens an die
Aufgabenstellung betrieben. (Faulseit, Kühn, 1975);
— übermäßige Attributierung/Genitivkette — Die maßgebliche Auf-
gabe des wissenschaftlichen Gerätebaus und damit die Hauptaufgabe von
Zeiss Jena besteht darin, Geräte und Apparaturen herzustellen, die die Ar-
beitsproduktivität in der naturwissenschafilichen Forschung, aber auch in
der Fertigung erhöhen... (ebenda, 137—138).
Die höchste Leistung des Substantivs besteht in der Fähigkeit, je-
den logischen Begriff, der keine unmittelbare Beziehung zur Sinnen-
welt hat, zu verabsolutisieren, zu verselbstständigen. Es bezeichnet in
diesem Fall „Gegenständlichkeit“ (russ. npedMemnocmb)
[vgl. Riesel, Schendels, 1975, 775]. Den nächsten Vorzug des Substan-
tivs sehen die Linguisten in seiner syntaktischen Biegsam-
keit: das Substantiv kann als Subjekt, Objekt, Adverbiale und Attribut
verwendet werden.
214
Es wird betont, dass der Stil der Wissenschaft besonders
reich an Nomina ist. In den wissenschaftlichen Texten überwiegen Abs-
trakta und Termini:
Die Fragestellung nach den Verfahren zur Konstituierung von Texten ist
von großer Bedeutung für die Textgestaltung und -rezeption. Sie steht im engen
Zusammenhang mit der Betrachtung des Tätigkeitsaspekts der Sprache in der
gegenwärtigen Forschung zur Kommunikation, in welcher der Behandlung der
Kommunikationsverfahren ein zentraler Platz zukommt. (Zeitschrift für Germa-
nistik)
Der Gebrauch treffend gewählter Substantive gewährleistet die
Hauptqualitäten des wissenschaftlichen Textes: Klarheit, Wider-
spruchsfreiheit, Folgerichtigkeit. Sie sind als ästhetische
Wbrte eines wissenschaftlichen Stils anerkannt, obwohl die Frage über
die Ästhetik des wissenschaftlichen Sprachgebrauchs offen bleibt
[s. Weinrich, 1985, 52],
Es ist aber zu betonen, dass man zwischen dem schriftlichen und dem
mündlichen Sprachgebrauch im Bereich der Wissenschaft unterscheiden
soll. Der mündliche Sprachverkehr hat seine eigenen Strukturen und
Gesetze, die bis heute nicht ausreichend erforscht sind.
Der Nominalstil ist auch den Texten des öffentliehen Ver-
kehrs eigen und gestaltet sie logisch-sachlich [s. Riesel, Schendels,
1975, 116]:
EMTEC — neue Marke mit Tradition
Ab dem Jahr 2002 tragen alle Audio-, Video- und Datenmedien-Produkte
der Marke BASF den Namen EMTEC (European Multimedia Technologies). Nur
der Name ändert sich: Die starke Organisation, der vertraute Service und die
anerkannt hohe Qualität der Produkte stehen auch zukünftig für diese Marke.
Vertrauen Sie darauf.
Aber auch in solchen Texten muss man das rechte Maß halten, sonst
entstehen Texte, die nach Meinung von H. We i n r i c h ein Exempel für
„miserables Deutsch“ darstellen, was der folgende Auszug aus einer Pa-
tenschrift veranschaulicht [Weinrich, 1985, 550]:
Anordnung zur Verschlüsselung und Vorrichtung zur Entschlüsselung von
aus einer oder mehreren Reihen von Schriftzeichen bestehenden Lösungen für
Aufgaben bei die Aufgaben und die Lösungen enthaltenden Schriftwerken.
Es sei auch die Rolle der Eigennamen in der Struktur des deutsch-
sprachigen Textes betont. Die Eigennamen üben in Sprichwörtern
die Funktion einer Verallgemeinerung aus. Der Nominative
Charakter des Sprichwortes besteht darin, dass es ein Zeichen ist und ein
Fragment der Wirklichkeit bezeichnet. Dabei benennt das Sprichwort
typische Lebenssituationen und typische Beziehungen zwischen den
Objekten. In den Sprichwörtern verwandelt sich der Eigenname in einen
Gattungsnamen und verliert seinen konkreten Charakter. In den deut-
schen Sprichwörtern sind hauptsächlich die Namen Hans, Kunz, Hinz,
215
Grete, Trine, Peter, Paul gebraucht. In der Bedeutung „ein jeder
Mensch“ erscheinen Hans und Grete [vgl. rarayjiuHa, 2000],
Eine besondere Rolle kommt den Eigennamen in belletristi-
schen Texten zu. Sie können Assoziationen mit anderen Gestalten
oder historischen Personen hervorrufen, zusätzliche Information über
den Charakter des dargestellten Menschen enthalten. Besonders deut-
lich sind in dieser Hinsicht die „s p r e c h e n d e n“ Namen.
So begegnen wir in E. Strittmatters Roman „Ole Bienkopp“ dem
Friseur Schaber (von „Schaber“), dem Zahnarzt Zitter (von „zittern“),
dem Schmied Eisenhauer (von „Eisen“ und „hauen“). Die Bürgermeis-
terin trägt den Namen „Simson“. Der zeitgenössische Leser assoziiert
ihn mit dem Motorrad „Simson Suhl“, mit dem die Bürgermeisterin
Frieda Simson fahrt und rücksichtslos und unbarmherzig wie das Mo-
torrad die Menschen zerquetscht.
Ein großes Problem entsteht bei der Übersetzung künstlerischer Wer-
ke, die sprechende Namen enthalten. Sie erfüllen im Text eine stilisti-
sche Aufgabe, indem sie den Text ausdrucksvoll gestalten und die Person
deutlich charakterisieren. Bei der Übersetzung des Werkes gelingt es bei
weitem nicht immer, eine passende Entsprechung in der Zielsprache zu
finden.
Vom Standpunkt des Antropozentrismus aus, der für das heutige Wis-
senschaftsparadigma mit seinem lebhaften Interesse für den Menschen
typisch ist, muss noch eine Gruppe der Substantive hervorgehoben wer-
den, die inoffizielle Namen von Personen darstellen. Sie haben
ihre Besonderheiten im Bereich der Kommunikation, der Onomasiolo-
gie, der Wortbildung, der Semasiologie, der Stilistik: Kurzformen der
Personennamen (Dieti von Dietmar, Gorbi von Gorbatschow); Vollnamen
mit Attributen („der nette Franz“ für den Vorsitzenden der SPD Franz
Müntefering; „der schenkende Erich“ für Erich Honecker); Substanti-
ve, die den Beruf der Person berücksichtigen (Mister Zehn-Prozent für
einen Geschäftsmann, der von jedem Geschäft 10 % bekommt) u.a. Es
können auch „fremde Namen“ sein, die der Literatur oder Mythologie
entnommen wurden (Xanthippe — eine böse Frau; Zerberus — ein gro-
ber Portier oder eine unfreundliche Sekretärin). Sie kennzeichnen be-
stimmte Funktionalstile ( den Stil der Presse und Publizistik, der All-
tagsrede, der schöngeistigen Literatur) und sind in den anderen unzuläs-
sig (im Stil der Wissenschaft und im Stil des öffentlichen Verkehrs).
Vom Standpunkt der Textlinguistik aus spielen die Substantive eine
führende Rolle in der Entstehung der Textisotopie [s. Seite 184], So be-
ginnt das Substantiv „Abstimmung“ im Titel des Zeitungstextes auf Sei-
te 213 die erste Topikkette, die durch den ganzen Text läuft: Abstim-
mung... mit einer Urabstimmung... der Abstimmung. Diese Topikkette
stellt eine einfache wörtliche Wiederholung dar. Der zweite
Teil des Titels — die Wo rtgruppe „Trennung von Amt und Mandat“
wird auch fast ohne Veränderung im Text wiederholt: ...über die Tren-
nung von Amt und Mandat... von Parteiamt und Parlamentsmandat. Die
216
dritte Topikkette wird aus Substantiven und ihren kontextualen
Synonymen gebildet: Die Grünen ... Parteimitglieder... der Mitglie-
der... des Grünen (-Bundesvorstandes). Die vierte Topikkette bilden Subs-
tantive, die zu einer thematischen Gruppe gehören: ...des Bun-
desvorstandes... Abgeordnete des Bundestages... eines Landtages.
Der Hang der deutschen Sprache zu Zusammensetzungen
verursacht oft die Xbrschmelzung von zwei Topikketten. So werden die
Substantive „Verfahren“ und „Kommunikation“ in dem auf Seite 215
angeführten Zitat aus einer linguistischen Zeitschrift in das Komposi-
tum „Kommunikationsverfahren“ gekoppelt, was inhaltlich zwei Sätze
miteinander verbindet und die Isotopie schafft.
Der Bestand der Topikketten eines wissenschaftlichen oder eines
Zeitungstextes unterscheidet sich von den Topikketten eines belletristi-
schen Textes durch die überwiegende Mehrzahl der Substantive. Die
Topikketten eines Kunstwerkes bestehen oft aus verschiedenartigen
Gliedern (Pronomen, Verben, synonymischen Substantiven), die die
Substantive als isotopiebildende Bestandteile ersetzen.
Diese Vielfalt der Ausdrucksmittel ist einem Gebrauchstext nicht ei-
gen, weil er ganz andere pragmatische Ziele verfolgt.
Die Produzenten der Gebrauchstexte sollen bestimmte Forde-
rungen und Regeln der Textanordnung und des sprachlichen Ausdrucks
beachten, z. B. Forderungen nach Klarheit, Eindeutigkeit, Folgerichtig-
keit. Diese Prinzipien sind für die Wirksamkeit von Gebrauchstexten
wichtig. Wenn im belletristischen Text Abweichungen von der Norm,
von einer gewohnten Ausdrucksform seine Originalität und Eigenartig-
keit schaffen, so ist in den Texten des öffentlichen Verkehrs und
in den wissenschaftlichen Beiträgen eine stilistische Gleich-
förmigkeit erforderlich.
Wfenden wir uns den Problemen der interkulturellen Kommunikation
zu, so dürfen wir auch die Kategorie des grammatischen Geschlechts
nicht übersehen.
Das grammatische Geschlecht ist bekanntermaßen eine der wichtigs-
ten morphologischen Kategorien. In der deutschen Sprache ist diese
Kategorie stark und „lebensfähig“. Besonders wichtig ist diese Kategorie
in Texten, die auf Nomen basieren, wie z.B. das Rätsel. In Rätseln
werden Gegenstände und Erscheinungen zum Raten aufgegeben, die
hauptsächlich mit einem Substantiv benannt werden können. Im Text
erscheint der zu erratende Gegenstand oft als Metapher. So werden
in dem auf Seite 207 angeführten Rätsel der Schnee als Vogel und die
Sonne als Frau daigestellt. Das grammatische Geschlecht des aufgege-
benen Substantivs fällt also mit dem grammatischen Geschlecht der
Metapher zusammen. Das ist ein Hinweis für diejenigen, die Deutsch
als Muttersprache und somit auch das deutsche sprachliche Weltbild mit
seinen Konzepten und Vorstellungen beherrschen. Für einen Russisch-
sprechenden, für den Deutsch eine Fremdsprache bleibt, wird das Sub-
stantiv „Frau“ das Erraten bedeutend erschweren, denn in der russi-
217
sehen kulturellen Tradition wird die Sonne nicht so eindeutig mit einer
Frauengestalt assoziiert. Die Sonne ist sächlichen Geschlechts und kann
in der Folklore sowohl als ein Mann (Vater, Bruder) als auch in der Ge-
stalt einer Frau {Mutter, Schwester) erscheinen [vgl. Tun, 1992, 99],
Wenn der Kommunikant die Fremdsprache und das damit verbundene
sprachliche Weltbild nicht einwandfrei beherrscht, so kann ihn die im
Text gebrauchte Metapher irreführen.
Unbestritten ist auch der Anteil der Substantive am Gesamtwort-
schatz des Weltbildes. Besonders reich sind sie in Rätseln vertreten, weil
eben in diesem Genre die zu erratenden Gegenstände und Erscheinun-
gen oft durch Substantive beschrieben werden.
§ 50. Der Artikel
Mit dem Substantiv ist aufs engste der Artikel verbunden. Die Erfor-
schung des Artikels umfasst drei Stadien.
1. Der ursprüngliche Problemkreis um den Artikel betraf sein
Wesen als Begleitwort des Substantivs und die ihm zukommenden
Funktionen, darunter Signalisierung des Substantivs als Wortart und
Angabe der grammatischen Kategorien des Substantivs. Es werden Fra-
gen diskutiert, die aus dem gegenständlich-logischen Gehalt des sub-
stantivischen Begriffs resultieren wie Generalisierung/Individualisie-
rung und die Abhängigkeit des Artikelgebrauchs von unterschiedlichen
Klassen der Substantive. Bis jetzt ist die Frage noch nicht gelöst, ob der
Artikel als eine eigenständige Wortart behandelt werden kann. Für die
Lösung dieser Fragen genügt der Rahmen eines Wortes oder einer Fü-
gung Artikel + Substantiv.
2. Die zweite Etappe in der Artikeltheorie ist mit der Erfor-
schung der kommunikativen Satzperspektive verbunden. In der Bestim-
mung der Thema—Rhema—Gliederung gebührt dem Artikel ein heraus-
ragender Platz. Diese Periode ist durch die Erweiterung des wissen-
schaftlichen Betrachtungsfeldes gekennzeichnet. Die Erschließung ei-
ner neuen Funktion des Artikels verlangt die Einbeziehung des Satzes
und der transphrastischen Einheit in den Forschungskreis.
3. In der dritten Etappe wendet man sich dem Makrotext
(Ganztext) zu. Der Artikel ist mit dem Informationsvermögen des
Ganztextes verbunden: mit der \br- und Nachinformation. Es werden
auch seine anaphorische und kataphorische Funktionen hervorgehoben
[s. Schendels, 1981, 314}.
In den Stilistikbüchern wird die stilgestaltende Rolle des Artikels be-
tont. Der Artikelgebrauch weist in jedem funktionalen Stil seine Beson-
derheiten auf. So erkennt man den Stil der Alltagsrede an den ge-
kürzt e n Artikelformen (’nen, ’ne) und an dem Gebrauch des Artikels
vor den Personennamen. Wird der Artikel in dieser Position in
einem künstlerischen Werk gebraucht, so verleiht es dem Stil
218
eine volkstümliche Note [vgl. Riesel, Schendels, 1975, 119}. In diesem
Fall nähert sich der Artikel dem Demonstrativ- oder Possessivpronomen
und bringt eine familiäre, intime Schattierung in den Text:
Unterwegs begegneten wir verschiedenen Schülern. Sie waren alle schön
angezogen, sogar der Schweine-Sigi. Wie wir am Pfaffenpuhl vorbeikamen,
schmissen wir erst ein paar Steine in den Schlamm. Danach waren wir nicht
mehr so schön angezogen. Der Sigi meinte, das trocknet wieder, aber die Bär-
bel Patzig piepste uns auf dem Schulhof zu, dass wir ganz schöne Ferkel sind.
(Ottokar Domma. „Ottokar Weltverbesserer“).
Die Verwandtschaftsnamen fungieren in der volkstümlichen Rede
artikellos:
Von Tante Sigrid bekam ich zum Geburtstag einen Wellensittich ge-
schenkt... ich nannte ihn Putzi und nahm mir vor, ihn zu zähmen und ihm das
Reden beizubringen. Gleich am nächsten Tag wollte ich beginnen. Mama war
einkaufen gegangen... Leider stieß ich dabei an das große Foto, wo Mama und
Papa Hochzeit drauf haben. (G. Holtz-Baumert. „Alfons Zitterbacke“)
So werden die Substantive aus einer thematischen Klasse (Gattungs-
namen) in eine andere Klasse (Eigennamen) übergefuhrt.
Im Stil der Publizistik spricht man über die Artikellosigkeit in
den Überschriften und in den Schlagzeilen. In diesem Funktionalstil gilt
das als eine Stilnorm, z. B.: „Druck auf Reformgegner“, „Klärung und Er-
mutigung“, „Referendum Polens über EU-Beitritt im Juni“.
Der Stil des öffentlichen Verkehrs neigt zum Weglassen des
Artikels, wenn das Sem „Bestimmtheit“ oder „Unbestimmtheit“ aus
dem Kontext ersichtlich ist und wenn die Aussage möglichst knapp,
sachlich und emotionslos geprägt werden muss [s. Riesel, Schendels,
1975, 119}. So steht z.B. in einem Fragebogen, der ausgefüllt wer-
den soll:
Geschäftsbeziehung mit der Bank'.
Ordentliche Kontoführung...
Neuer Kunde...
In einer Werbung heißt es:
Unsere Stärken liegen klar auf der Hand:
Z direkte Nachbarschaft
J gutsortiertes Warenangebot
J konkurrenzfähige Preise
J ständige Präsenz mit Frischwaren
J wöchentliche Aktionspreise
J sauber gepflegte Fachabteilungen mit Bedienung
In Märchen erscheint das Substantiv zuerst mit dem unbestimm-
ten Artikel und erst dann mit dem bestimmten:
Es war einmal ein Soldat, der hatte dem König lange Jahre treu gedient; als
aber der Krieg zu Ende war und der Soldat, der vielen Wunden wegen, die er
219
empfangen hatte, nicht weiterclienen konnte, sprach der König zu ihm... (BrlG
der Grimm. „Das blaue Licht“)
Der unbestimmte Artikel ist ein effektives Mittel für die Bestimmung
des Wortschatzes, der für das Märchen bedeutungsvoll ist. Dieser Wort-
schatz enthält einige semantische Felder (kosmologisches Feld, zeitli-
ches Feld, Raumfeld), die für den Inhalt des Märchens wichtig sind.
Wenn ein Substantiv mit dem unbestimmten Artikel im Text des Mär-
chens erscheint, so bedeutet es, dass im Sujet eine neue Etappe beginnt.
Er ist auch ein wichtiges Kohärenzmittel, denn er impliziert die Wieder-
holung des Lexems. Außerdem ist der unbestimmte Artikel die Haupt-
charakteristik der Anfangsformel:
Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eif-
rig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. {Brüder Grimm.
„Die sechs Schwäne“)
Der unbestimmte Artikel fuhrt den Haupthelden in den Text ein und
wird oft durch Raum- und Zeitangaben unterstützt [s. Umblhh, 1979,
332—336].
In den Fa beln treten oft Tiere und Gegenstände als handelnde
Personen auf. Sie verkörpern auffallende Eigenschaften der Menschen
und dienen (obwohl auch kulturspezifisch) als ihre Symbole: der Fuchs
ist listig, der Wolf — brutal, der Esel — dumm. Deshalb erscheint ein
Gattungsname schon bei der Ersterwähnung mit dem bestimmten
Artikel:
Der Fuchs sah, daß der Rabe die Altäre der Götter beraubte und von ihren
Opfern mitlebte. {Lessing. „Der Rabe“)
Mit der Hinwendung zum Ganztext werden die Funktionen des Arti-
kels anders bestimmt. So kommt H. Weinrich zu einer Reihe von
Schlussfolgerungen, die folgenderweise formuliert werden könnten:
1. Der bestimmte Artikel erscheint im Text erheblich häufi-
ger als der unbestimmte. Die Zahl der bestimmten Artikel ist also viel
größer als die Zahl der unbestimmten Artikel. Das ist eine Bedingung für
das Existieren eines zusammenhängenden Textes.
Es ist unmöglich und unvorstellbar, die bestimmten und die unbe-
stimmten Artikel im Text zu vertauschen: der Text würde dadurch zer-
stört. Jeder Artikel hat seinen festen Platz und gehört mit zu den Konsti-
tuenten des Textes. In einigen Textpositionen gibt es besonders viele un-
bestimmte Artikel, in den anderen viele bestimmte Artikel. Diese Vertei-
lung ist keinesfalls eine Eigenschaft der Autorensprache. Sie ist mit dem
Informationsaustausch zwischen den handelnden Personen
oder zwischen dem Autor und dem Leser verbunden.
2. Der Artikel lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers oder des Hörers
auf bestimmte Informationszonen. Der bestimmte Artikel erfüllt die
anaphorische Funktion und lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers/Hö-
rers auf die Vo r i n f o r m a t i o n. Der unbestimmte Artikel erfüllt die
220
kataphorische Funktion und lenkt die Aufmerksamkeit auf die N a c h-
information.
3. Der erste unbestimmte Artikel signalisiert den Anfang der
Handlung und der letzte bezeichnet die „P o i n t e“, um deretwillen
die Geschichte überhaupt erzählt wird. Zwischen ihnen stehen andere
unbestimmte Artikel, die wichtige Markierungen des Textes bezeichnen.
Aus diesen wenigen Wörtern könnte man den Text eher rekonstruieren
als aus den vielen Wörtern, die vom bestimmten Artikel begleitet sind.
4. Der bestimmte Artikel erscheint oft im Titel und verleiht ihm die
Bedeutsamkeit, was den pragmatischen Zielen dient: der bestimm-
te Artikel ist ein Verweis auf die Vorinformation, über die der Leser nicht
verfugt. Das weckt sein Interesse und lässt ihn sich an den Text wenden
[s. Weinrich, 1976, 168-169],
E. J. Schendels behandelt den Artikel als ein wirkungsvolles Ge-
staltungsmittel der Polyfonie eines literarischen Werkes. Diese Erschei-
nung kann man nur auf Grund des Gesamttextes erschließen, am
Schnittpunkt der Grammatik, Stilistik und Literaturwissenschaft. Die
Polyfonie wird nach M. M. Bachtin als „Vielfalt von selbständigen
nicht zu verschmelzenden Stimmen und Sehweisen“ im Gegensatz zu
homofonen oder monologischen Literaturwerken betrachten. Dank ei-
niger Sprachmittel gelingt es, den Effekt der gleichzeitigen Mehrstim-
migkeit zu erreichen. Darunter ist die erlebte Rede zu nennen. Die
Stimmen des Autors und der handelnden Personen verflechten sich,
ohne zu verschmelzen. Jede Stimme bleibt hörbar. Wenn die direkte
Rede ein fremdes Wort, die Gedanken, Meinungen, Sichtweise oder
Sprechweise einer anderen Person wiederspiegelt, entsteht Zwei-
stimmigkeit.
Die „Stimme“ ist ein Bestandteil der Erzählperspektive so wie auch
räumliche und zeitliche Angaben. W Ad mo n i bezeichnet die Polyfo-
nie als eine Art Spannung, die in der modernen Literatur dominiert
[s. Admoni, 1975, 11]. Manchen literarischen Genres liegt die Zwei-
stimmigkeit zu Grunde.
An der Gestaltung der polyfonen Struktur beteiligen sich sowohl le-
xikalische als auch grammatische Mittel. Lexikalische Mittel sind deut-
lich, grammatische liegen oft tief verborgen. Unter den grammatischen
Mitteln sind Personenwechsel, Zeitformenwechsel, Moduswechsel,
Frage- und Ausrufesätze, Ellipsen, /Mßw-Sätze u.a. zu nennen. Als ein
besonderes Mittel erscheint der Artikel. Der Wechsel des unbestimmten
und des bestimmten Artikels führt verschiedene Stimmen ein, die
gleichzeitig mit der Stimme des Autors ertönen. Der Artikelwechsel ist
berufen, unterschiedliche Sehweisen desselben Objekts anzugeben, was
den Effekt des gleichzeitigen Tönens von zwei oder mehreren
Stimmen auslöst. Auf diese Weise wird eine größere Tiefe und wechsel-
seitige Beleuchtung des Dargestellten erreicht. Die Leistung des Artikels
wird am Beispiel einer Novelle von Th. Mann veranschaulicht, wo eine
der Hauptfiguren — der Schriftsteller Spinell — auf den ersten Seiten
221
viermal erwähnt wird. Dreimal wird er mit dem unbestimmten Artikel
eingefuhrt und erst zum vierten Mal erscheint der bestimmte Artikel
Über Spinell erzählen einige Stimmen, die verschiedene Sehweisen dar-
stellen. Der Chor der Patienten im Sanatorium bestraft ihn für seine
Ungewöhnlichkeit mit Gleichgültigkeit und nennt ihn „einen Schrift-
steller“. Die Stimme Klöteijahns, dem er unangenehm war, nennt ihn
ebenfalls „einen Schriftsteller“, danach ertönt wieder die Stimme der
Kurgäste: „ein Schriftsteller“ und erst dann erscheint das Substantiv mit
dem bestimmten Artikel „der Schriftsteller“ und kündigt eine neue Li-
nie an [vgl. Schendels, 1981, 315—319].
Der Artikel spielt auch eine wichtige Rolle in der sprachlichen Ge-
staltung des so genannten Textreferenten, d.h. einer Person oder eines
Gegenstandes, auf die das Substantiv bezogen ist (über den Textreferen-
ten siehe Kapitel 16).
§ 51. Das Adjektiv
Außer dem Gebrauch der Substantive versteht man unter dem Nomi-
nalstil auch den Gebrauch der Adjektive. Sie geben objektive und sub-
jektive Merkmale der Gegenstände sowie Einschätzungen und Beurtei-
lungen der Dinge wieder [vgl. Riesel, Schendels, 1975, 113].
Die Adjektive können im Text attributiv oder prädikativ gebraucht
werden.
1. Im attributiven Gebrauch erscheinen sie in den beschreiben-
den Texten, z.B. in Landschafts- oder Porträtsschilde-
rungen, in den Beschreibungen einer Gegend:
Links stand ein kleines, wie plattgedrücktes Haus, wie es sich Arbeiter
nach Feierabend bauen; wankend, fast taumelnd bewegte ich mich darauf
zu. Nachdem ich eine ärmliche und rührende Pforte durchschritten hatte,
die von einem kahlen Heckenrosenstrauch überwachsen war, sah ich die
Nummer, und ich wußte, daß ich am rechten Haus war. (H.Böll. „Die Bot-
schaft“)
Die Adjektive betonen einzelne Eigenschaften oder Besonderheiten
des Gegenstandes, seine Merkmale. Sie schaffen eine möglichst genaue
Vorstellung von dem Gegenstand, den sie charakterisieren. In dem oben
angeführten Beispiel rufen sie das Gefühl der Schwermut und der Lan-
geweile hervor. Man bekommt Mitleid mit den Menschen, die in dieser
Gegend hausen sollen.
In einem anderen Auszug werden die Worte eines Mädchens ange-
bracht, das die Vorgeschichte seiner „Heldentat“ genau und emotionell
beschreibt:
... mein Vater wollte vielleicht einen besonders guten Jungen haben, weil er
von mir denkt: so ein Mädchen ist ein ungezogenes Kind und bringt nur Schan-
de über die Familie, und immerzu muß was bezahlt weiden. Vorgestern mußte
222
nämlich für das pickelige Fräulein Löwenich aus unserer Straße ein neuer
i#eißer Kragen bezahlt werden. Nur weil ich dem Fräulein Löwenich mit einer
ganz alten Füllfederhalterspritze Tinte in den Hals gespritzt hatte. Das mußte
ich aber tun, denn das Fräulein Löwenich kommt immerzu zu meiner Mutter
und sagt zu ihr: „Ach, meine Beste, ich glaube, Sie erziehen das Kind nicht
richtig. Wenn wir den kleinen Wildfang täglich ein paar Stunden lang in ein
dunkles Zimmer sperrten, würde unser Liebling wohl bald ganz bescheiden und
artig.“ Erst sagt sie so was und dann wundert sie sich, dass ich eine Wut auf sie
habe. Kein Kind liebt Menschen, die es stundenlang in ein dunkles Zimmer
sperren wollen. Und verhauen müßte ich werden. Und dann sagt sie: „Na,
komm mal her“ — und will mich mit ihrem eingekniffenen, zerbröckelten Mund
küssen... Unsere Klassenlehrerin sagt immer, man müsse tun, was einem in den
Kräften steht. Und da habe ich von einer Mauer aus Fräulein Löwenich Tinte
in den Hals gespritzt. (LKeun. „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht ver-
kehren durften“)
Das Mädchen ist aufrichtig und ehrlich und will die Situation mög-
lichst genau darstellen, emotionell und anschaulich. Dabei leisten ihr
die Adjektive und attributiv gebrauchte Partizipien (eingekniffen, zer-
bröckelt) eine unentbehrliche Hilfe.
Mehrmals wurde auch eine hohe Frequenz der Adjektive in der
Sprache der Werbung betont. Um eine hohe Qualität der Ware
anzupreisen, führt man in den Text zahlreiche Adjektive ein. Dabei
greift man nicht selten zur Parzellierung, die jede Eigenschaft der
Wäre auffallend macht:
Jacke in topmodischer Platin-Optik. Raffiniert im Stil: der Doppelkragen
mit Westen-Effekt. Edel in den Accessoirs: Zierknöpfe und Reißverschluss
sind goldfarben gehalten. Mit Wind und Wasser abweisender Beschichtung.
(.Quelle“)
Adjektive im attributiven Gebrauch finden auch in den wissen-
schaftlichen Beiträgen ihre Verwendung. Sie helfen das zu be-
schreibende Objekt präzise und genau darzustellen und erlauben eine
sprachökonomische Konzentration der darzulegenden Information:
Wir gehen zunächst von einigen deduktiv-hypothetisch gesetzten Positio-
nen aus, die sich nicht speziell auf das Phänomen künstlerischer Texte bezie-
hen, sondern von allgemeiner kommunikationstheoretischer und textlinguisti-
scher Bedeutung sein dürften. Erst danach stellen wir den Versuch an, diese
Positionen und Ansätze im Rahmen linguistischer — im Hinblick auf das äs-
thetische Wesen künstlerischer Texte somit hilfswissenschaftlicher — Möglich-
keiten auf einen belletristischen Text exemplarisch anzuwenden und empirisch
zu erproben. („ZfG“)
2. Adjektive im prädikativen Gebrauch wirken statisch. Es ist zu
betonen, dass der adjektivische Stil einen Gegensatz zum dynamischen
Verbalstil bildet [s. Riesel, Schendels, 1975, 114\. Verfolgen wir die Wir-
kung der Adjektive, die als Prädikative gebraucht werden, am Beispiel
eines Textes aus der „Chronik des XX. Jahrhunderts“:
223
1904. 3. März. Wilhelm II. bespricht eine sogenannte Edison-Walze und
charakterisiert das Vorbild des deutschen Bürgers. Er sagt: „Hart sein
Schmerz, nicht wünschen, was unerreichbar oder wertlos, zufrieden mit den)
Tag, wie er kommt; in allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an
den Menschen haben, wie sie nun einmal sind; für tausend bittere Stunden sich
mit einer einzigen trösten, welche schön ist, und an Herz und Können immer
sein Bestes geben, wenn es auch keinen Dank erfährt. Wer das lernt und kann
der ist ein Glücklicher, Freier und Stolzer; immer schön wird sein Leben sein’
In diesem Text empfinden wir keine Bewegung und nur die Fest-
stellung, die statisch ist und etwas Gesetzmäßiges verkündet. Wil-
helm II. lenkt die Aufmerksamkeit der Hörer auf bestimmte, für die
deutsche Nation wesentliche Charakterzüge und spricht kurz, sachlich
und deutlich, ohne jegliche emotionale persönliche Einstellung zum
Sachverhalt sichtbar werden zu lassen. Das Emotionale darf hier auch
nicht erscheinen: es handelt sich um Richtlinien für die ganze Nation,
um ein Programm der Erziehung für einige Generationen. Diese ge-
drängte Form gelingt dem Redner unter anderem auch dank der tref-
fend gewählten Adjektive.
Es muss auch die Rolle des Adjektivs in der so genannten adjektivi-
schen Metapher betont werden, die in der Hervorhebung versteckter
Merkmale, in der Übertragung der Eigenschaften von einem Gegen-
stand auf einen anderen besteht [vgl. Riesel, Schendels, 1975, 114]. So
spricht R. M. Rilke über den Tag und fügt diesem Substantiv das Attribut
„plastisch“ hinzu:
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit klarem, metallenem Schlag:
mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann —
und ich fasse den plastischen Tag.
Eine besondere Gruppe der Adjektive bilden die Farbenbezeichnun-
gen. Es ist bekannt, dass ihre Systeme in verschiedenen Sprachen und
Kulturen nicht immer zusammenfallen (vergleichen wir das russische
Wortpaar KpacHbiü—öopdoebiü und das deutsche Adjektiv „rot“). Von
ganz besonderem Interesse für die Linguistik sind Phraseologismen, die
auf Grund von Farbenbezeichnungen entstehen (z. B. das Blaue vom
Himmel versprechen). Durch ihre Analyse kommt eine bestimmte Infor-
mation über das mentale Lexikon einer sozialen Gemeinschaft zum
Ausdruck: die Konzepte, das Spektrum der Einschätzungen, kulturolo-
gische Aspekte sowie auch soziale und symbolische Vorstellungen, die
dieser Gemeinschaft eigen sind, können auf der Basis dieser themati-
schen Gruppe erforscht werden.
Wenn man untersucht, wie die Konzeptualisierung im Bereich der
phraseologischen Einheiten im deutschen Raum vor sich geht, so nennt
man in erster Linie die Metapher und die Metonymie. Ihre Mechanis-
men widerspiegeln die Kenntnisse, die dem Alltagsbewusstsein des
Menschen eigen sind. So finden wir in der deutschen Sprache folgende
224
Farbenbezeichnungen, die als Komponenten von Phraseologismen und
phraseologischen Einheiten auftreten:
weiß: weiße Mäuse sehen (=betrunken sein); Berliner Weiße (=Bier);
schwarz: eine schwarze Seele; das schwarze Schaf; schwarz werden vor
Arger,
grau: graue Stimmung (=trübe Stimmung); graue Vorzeit (=alte Zei-
ten);
gelb: nicht das Gelbe vom Ei sein (=nicht das Beste sein);
blau: blaue Jungs (=Matrosen); blau vor Ärger werden; derblaue Pla-
net (=die Erde);
rot: der rote Hahn (=Feuer); einen roten Kopf bekommen (=rot wer-
den);
grün: grünes Licht; grüne Fische (=nicht gesalzte Fische).
Wie wir sehen, sind einige Phraseologismen international (dt.
das schwarze Schaf; engl. a black sheep; russ. Hepnan oeya), die ande-
ren— nationalspezifisch („der gelbe Flitzer“ — ein Postbeam-
ter, der mit dem gelben Motorrad fährt und Telegramme austrägt). Die
nationale Spezifik drückt sich auch darin aus, dass in der deutschen
Sprache die führenden Positionen die Farbenbezeichnungen „grün“,
„schwarz“ und „blau“, im Englischen aber „black“, „blue“, „green“
belegen — dieselben Adjektive, die aber anders rangiert sind. Außerdem
wird im Deutschen „weiß“ oft als eine positive Einschätzung gebraucht,
„grün“ ist dabei ambivalent, „schwarz“, „grau“ und „gelb“ enthalten
ehereine negative Note [s.JIioKKHa, 2004],
Nach den in der Sprache geltenden Wortbildungsmodellen werden
auch neue Adjektive gebildet, die man zu den Autorenbildungen zählen
kann. So entstehen Adjektive, deren Bedeutung leicht zu verstehen ist
und die den Text humorvoll gestalten. So erfindet E. Strittmatter folgen-
de Neologismen: kleinfingerdicker Stahldraht, weißkäsebleicher Mond,
kümmerniswunde Stelle. Manchmal ironisiert er die übermäßige Vorliebe
für das wortbildende Suffix -mäßig und führt in den Text den Ausdruck
„kuhmäßig brummen“ ein, der eine Parodie auf die heutige Sprachmo-
de darstellt, die oft zu dem Suffix -mäßig greift (gesetzmäßig, planmäßig,
kalendermäßig, geldmäßig, klamottenmäßig).
Die Adjektive können auch die Rolle des Leitmotivs einer
Person spielen. Sie werden zu stehenden Epitheta und begleiten die
Gestalt im Rahmen des ganzen Textes. So erscheint im Roman „Ole
Bienkopp“ von E. Strittmatter die Frau des Försters Stamm als „die
junge Försterfrau“. Aber die Epitheta, die ihre Schönheit wiedergeben,
erinnern den Leser daran, dass diese Frau im Dorf fremd ist: die
schwarzhaarige, blauhaarige, die Bilderbuch-Italienerin. Sie wird von
den Dorfbewohnern „die fremdländischschwarze Frau“ genannt. Die
Försterfrau hört das gern und genießt die Rolle einer romantischen
Natur, obwohl sie sich oft in die Tinte setzt und komisch aussieht.
Dem Sägemüller Julian Ramsch, der hinter der vorgetäuschten Höf-
lichkeit seine wahren Gedanken zu verstecken sucht, werden die Epi-
8 EoraTtipena
225
theta „liebenswürdig“, „kulant“ zugeteilt, die durch die Wörter „dan-
ken“ und „der Dank“ unterstützt werden: Er grüßt und dankt, Der Sä-
gemüller schüttelt einen Sack voll Dank und guter Worte auf Anngret aus.
Der Autor ironisiert ihn: Kulant, kulant — bis in das Grab. Das unsym-
pathische Ehepaar Serno begleiten die Antonyme „dick—dürr“. Der
reiche Serno erscheint im Text mit dem ständigen Epitheton „dick“ —
„der dicke Serno“. Im Gegensatz zu ihm ist seine Frau als „die dürre
Bäuerin“, „die dürre Frau Serno“ im Dorf bekannt. Das schafft in vie-
len Episoden einen komischen Effekt.
Einige Epitheta werden im Laufe des Erzählens durch andere ersetzt,
was die Veränderungen im Leben der Personen widerspiegelt. So lernt
der Leser auf den ersten Seiten des Romans Anngret kennen, die „stol-
ze, wilde Fischertochter“. Am Ende des Buches, als Anngret ihre Stütze
im Leben verloren hat, ist sie schon „eine Fremde“, „eine ausgerissene
Rose im See“. Obwohl sie äußerlich immer noch dieselbe schöne Frau
ist, geschminkt, gekremt und selbstsicher, stecken dahinter Heimweh,
Verzweiflung, Niederlage: „Sie geht durch das Dorf, als zöge sie ihre
Wurzeln hinter sich her“.
Die Steigerungsstufen sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal
der Adjektive und Adverbien. Für die Stilistik sind aber nicht die regel-
mäßigen Formen von Belang, sondern diejenigen, die entweder einen
Autorenstil kennzeichnen oder von den allgemein gültigen Regeln ab-
weichen.
Einige Adjektive, die von den Lokaladverbien abgeleitet sind, haben
nur zwei Steigerungsformen — den Komparativ, der als Positiv empfun-
den wird, und den Superlativ [vgl. Schendels, 1988, 205]:
der äußere ( von „außen“) — der äußerste
der innere (von „innen“) — der innerste
der hintere (von „hinten“) — der hinterste
der obere (von „oben“) — der oberste
der untere (von „unten“) — der unterste
Es gibt Superlative, die ganz ohne Vergleich auskommen. Sie be-
zeichnen nicht den höchsten, sondern nur einen hohen Grad
[s. Schneider, 1963, 73]: in bester Stimmung, in der nächsten Zeit.
Der Superlativ, der ohne Vergleich gebraucht wird, heißt der Elativ.
In diesem Fall spricht man über seinen „absoluten“ Gebrauch.
Absolut kann auch der Komparativ gebraucht werden. Er bezeichnet
einen schwächeren oder stärkeren Grad als der entsprechende
Positiv [vgl. Schendels, 1988, 206]:
Eine längere Zeit ist nicht so lang wie eine lange Zeit.
Eine ältere Frau ist nicht so alt wie eine alte Frau.
Eine jüngere Frau ist nicht so jung wie eine junge Frau.
Einige Verbindungen werden zu Termini: die höhere Mathematik.
Es ist bekannt, dass die relativen Adjektive im Unterschied zu den
qualitativen nicht gesteigert werden. Aber diese Regel wird oft nicht be-
226
achtet, so dass wir in einigen Texten, hauptsächlich in den poeti-
schen, folgende Beispiele der Steigerung finden:
...steinerner und stiller sind die lichten
Gestalten an dem Eingang der Alleen.
(R.M. Rilke)
Auf solche Weise können auch Adverbien gesteigert werden, die sonst
auch selbst zur Steigerung dienen. So finden wir statt „noch mehr“ die
eigenartige Form:
Ich werde trinken noch und nöcher.
(R.M. Rilke)
Das ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Solches Experimentie-
ren mit den Formen finden wir auch bei den deutschen Klassikern:
Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. (Z W. Goethe)
Sowohl Positive als auch Komparative und Superlative können
durch Adverbien verstärkt werden: viel besser, äußerst interessant,
allerschönste.
Die Eigenschaften können durch die Verdoppelung gestei-
gert werden:
Wie wohl mir wird.
Alles Leid sinkt, sinkt.
Mine und Stine lehnen sich
An meine Schultern.
Ich ziehe sie dichter und dichter.
(D. von Liliencron)
Zu der Verdoppelung der Eigenschaft kann auch die Wo r t h ä u-
f u n g beitragen, auch wenn es bei weitem keine Adjektive und Ad-
verbien sind: „Die Welt — das Rätsel der Rätsel“ (D. von Liliencron).
Aus der Sicht der Textlinguistik ist das Adjektiv/das Adverb ein Teil
der referentiellen Struktur des Textes: es bestimmt und präzisiert den
Textieferenten.
So erscheint im Auszug aus dem Buch von I. Keun (S. 222—223) ei-
ner der Textreferenten — das Mädchen — mit folgenden Attributen: un-
erzogen, klein, bescheiden, artig.
Der zweite Referent — Fräulein Löwenich — bekommt folgende At-
tribute: pickelig, eingekniffen, zerbröckelt.
Diese Adjektive schaffen ein anschauliches Bild und einen Charakter.
Sie sind bewertend, urteilend und stimmen den Leser ungünstig Fräu-
lein Löwenich gegenüber. Auch wenn wir die Attribute des ersten Refe-
renten (das Mädchen) und Adverbialbestimmungen in Betracht ziehen,
so wissen wir aus dem Kontext, dass auch sie gegen Fräulein Löwenich
gezielt sind, denn sie geben ihre negative Meinung über das Mädchen
wieder, mit dem der Leser ohne Zweifel sympathisiert. In den Augen
227
Fräulein Löwenichs ist das Mädchen unerzogen und kann erst nach ei-
ner strengen Strafe bescheiden und artig werden.
Der ganze Text ist auf der Gegenüberstellung von zwei Referenten
„ich — Fräulein Löwenich“ und Eigenschaften „ehrlich — falsch“ ge-
baut.
Die Adjektive spielen also eine besondere Rolle in der Gestaltung des
Referenten. Sie spiegeln deutlich und explizit das Verhalten des Autors
zum Referenten wider. Unter kognitivem Aspekt besteht ihre Aufgabe
darin, dem Leser bei der Bestimmung der Einschätzung zu helfen.
Stilistisch markiert oder neutral, bringen sie dem Leser die erste und in
der Regel die wichtigste Information über die Position des Autors, über
seine Sichtweise.
Vom Standpunkt der kognitiven Linguistik aus könnte das Adjektiv
auch anders behandelt werden. Spricht man über das Weltbild eines So-
ziums und über das sprachliche Weltbild als Widerspiegelung der Vorstel-
lungen des Soziums über die Welt in der Sprache, so nennt man einige
Konzepte und Eigenschaften, die diesem Weltbild eigen sind. Die Ei-
genschaften, die oft durch das Adjektiv ausgedrückt werden, können
ständig und stereotyp oder variabel sein. So assoziiert man
die Pflaume mit den Eigenschaften „blau“, „gelb“ und dem Substantiv
„Stein“ („Kern“). Diese Eigenschaften bleiben im Bewusstsein der
Menschen ständig mit dem Denotat „Pflaume“ verbunden. Das Deno-
tat „Pflaume“ lässt sich durch diese Eigenschaften (Adjektive) identifi-
zieren.
Auf diesem Prinzip ist das Rätsel gebaut. Auf Grund der genann-
ten Eigenschaften versucht man den Gegenstand zu erraten:
Wer ist so klug, wer ist so schlau,
Dem schüttl’ ich was vom Bäumchen:
’s ist innen gelb und außen blau,
Hat mitten drin ein Steinchen.
(Die Pflaume)
Da das Weltbild als grundlegende Kulturkomponente einer
ethnischen Gemeinschaft auftritt und individuell für jede Kultur ist, so
können die Eigenschaften der Gegenstände sowohl als mentale Univer-
salien funktionieren, die in allen oder mindestens in einigen Sprachen
gleich sind, oder ihre nationale Spezifik aufweisen. So erscheint in der
russischen Kulturtradition das Substantiv 30x14 mit den Attributen kocoü
(„schielend“) und mpycnuebiü („feige“, „ängstlich“). In der deutschen
Folklore werden dabei die Eigenschaften „gescheit“, „erfahren“ hervor-
gehoben. Dadurch lässt sich wohl auch die Metapher „Bühnenhase“ für
einen erfahrenen Schauspieler erklären.
Die Frage danach, welche Eigenschaften bei verschiedenen Objekten
stereotyp und welche nationalspezifisch sind, bedarf einer weiteren For-
schung. Die Rolle der Adjektive aber in der Wiedergabe dieser Eigen-
schaften bleibt unumstritten.
228
§ 52. Das Pronomen
Wie bekannt, bilden die Pronomen keine einheitliche Klasse. Da die
Pronomen entweder das Substantiv oder das Adjektiv ersetzen, unter-
scheidet man substantivische und adjektivische Pronomen.
In morphologischer Hinsicht zerfallen sie in drei Gruppen: (1) de-
klinierbare mit dem pronominalen Deklinationstyp, (2) Personalpro-
nomen mit ihrem besonderen Deklinationstyp und (3) undeklinierbare
Pronomen. Einige von ihnen geben das Geschlecht an (er, sie, es), an-
dere unterscheiden das Geschlecht nicht (wer, was) [vgl. Schendels,
1988, 210]. Sie werden bei der Textanalyse als grammatische Stilele-
mente berücksichtigt, weil sie „auf Grund ihrer Kombination unter-
einander und ihrer Zuordnung zu anderen sprachlichen Zeichen“ ei-
nen bestimmten Einfluss auf den Stil ausüben können [s. Fleischer,
Michel, 1977, 149].
Die Pronomen werden als unentbehrliche Elemente der syntakti-
schen Satzstruktur behandelt, obwohl sie stilistisch „eine geringere Rol-
le als die sinntragenden Wortarten spielen“. Sie sind also keine Sinnträ-
ger des Satzes, lassen sich aber dennoch „stilistisch außerordentlich
nutzbar machen“ [s. Faulseit, Kühn, 1975, 161].
Eine ausführliche stilistische Wertung aller pronominalen Klassen
gibt W. Schneider in seiner „Stilistischen deutschen Grammatik“
[vgl. Schneider, 1963]. Wir beschränken uns nur auf einige Fälle.
\bm stilistischen Standpunkt aus ist das Personalpronomen ein ver-
breitetes Mittel der Textgestaltung in einigen Genres. So unterscheidet
T. I. S s i 1 m a n zwischen dem absoluten (unabhängigen) und relativen
(abhängigen) Gebrauch der Personalpronomen. Über den absoluten Ge-
brauch sprechen wir in dem Fall, wenn das Personalpronomen „ich“ un-
mittelbar das lyrische Ich ausdrückt, das die ganze inhaltliche
Struktur des Gedichtes gestaltet. Dann hat das Ich die verallgemeinerte
Bedeutung einer Person, die von genauen und überflüssigen Charakte-
ristiken frei ist, wie Name, Alter, Äußeres, soziale Stellung u. a. Das lyri-
sche Ich tritt hier in der Rolle eines Inkognitos auf. Mit ihm konfrontie-
ren explizit oder implizit „du“ oder „Sie“. So in dem Gedicht von
Heinrich Suso Waldeck (1873-1943):
Geigerin
Ein tiefes Bitten, Beben
Im Singen deiner Geige:
O, junges, heißes Leben.
Ich aber weiß und schweige.
Ein Wohltrank ohne Neige,
Ein Wohltraum ohne Ende
Dein Lied, solang ich schweige.
Ich liebe deine Geige.
Vielleicht noch deine Hände.
229
Der Text kann auch auf dem Personalpronomen „du“ aufgebaut wer-
den. Dann tritt die erste Person in den Hintergrund, obwohl sein Ge-
genüber durch das Prisma seiner Gedanken und Gefühle gezeigt wird:
Du meine heilige Einsamkeit,
du bist so reich und rein und weit
wie ein erwachender Garten.
Meine heilige Einsamkeit du —
halte die goldenen Türen zu,
vor denen die Wünsche warten.
{R.M. Rilke)
In den sechs Zeilen verspürt man eine so hohe Konzentration der Ge-
fühle, der innigsten Wünsche des lyrischen Helden, dass man dieses Ge-
dicht beinahe als eine Anbetung empfindet. Zu der Personifizierung „der
heiligen Einsamkeit“ trägt ein grammatisches Mittel bei — das Personal-
pronomen „du“, mit dem gewöhnlich eine Person angesprochen wird.
Die Ähnlichkeit mit einem Gebet verleiht dem Gedicht dasselbe Mittel —
das Du. das außer der Vertraulichkeit auch den höchsten Grad der Vereh-
rung ausdrückt: so spricht man den Gott, die Heimat und die Welt an:
Neujahr
In Ihm sei’s begonnen,
der Monde und Sonnen
an blauen Gezeiten
des Himmels bewegt.
Du, Vater, Du rate!
Lenke Du und wende!
Herr, Dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt!
(E. Mörike)
In den letzten zwei Beispielen (die Gedichte von R. M. Rilke und
E. Mörike) dürfen wir kaum über den Seriengebrauch des Personalpro-
nomens sprechen. In diesen Fällen haben wir es mit dem relativen (ab-
hängigen) Gebrauch des Pronomens zu tun.
W.Schneider bemerkt, dass in der Lyrik die Auseinanderset-
zung mit sich selbst einen großen Raum einnimmt. Wenn auch
das Ich nach wie vor die wichtigste lyrische Person ist, so erscheint das
Du der Selbstanrede in der neueren Zeit immer häufiger in lyrischen
Werken [vgl. Schneider, 1963, 129].
Als Beweis dafür könnte der Roman von Chr. Wolf „Kindheitsmus-
ter“ dienen. Die Autorin spricht mit sich selbst über die vergangenen
Jahre:
Frühere Leute erinnern sich leichter: eine Vermutung, eine höchstens halb-
richtige Behauptung. Ein erneuter Versuch, dich zu verschanzen. Allmählich,
über Monate hin, stellte sich das Dilemma heraus: sprachlos bleiben oder in
230
der dritten Person leben, das scheint zur Wahl zu stehen. Das eine unmöglich,
unheimlich das andere. Und wie gewöhnlich wird sich ergeben, was dir weniger
unerträglich ist, durch das, was du machst. Was du heute, an diesem trüben
3. November des Jahres 1972, beginnst, indem du, Packen provisorisch be-
schriebenen Papiers beiseite legend, einen neuen Bogen einspannst, noch ein-
mal mit der Kapitelzahl I anfangst.
Die Erzählerin will begreifen, wie die Einflüsse aus ihrer Kindheit
und Jugend in ihr „späteres Leben eindringen“. Dazu ist ein Dialog mit
sich selbst nötig. Das ist aber ihre poetische Eigenart, denn man kann
über sich selbst auch in der 3. Person sprechen. W. Schneider nennt eini-
ge Grunde dafür: Scham vor der Selbstentblößung; Stolz, der nicht he-
rausfordern will; der Drang, sich selbst wie ein fremdes Objekt abzutas-
ten; bewusster Verzicht auf den Ausdruck persönlicher Anteilnahme
[vgl. Schneider, 1963, 139].
Man kann auch über den Seriengebrauch des Personalpronomens
„er“ sprechen. Dieses Pronomen erfüllt im Ganztext eine bestimmte
Aufgabe: er weckt bei dem Leser ein großes Interesse für die Person, die
hinter diesem „er“ steckt. Der Leser strebt also danach, möglichst viel
Information zu bekommen. Ergreift (nach H.Weinrich) zur Postin-
formation, um den Text zu enträtseln:
Fläming
(von M. Jendryschik)
Er sieht vom Versteck auf den Damm. Die Schienen sind hell in der Sonne,
er sieht eine Leiter, er weiß, sie heißt Strang, die reicht bis zur fernen Brücke,
und beiderseitig Sandschrägen (links dunkelt ein Schatten), später in wellige
Hügel verfließend, gelbweiß gelichtet; auf ihrem oberen Teil stehen die Kie-
fern, die Wächter, darüber weht eine Zeltplane, still und so groß, er denkt sich,
das könnte der Himmel sein...
In den weiteren zwei Absätzen entwickelt sich eine Handlung, deren
Hauptperson nur als „er“ auftritt. Der Leser kann sich kaum genau vor-
stellen, was weiter dargestellt wird. Diese fehlende Information sucht er
im Text und findet sie auch nicht gleich, denn der Autor greift zu der
Retardation, d.h. zum Verlangsamen des Erzählens, in den Episoden,
die die Beschreibung der Gegenstände, der Natur oder der handelnden
Personen enthalten, also an den Stellen, die nicht von Belang sind. Das
Tempo wird beschleunigt, wenn etwas Wichtiges dargestellt wird
[vgl. 3ko, 2002, 125—126]. Die Hauptperson bleibt aber bis zu Ende
hinter dem „er“ versteckt.
W. Schneider bemerkt, dass die Personalpronomen für den Stilfor-
scher reizvoll und wichtig werden, erst dann, wenn sie ihre Plätze wech-
seln oder vom gemeinüblichen Gebrauch abweichen [s. Schneider,
1963, 129].
In unseren Überlegungen bleiben wir bei den oben genannten Perso-
nalpronomen und verzichten auf andere Klassen von Pronomen, nicht
weil sie im stilistischen Sinn keinen Wbrt haben, sondern weil das vorlie-
231
gende Buch bestimmte räumliche Einschränkungen hat. Wir weisen nur
kurz darauf hin, dass sich die Pronomen an der Gestaltung des Anfangs
„in medias res“ aktiv beteiligen (Sieh S. 199 — 200).
Die Eigenschaft der Personalpronomen, einerseits das grammatische
Geschlecht anzugeben und andererseits keine Nennfunktion zu haben
(sie weisen auf den Gegenstand nur hin), entspricht vollkommen den
pragmatischen Aufgaben der Textsorte Rätsel. Der Gegenstand, der
verrätselt wird, erscheint im Text oft als „ich“ oder „er“, „sie“, „es“:
Nimm mir das rote Schloß vom Mund,
So tu ich dir was Neues kund.
(Der Brief)
In der einschlägigen Literatur wird oft betont, dass das grammatische
Geschlecht des verrätselten Wortes die Wähl des Personalpronomens (er,
sie oder es) beeinflusst, wie z. B.:
Vier Jahre bleibt er aus,
Dann kommt er nach Haus
Und zeigt sich wieder
Im Kreis seiner Brüder.
(Der Schalttag)
Die Übereinstimmung zwischen dem Geschlecht des Substantivs
„der Schalttag“ und dem Personalpronomen „er“ ist ein Lösungshin-
weis von Seite des Rätselgebers: der Rätsellöser sucht entsprechend nur
unter den Substantiven männlichen Geschlechts, so wie auch im folgen-
den Rätsel, wo die Antwort unter den Feminina zu suchen ist:
Sie hat vier Flügel und kann nicht fliegen,
Wohl zwanzig Füße und kann nicht kriechen,
Frisst unersättlich Korn und Kern,
Und schafft doch Nutzen ihrem Herrn.
(Die Windmühle)
Dabei wird das Personalpronomen „sie“ durch das Possessivprono-
men im Dativ „ihrem“ unterstützt, das auch auf ein Femininum hin-
weist.
Das Volksrätsel hat aber seine Eigenart: es übt eine spielerische, un-
terhaltende, scharfsinnübende Funktion aus (so J. G. Herder). Typisch
für das Rätsel ist, dass es menschliche Körperteile durch „ähnliche“ Be-
griffe des Hauses und Hausrats ersetzt, Belebtes wie Ünbelebtes be-
schreibt, Unbelebtes verlebendigt, personifiziert, den Hörer in die Irre
leitet, eine falsche Lösung suggeriert, Zweideutigkeiten mit Absicht ein-
führt, — das alles, um den Lösungsgegenstand zu verdunkeln [vgl. Bent-
zien, Burde-Schneidewind, 1987,243]. Dabei greift man zu verschiede-
nen sprachlichen Mitteln und darunter zur Verschlüsselung durch das
Pronomen „es“. Hinter diesem Pronomen können sowohl ein Lebewe-
sen als auch ein Nichtlebewesen, sowohl eine männliche als auch eine
232
weibliche Person, ein Mensch oder ein Tier stecken. Das Pronomen
„es“ ist also sehr „bequem“ für das Xferrätseln. Es ist ein Universalmittel
für die Verschleierung des zu erratenden Gegenstandes:
Es geht über die Brücken,
Trägt ein Bett auf dem Rücken.
(Die Gans)
Die Pronomen haben also keine Nennfunktion: sie weisen auf die
Gegenstände und ihre Merkmale hin, ohne sie zu benennen. Deshalb
werden sie heute hauptsächlich als Mittel der Satz- und Text Ver-
flechtung behandelt. H.Brinkmann nennt sie „erinnernde Um-
rißwörter“, die inhaltsarm sind. Ihre Funktion im Kommunikationspro-
zess besteht darin, dass sie „erinnern“: sie stellen das dar, was sprachlich
früher schon erwähnt wurde [s. Brinkmann, 1971]. Sie rufen also Erin-
nerungen hervor.
R. Harweg betrachtet die Pronomen als ein anaphorisches Mittel
der Textkohärenz und definiert den Text vom Standpunkt ihrer Beteili-
gung an der Textgestaltung aus: der Text ist ein durch ununterbrochene
pronominale Verkettung konstituiertes Nacheinander sprachlicher Einhei-
ten [s. Harweg, 1968, 148].
Mit der Entdeckung der globalen Kategorien wird die Rolle der Pro-
nomen als Ausdrucksmittel dieser Kategorien analysiert. So werden die
Personalpronomen der L, 2., und 3. Person als Ausdrucksmittel der glo-
balen Kategorie MENSCH behandelt. Dabei muss man zwischen den
Präpositionalfügungen (mit ihm, über ihn, von ihrxxsw.), die personenbe-
zogen sind, und den Pronominaladverbien (damit, darüber, davon usw.)
unterscheiden fvgl. Schendels, 1980, 372].
Nun möchten wir auf zwei Pronomen eingehen, die nicht so oft be-
handelt werden, aber für die textstilistische Bewertung eines Werkes von
Belang sind: auf das Indefinitpronomen „man“ und das Negativprono-
men „niemand“.
So dürfen wir auch über den absoluten Gebrauch und über den Seri-
engebrauch des Pronomens „man“ sprechen. Dabei trägt der Serienge-
brauch dieses Pronomens dazu bei, dass sich seine Bedeutung ändert:
von der verallgemeinernden zu der bestimmt-persönlichen. Xferfolgen
wir das am Beispiel einer Miniatur von F. Kafka:
Wunsch, Indianer zu werden
Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden
Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden
Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel
wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemäh-
te Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.
Die Fantasie lässt den Autor sich deutlich und detailliert die Gefühle
der Person vorstellen, die er als „man“ bezeichnet, sich tief in deren
Wahrnehmung hineinleben. Das Pronomen „man“ verliert das Unbe-
233
stimmt-Persönliche, das ihm eigen ist, und wird von dem Leser als das
lyrische Ich des Autors empfunden, das dem Zustand „der lyri-
schen Konzentration“ vollkommen entspricht. Die subjektive Färbung
und auf solche Weise die Korrelierung mit dem verborgenen Ich des Au-
tors bring der Konditionalsatz mit „wenn“ und mit dem Konjunktiv, der
einen irrealen Wunsch des Autors ausdrückt. So sind das Pronomen
„man“, der ivenn-Satz und die \brben, die in der 1. Person Sg. erschei-
nen („erzitterte“, „ließ“ und „wegwarf“), Glieder des Personalnetzes
dieses Textes, das im 15. Kapitel eingehend behandelt wird.
Das Negativpronomen „niemand“ geriet nicht so oft in das Blickfeld
der Stilforscher. Es ist weder an Vielfalt der grammatischen Formen
noch an Bedeutungen, noch an Prägnanz der stilistischen Färbung
reich. Trotzdem kann dieses Pronomen seinen Beitrag zur stilistischen
Gestaltung des Textes leisten. Verfolgen wir das am Beispiel des folgen-
den Textes von F. Kafka:
Der Ausflug ins Gebirge
„Ich weiß nicht“, rief ich ohne Klang, „ich weiß ja nicht. Wenn niemand
kommt, dann kommt eben niemand. Ich habe niemandem etwas Böses getan,
niemand hat mir etwas Böses getan, niemand aber will mir helfen. Lauter nie-
mand. Aber so ist es doch nicht. Nur daß mir niemand hilft, — sonst wäre lau-
ter niemand hübsch. Ich würde ganz gern — warum denn nicht — einen Aus-
flug mit einer Gesellschaft von lauter Niemand machen. Natürlich ins Gebir-
ge, wohin denn sonst? Wie sich diese Niemand aneinander drängen, diese vie-
len quergestreckten und eingehängten Arme, diese vielen Füße, durch winzige
Schritte getrennt! Versteht sich, daß alle in Frack sind. Wir gehen so lala, der
Wind fährt durch die Lücken, die wir und unsere Gliedmaßen offenlassen. Die
Hälse werden im Gebirge frei! Es ist ein Wunder, daß wir nicht singen.“
Der Gedanke des Autors schafft eine ungewöhnliche, fantastische
Gestalt. Eine eindringliche Wiederholung des Schlüsselwortes „nie-
mand“ führt zu der Personifizierung dieser Gestalt. Sie be-
kommt konkrete Eigenschaften des Menschen (sich aneinander drängen,
diese vielen... quergestreckten Arme, diese vielen Füße,... daß alle in Frack
sind). Das wird auch durch die Substantivierung des Pronomens „nie-
mand“ im zweiten Teil des Textes ausgedrückt (von lauter Niemand, die-
se Niemand). „Niemand“ wird neben dem „Ich“ zu einem der Textrefe-
renten. Das Gleichsetzen von „ich“ und „niemand“ und ihre Ver-
schmelzung zum Textreferenten „wir“ spiegelt eine Besonderheit
der lyrischen Texte wider, für die die Verschmelzung der Referen-
ten typisch ist.
Unsere Überlegungen über die Rolle der Pronomen in der Gestal-
tung eines künstlerischen Textes schließen wir mit einem einfachen, in
seiner Schlichtheit beinahe rührenden Gedicht eines namenlosen Au-
tors. Es beweist noch einmal, dass auch im 12. Jahrhundert das Ich und
das Du in einem lyrischen Text die Hauptpositionen bekleide-
ten:
234
Dü bist min, ich bin din:
des solt dü gewis sin.
dü bist beslozzen
in minem herzen:
verlorn ist das sluzzelin:
dü muost immer drinne sin.
§ 53. Das Numerale
Die Leistung der Zahlwörter (Numeralien) besteht darin, Vielheit,
Menge, Größe anzugeben. Sie werden von semantischer Seite her durch
Eindeutigkeit und Genauigkeit charakterisiert.
W. Schneider bemerkt, dass dem Zahlwort eine peinliche
Nüchternheit anhaftet. Numeralien sind selten in Dichtungen, in
Schriften zu treffen, die die Fantasie und das Gefühl ansprechen wollen
[vgl. Schneider, 1963,545],
Die so genannten „runden Zahlen“ (hundert, tausend usw.) werden
überall gebraucht. Die Zahlen „zwei“, „drei“ sind auch in verschiede-
nen Texten zugelassen, sogar in der Lyrik. Es gibt Fälle, wenn eine
Gruppe von Personen oder zusammen zu denkenden Dingen nach ihrer
Anzahl fest und bekannt sind: sieben Weltwunder, neun Musen, zwölf
Apostel.
W. Schneider geht auf die „runde Zahl“ ausführlicher ein und be-
merkt, dass „hundert“, „tausend“ und „ein Dutzend“ meist übertrei-
ben: sie sind nicht mit ihrer arithmetischen Bestimmtheit gemeint. Es
geht um eine unbestimmte Vielheit. Aber die hohe runde Zahl
sorgt dafür, dass diese Vielheit nicht zu niedrig angesetzt wird
[s. Schneider, 1963,346-350}.
Bemerkenswert sind Überlegungen über die Zahl „Dutzend“. Wenn
diese Zahl auf Personen angewendet ist, so hat es einen abschätzigen
Sinn: es drückt sie auf die Stufe von Waren herab (ein Dutzend Eier), de-
nen kein individueller Wert zukommt. Man könnte „ein Dutzend“ ge-
brauchen, wenn es um ein gemeinsames Unternehmen, eine gemeinsa-
me Arbeit geht. Dabei kommt es auf die persönliche Werte und Leistun-
gen des einzelnen nicht an [vgl. Schneider, 1963, 351].
Die Numeralien sind in erster Linie für den Stil der Wissen-
schaft und den Stil des öffentlichen Verkehrs kennzeichnend.
Die Sachprosa kann ohne Numeralien nicht auskommen. Nehmen
wir als Beispiel die Biograf ie mit genauen Zeitangaben über den Ge-
burtstag und das Geburtsjahr, über die Zeitperioden, als die betreffende
Person studiert oder gearbeitet hat. Die Numeralien, die die temporalen
Substantive begleiten und mit ihnen zusammen die genauesten Zeit-
markierungen darstellen, sind ein Merkmal der Textsorte „Biografie“.
Diese auffallende Eigenschaft der Biografietexte wird auch nicht sel-
ten parodiert. So schrieb L. Feuchtwanger Folgendes:
235
Der Autor über sich selbst
Der Schriftsteller L.E war 19mal in seinem Leben vollkommen glücklich
und 14mal abgründig betrübt. 584mal schmerzte und verwirrte ihn bis zur Be-
täubung die Dummheit der Welt, die sich durch keine Ziffer ausdrücken läßt.
Dann wurde er dagegen abgestumpft. Sehr genau erkennend, daß Leistung sich
nicht deckt mit Erfolg und daß der Mann sich nicht deckt mit der Leistung,
würde er, falls man ihn fragte: „Bist du einverstanden mit deinem bisherigen
Leben?“, erwidern : „Ja. Das Ganze noch einmal.“
Der Gebrauch der Numeralien verleiht dem Text den Charakter ei-
nes Dokumentes, so knapp, sachlich und genau wirkt die in ihm
präsentierte Information.
In der Publizistik erscheinen die Numeralien ziemlich oft und
könnten zu den Kennzeichen einiger Genres gezählt werden. In Ch ro-
niken und Reportagen sind die Numeralien unverzichtbar.
WM-Titel für Prost
7. November. Zum Ende seiner Karriere wird der französische Autorenn-
fahrer Alain Prost zum vierten Mal Weltmeister. Sein Titelgewinn stand bereits
vor dem letzten Lauf der Formel-/-Saison im australischen Adelaide fest, den
Prost als Zweiter hinter dem Brasilianer Ayrton Senna beendet.
Der 3^-jährige, der 14 Jahre lang als Formel-/-Profi auf der Piste war, ist
mit vier WM-Titeln, 51 Grand-Prix-Siegen und 33 Trainings-Bestzeiten nach
dem fünfmaligen Champion Juan-Manuel Fangio der bisher erfolgreichste
Fahrer.
Der Deutsche Michael Schuhmacher, der 1992 in seiner ersten kompletten
Saison sensationell auf dem dritten Platz der Gesamtwertung gelandet war,
muß in Adelaide wegen Motorschadens vorzeitig aufgeben. In der Weltmeister-
schaft bleibt für ihn am Ende Platz 4. In die neue Saison 94195, die von mehre-
ren Unfällen mit Todesfolge überschattet ist, startet Schuhmacher mit großem
Erfolg. (Chronik des 20. Jahrhunderts)
Unumgänglich ist der Gebrauch der Numeralien in Texten, die nach
verschiedenartigen Umfragen ihre Ergebnisse mitteilen, z.B.:
Das liebste Hobby der Deutschen ist Musikhören (41 Prozent), noch vor
dem Fernsehen (36,1 Prozent). Das ergab eine Umfrage des Instituts der deut-
schen Wirtschaft. 31,4 Prozent lesen in ihrer Freizeit am liebsten Tageszeitung.
Auf dem vierten und fünften Platz landeten Essengehen und Treffen mit Freun-
den. Zu den aussterbenden Hobbys zählt dagegen das Briefmarkensammeln.
Darum sagen Kavaliere heute auch: Kommst du mit nach oben, ich zeige dir
meine E-Mail-Adressen.
In diesem Text erfüllt das Numerale seine Hauptfunktion — die Er-
scheinung eindeutig, genau und nüchtern zu charakterisie-
ren.
Die Numeralien erscheinen oft auch in der Kinderliteratu r, die
ihre spezifische Aufgaben erfüllt. Ihre primäre Aufgabe besteht darin,
Kinder mit dem richtigen Xferhalten in der Welt bekannt zu machen. Sie
236
vermittelt, auf das tägliche Leben ausgerichtet, Lebensmaximen, Arbeit-
samkeit, Lembereitschaft. Kindergedichte und Abzählreime lehren das
Kind richtig zählen. Für sie ist ein monotoner Rhythmus kennzeich-
nend. Der Grund dafür ist die Vorliebe der Kinder für möglichst simple,
gleichmäßige, rhythmische Wiederholung. Eine richtige Rolle spielen
dabei die Zahlwörter:
Da waren sieben Hasen,
die jagten einen Schneck,
der tapferste der Hasen
ging zitternd vorneweg.
Der zweite trug die Flinte
und machte sich ganz klein,
der dritte mit der Lanze
saß hinter einem Stein.
Der vierte mit dem Knüppel
sprach leise „Dran und drauf.“
Der fünfte sah durchs Fernrohr
und tat kein Auge auf.
Der sechste schwang mit Eifer
ein Säbelchen aus Holz,
der letzte trug zwölf Orden
und blickte kühn und stolz.
Da hob der Schneck die Fühler
und sah sich kurz mal um,
gleich blieben alle stehen
und standen dumm und stumm.
Dann rannten sie koppheister
nach altem Hasenbrauch,
es flatterten die Ohren
und ihre Herzen auch.
Die Ordnungszahlwörter schaffen in diesem Text den erwünschten
monotonen Rhythmus. Er entsteht dank dem lexikalisch-syn-
taktischen Parallelismus der Sätze: in fünf Sätzen des Textes
erscheinen an erster Stelle die Numeralien, d. h. Wörter, die zu einer
und derselben Wortart gehören, im gleichen Kasus stehen und gleiche
syntaktische Funktionen erfüllen: sie sind alle Attribute der Satzsubjek-
te. Außerdem spielt jedes dieser Zahlwörter (der zweite, der dritte, der
vierte, der fünfte, der sechste) sowohl eine anaphorische als auch
eine kataphorische Funktion: jedes stellt einen Rückverweis und
gleichzeitig einen Vorverweis dar (wenn es einen zweiten Hasen gibt, so
gibt es einen ersten und vielleicht auch einen dritten). Im Rahmen des
Ganztextes erfüllen sie also die Funktion der Verflechtungsmit-
tel.
Verbreitet sind die Numeralien auch in den Abzählreimen'.
Eins, zwei, drei, vier —
Alle Kinder sitzen hier,
Sitzen beieinander,
Gelber Salamander,
Gritzegraue Maus,
Oliver ist aus.
In dem Text des Abzählreims „überspielen“ Rhythmus und Reim
den eigentlichen Sinn. Aber sie sind auch keine richtigen Gedichte und
gleichen eher einer Formel, einem Spruch. Ihre pragmatische Aufgabe
besteht darin, die Rollen der Kinder im Spiel und die Reihenfolge für
den Spielbeginn zu bestimmen. Der Abzählreim hat seine besondere
Struktur. Seine Grundlage bildet das Zählen. Der Abzählreim verfügt
über einen Anfang, einen mittleren Teil und einen Schluss. Er kann auf
237
einem stark betonten und rhythmisch hervorgehobenen Wort enden.
Die verwickelte, eigenartige Kombination von Rhythmen und Lauten
lenkt die Aufmerksamkeit der Dichter und Komponisten auf sich, die
sie nachahmen oder Musik dazu schreiben. Für unser Thema ist aber
wichtig, dass in allen Bestandteilen dieser Texte oft Numeralien vor-
kommen.
Den Numeralien kommt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der
referentiellen Textstruktur zu, weil sie dem Textreferenten eine
genaue Charakteristik geben, die eine Verwechslung mit anderen Refe-
renten ausschließen. So sind die Numeralien in dem oben angeführten
Kindergedicht über die Hasen Hauptsignale für die Unterscheidung der
Textreferenten.
§ 54. Das Partizip
Die Partizipien nehmen wie bekannt eine Mittelstellung zwischen
Verb und Adjektiv ein. Die verbalen Eigenschaften (Bedeutung des
Genus, der Aktionalität, der relativen Zeit und Beibehaltung der verba-
len Valenz) überwiegen. Die adjektivische Eigenschaft der Partizi-
pien besteht in der Möglichkeit, wie Adjektive gebraucht und dekliniert
zu werden [vgl. Schendels, 1988, 110].
Einige Partizipien haben sich in Adjektive verwandelt, nachdem sie
ihre semantische Verbindung mit den Verbalformen geschwächt oder
aufgelöst hatten: Der Film ist spannend', Die Antwort ist glänzend. Die an-
deren werden im Satz formelhaft gebraucht. Sie bilden im Satz eine iso-
lierte Gruppe der „absoluten Partizipien“ und nähern sich funktional
den Präpositionen oder den Konjunktionen. Dazu gehören die folgen-
den Partizipien: „ausgenommen“, „ausgeschlossen“, „eingeschlossen“,
„einbegriffen“, „angenommen“, „gesetzt“, „betreffend“, „ange-
hend“ — Gesetzt den Fall', Alle Bücher sind verkauft, ausgenommen ein
einziges. Oft wirken sie als „Kanzleiwörter“.
Das Partizip II besitzt satzbildende Kraft. Es drückt einen Befehl in
Imperativsätzen aus. Meist sind es Kommandos:
Stillgestanden! Beiseite getreten!
Im Zeitungsstil ersetzt das Partizip II in den Überschriften und
Schlagzeilen das Prädikat:
Hoher Funktionär der Baath — Partei gefasst.
Atomreaktor Biblis A wegen Störfall stillgelegt.
Das Partizip II kann auch in der direkten Rede als Verkürzung
des Perfekts, des Passivs oder des Stativs auftreten:
Schon geschafft! Schon gelesen!
Diese Strukturen können eine starke stilistische Färbung haben,
wenn sie eine Reihe von schnell einander ablösenden Ereignissen schil'
238
dern. In diesem Fall kann der Partizipialsatz auch ein Subjekt enthalten
[s. Schendels, 1988, 114-116]:
Ich aufgesprungen, zur Tür hinausgeeilt und den Dieb gefasst!
Die Partizipien werden oft bei der Beschreibung einer Person oder
eines Gegenstandes gebraucht:
Gedanken über ein Leben
In meinem Arbeitszimmer, dem Schreibtisch schräg gegenüber, hängt das
Porträt einer Frau, deren Alter man auf sechzig schätzen würde, wenn da nicht
der gespannte Blick, die aufgerichtete Haltung, die energische Hebung des
Kopfes wären, die diesen Verweis ins Alter bestritten und ein neues, aufmerksa-
meres Sehen erzwängen. Das Bild, von dem Dresdener Maler Rudolf Nehmer
mit der ihm eigenen sachlich-präzisen Akkuratesse durchgestaltet, scheint eine
naturnahe, fast fotografische Wiedergabe der Dargestellten zu sein; man
wünscht sich, Modell und Wirklichkeit miteinander vergleichen zu können...
Selbst wenn man die Frau bereits gut und lange kennt, sieht man in dem Bild
noch Neues, Unerwartetes, es hilft, Wesentliches, vielleicht sogar das Wesen
neu zu sehen. Ich kenne die Dargestellte, die Schriftstellerin Hedda Zinner,
sehr lange und sehr gut. Sie ist meine Mutter. (John Erpenbeck)
Den erwünschten Effekt eines statischen Bildes schaffen in
diesem Text die Partizipien II. Dank ihrer Eigenschaft, eine abgeschlos-
sene Handlung zu bezeichnen, verleihen sie dem Text den Charakter ei-
ner vollendeten Situation, die keine innere Entwicklung anstrebt.
Das Partizip I leistet auch seinen Beitrag zur stilistischen Gestaltung des
Textes. Im Gegensatz zum Partizip II bringt es Bewegung, Dyna-
mik, oft auch Expression in den Text hinein. Das könnte man am
Beispiel eines Textes von Dieter Forte verfolgen, in dem er Hans Holbeins
Gemälde „Der schreibende Erasmus von Rotterdam“ (1523) beschreibt:
Der schreibende Erasmus von Rotterdam, gemalt von
Holbein aus Basel,
im Hause seines Druckers Froben
nicht weit vom Totentanz,
sehr weit vom Niederrhein.
„Das Licht der Welt“,
unabhängig von den Interessen der Welt,
sich an keinen bindend,
die Bibel übersetzend,
Lukian und die Kirchenväter publizierend,
das „Lob der Torheit“ und die „Klage des Friedens“.
Gebildet, belesen. Wissen verbreiternd, bissig, satirisch,
die Menschen erkennend,
keiner schrieb so intelligent wie er,
so vergnüglich und so böse...
Die Partizipien tragen zur Entstehung eines lebendigen Por-
träts bei: Erasmus wird als ein aktiver, tätiger Mensch gezeigt, dessen
239
Tätigkeit sich auf verschiedene Bereiche erstreckt. Das Partizip I, das die
Bedeutung des aktiven Genus hat, verbindet sich mit der Bezeichnung
des Handlungsträgers und hat das Sem „Dauer des Voigangs“. Diese Ei-
genschaften des Partizips I verleihen der Gestalt von Erasmus Ausdruck
und Dynamik.
Und wie verwirrt und verwirrend wirkt ein Text, wo die Par-
tizipien (I und II) durcheinander gebraucht werden, wie z. B. in der fol-
genden rätselhaften Miniatur:
Zum Stand der Bewegung
(von M.Jendryschik)
Stolz, steif, wie schreitend. Vorgebeugt. Aufrecht und heiter. Lang kriechend.
Zurückgelehnt, im Gelächter, die Brust ein Buckel. Gebeugt. Krumm, aber
grad. Sich duckend. Ausweichend, unbeirrt. Die Sohlen küssend. Sich rollend,
zerstörend. Sich hebend, den anderen aus dem Nacken. Schon wie zerschlagen.
Die Schultern rammen den Wind. Zerschlissen, zerschleißend. Die Schnauze
im Dreck, im Himmel. Geht er. Voran.
Geht er? Voran?
Die Partizipien sind auch für die beschreibenden Texte kennzeich-
nend, die zu anderen Funktionalstilen gehören. So erscheinen in einem
pub lizistischen Text zahlreiche Partizipien, die die Situation bild-
haft und farbenfroh darstellen. Sie wirken mit den Adjektiven zusammen
und gestalten den Text als eine kurze gefühlsgeladene Skizze, die ein
pragmatisches Ziel verfolgt — auf die feinen Damen einzuwirken:
Leben in Extravaganz
Prunkentfaltung und Extravaganz kennzeichnen die Mode des ersten Jahr-
zehnts (des XX. Jahrhunderts — L. N.): Die Farben sind hell, freundlich, Aus-
druck des strahlenden Optimismus der Epoche. Wer reich genug ist, sich die
Mode leisten zu können, hüllt sich in Kleider aus Tüll, Seidenmusselin, Chif-
fon, Crepe de Chine: das sind die beliebtesten Stoffe und Gewebe der Zeit, sie
strahlen in Lila, Hellblau, auch Rosa.
Zusätzlichen Schmuck erhalten viele Kleider durch handgemalte Aufsätze,
besetzte Bändchen und aufgestickte Blumenmuster. Kunstvoll wie die Kleider
fallen auch die Blusen der Damen aus. Sie sind mit Biesen und Einsätzen ver-
ziert, aber Modezeitschriften verurteilen auch die übertriebene, oft gekünstelte
Wirkung. Besonders populär wird das Bolerojäckchen, ebenso das Etonmieder,
ein Kleidungsstück, das der Etonjacke für Knaben nachempfunden ist. (Chronik
des XX. Jahrhunderts)
Den äußersten Fall bilden Texte, die nur aus Partizipien bestehen,
wie z. B. das folgende Gedicht von Rudolf Otto Wiemer:
Partizip perfekt
gezeugt geboren gewimmert
getrunken gelallt gespielt
gelernt gekuscht geschlagen
geliebt geheiratet gemustert
240
marschiert marschiert marschiert
geschossen gezittert geschnappt
gehumpelt geklaut gehungert
gesessen gehurt geschieden
geschuftet geflucht gefeiert
gekotzt geröntgt geschissen
gewimmert gestorben gelebt
Hinter diesen Partizipien steckt eine Biografie, in den Vorgängen
dargestellt. Der Autor stützt sich auf die verbalen Eigenschaften des Par-
tizips II und zeigt die Xbigänge als abgeschlossen, in die Veigangenheit
geraten.
In Texten erscheinen auch die so genannten Pseudopartizipien, die
nicht von einem finiten Verb, sondern von einem Substantiv nach dem
Modell des Partizips II gebildet sind. Sie haben die Bedeutung des passi-
ven Genus und des dauernden Zustands [vgl. Schendels, 1988, 77P1: be-
brillt y beschuht, geblümt, bewaldet. In den Wörterbüchern sind mehr als
300 Pseudopartizipien fixiert. Sie entstehen und verschwinden aus der
Sprache, so dass es unmöglich ist, eine genauere Zahl dieser Wörter zu
nennen.
Wie aus den angeführten Beispielen folgt, werden die Pseudopartizi-
pien vom substantivischen Stamm mit Hilfe von Präfixen und Suffix -t
gebildet. Als untrennbare Präfixe können be-, ge-, er-, ver-, zer-, als un-
trennbare Halbpräfixe durch-, über-, um-, und trennbare Präfixe an-,
aus-, ein- fungieren. Einige Pseudopartizipien haben unterschiedliche
Präfixe, aber gleiche Bedeutung: geblümt—beblümt, gefurcht—ver-
furcht—zerfurcht. Dann werden sie als Synonyme behandelt.
Die Pseudopartizipien können das Xbrhandensein oder das Fehlen
von Eigenschaften oder Zuständen {bebrillte Augen, ein gut gelaunter
Mann, ein angestaubter Stoff ein livrierter Diener, die verhuschten Ufer,
ein enthorntes Tier), die Veränderung eines Zustandes {verwurmtes Holz,
die zerlappten Tuchpantoffel) bezeichnen und auch eine übertragene Be-
deutung haben {eine bejahrte Frau, entseelte Häuser).
Im Satz können Pseudopartizipien als Attribute oder als Prädikative
auftreten. Verfolgen wir die Wirkung der Pseudopartizipien im Text:
Was seht ihr? Überall klingeln die Straßenbahnen, heben die Schutzleute
ihre weißbehandschuhten Hände, überall prangen die bunten Plakate für Ra-
sierseife und Damenstrümpfe. {Kurt Tucholsky. „Schloss Gripsholm. Eine
Sommergeschichte“)
Da die Pseudopartizipien auch Zusammensetzungen bilden können
{weißbehandschuht, schwarzberockt), tragen sie zur Vereinfachung
des syntaktischen Satzbaus, zur Textkompression bei.
Die Pseudopartizipien sind ein überzeugendes Beispiel für das Zu-
sammenwirken des lexikalischen, wortbildenden und grammatischen
Systems der deutschen Sprache. Darin spiegeln sich also die Besonder-
heiten des deutschen Sprachbaus wider.
241
Das kommt besonders deutlich zum Ausdruck, wenn man die Pseu-
dopartizipien ins Russische zu übersetzen versucht, wie z. B. in folgen-
den Absätzen:
Anngret stand auf Stelzenschuhen im Fallaub... Eine Orchidee zwischen
Bauernblumen. Blaubehärt und bewimpert sah sie auf Bienkopp. (E. Strittmat-
ter. „Ole Bienkopp“)
Sie denkt dabei merkwürdigerweise an Sägemüller Ramsch, einen studier-
ten Menschen und Herrn... Sägemüller Ramsch hebt sein zerstudiertes Gesicht
aus dem Kirchenblatt, (ebenda)
§ 55. Das Verb
Das Verb ist die wandlungsfahigste Wortart und macht ein Viertel des
Gesamtwortschatzes aus. Es setzt Tätigkeiten, Zustände, Ereignisse fest,
bestimmt sie zeitlich, verknüpft sie mit Handhmgs- und Zustandsträgem,
gibt Geschehensrichtungen an, setzt sie ins Verhältnis, schätzt sie nach ih-
rer Realität ein. Diese semantischen Eigenschaften werden durch eine
grammatische unterstützt: das Verb kann rechts und links mehrere Leer-
stellen öffnen und Wörter anschließen [s. Riesel, Schendels, 1975, 113].
In der einschlägigen Literatur wird nachdrücklich betont, dass der
deutsche Wortschatz im Laufe der Jahrhunderte viele Verbalformen ver-
lorenhat, inerster Liniedurch die Substantivierung der Infi-
nitive: Andenken, Einkommen, Gutachten, Wesen, Wohlwollen usw., die
heute in der Sprache schon als verselbstständigte Substantive fungieren
[s. Faulseit, Kühn, 1975, 156]. So schreibt Joseph von Eichendorf in
seinem Gedicht „An die Dichter“:
Wo treues Wollen, redlich Streben
Und rechten Sinn der Rechte spürt,
Das muß die Seele ihm erheben,
Das hat mich jedesmal gerührt.
Wo findest du nun ein Haus, vertrieben,
Wo man dir deine Wunder läßt,
Das treue Tun, das schöne Lieben,
Des Lebens fromm vergnüglich Fest?
Obwohl die Infinitive substantiviert sind, büßen sie ihr Wesen nicht
ein und bringen in diese gehoben klingenden, romantischen Strophen
Bewegung und Lebendigkeit hinein.
Die moderne Poesie kennt Beispiele, wo die Infinitive Stütz-
punkte für den gesamten Textinhalt bilden. Auf den Infinitiven ist das
Gedicht von O. Leist gebaut. Der Autor wählt als Ausgangspunkt für sei-
ne Überlegungen das bekannte Sprichwort Irren ist menschlich und ent-
wickelt nach diesem Muster auch andere Äußerungen: „Hassen ist
menschlich“, „Denken ist menschlich“ und „Lernen ist menschlich“.
242
Er entziffert ihren Sinn in der letzten Zeile jeder Strophe durch eine
Reihe von Infinitiven:
Was menschlich ist
Irren,
das erleiden wir
so gut wie unsere Gegner,
ist menschlich:
schlappmachen, hinschmeißen, abhaun.
Hassen,
das erleiden wir
so gut wie unsere Gegner,
ist menschlich:
geifern, losbrüllen, zuschlagen.
Denken,
das versuchen wir
zusammen mit unseren Freunden,
ist menschlich:
nachdenken, mitdenken, vordenken.
Lernen,
das versuchen wir
zusammen mit unseren Freunden,
ist menschlich:
zuhören, einsehen, bessermachen.
Dieses Gedicht zieht den Leser in den Prozess des Denkens hinein.
Der Autor vermeidet (nach der Meinung einer deutschen Zeitung) Jede
künstelnde Ausschmückung“. Jedes Wort ist auf den Gegenstand bezo-
gen. Die Sprache von O. Leist macht die Lektüre zu einem „aufklären-
den Vergnügen“. Dank den Infinitiven ist die Sprechweise zusam-
mengeballt, präzise, beinahe asketisch.
Immer, wenn Dynamik in die Schilderung gebracht werden muss
und ein Handeln oder eine Veränderung beschrieben werden, greift man
zu den Verben:
Große und kleine Mühlen
Grauer Nachmittag — und es dunkelt rasch, und das Grau wird Nacht, und
es gibt keinen Abend.
Der Wind geht hoch oben, und es runkst und es rauscht, und die Schnee-
mühlen gehen in den Buchenkronen. Unter den Bäumen geht angemündet,
lautlos die Mühle meiner Gedanken. Ich schrieb tagsüber, die munteren Ge-
danken liegen, so hoff ich, mit Tinte gekritzelt, daheim auf Papier.
Dürrblätter wehn auf die Wege herab, Blatt fällt zu Blatt, und sie dämpfen
den Hufschlag. Pferdeschweißduft steigt unter mir auf. Das Stutenfell ist schon
winterdicht. Ein Mantel aus Pferdewärme umhüllt mich: Ein Reiter ist allüber-
all zu Hause; mag der Wind droben rauschen, mögen Schneemühlen gehn und
die Blätter raschelnd die Wege betaumeln. (E. Strittmatter)
243
Bei der semantischen Einteilung der Verben unterscheidet man Voll-
verben, die ihre Semantik behalten haben und als vollwertige Prädikate
gebraucht werden, und Funktionsverben (Hilfsverben), die entweder als
ein Teil des Prädikats oder als Kopula mit einem anderen vollwertigen
Verb (Substantiv oder Adjektiv) im Satz erscheinen.
Die Vollverben sind mehrfach geschichtet. Nach H. Brinkmann
unterscheidet man fünf Gruppen von Vollverben:
1) Handlungs- oder Tätigkeitsverben, die eine aktive, auf die Außen-
welt gerichtete Handlung bezeichnen: malen, beobachten, ergreifen',
2) Vorgangsverben, die eine Veränderung in der Verfassung von Men-
schen und Dingen ausdrücken: laufen, kommen',
3) Zustandsverben, die eine bleibende Lage von Menschen und Din-
gen darstellen: schlafen, wohnen, sitzen',
4) Geschehensverben, die ein Geschehen bezeichnen: gelingen, vor-
fallen, geschehen',
5) Witterungsverben, die Wettererscheinungen bezeichnen: es regnet,
es schneit [s. Schendels, 1988, 15—16],
Diese Einteilung ist für die stilistische Charakteristik eines Textes von
Bedeutung. So finden wir in dem oben angeführten Text von E. Stritt-
matter Beispiele für alle Gruppen der Vollverben. Nennen wir nur einige
davon: Handlungsverben: schreiben, dämpfen, betaumeln', Vor-
gangs verben\gehen,fallen, aufsteigen', Zustandsverben: liegen,
hoffen', das Geschehensverb werden; Witterungsverben: es
dunkelt, es runkst, es rauscht. Dank dieser Vielfalt von Verben entsteht
vor den Augen des Lesers das Bild eines Spätherbsttages. Obwohl die
Natur sich auf den Winterschlaf vorbereitet, ist alles in Bewegung: Wind,
Schnee, Bäume, Blätter und auch das Pferd mit dem Reiter. Geräusche
begleiten den Reiter auf seinem Wege und tragen zur dynamischen Ge-
staltung dieses Bildes bei. In diesem Text finden wir auch H ilfsver-
be n: die Kopula sein und das Modalverb mögen, die unsere Verstellung
von den Möglichkeiten des Verbalstils vervollständigen.
Wir müssen betonen, dass die Sprache im Laufe ihrer Entwicklung
die Verben nicht nur verliert, sondern auch neue erwirbt. Dabei werden
alle neuen Verben, die in der letzten Zeit in der Sprache entstehen,
schwach konjugiert, wie z. B. das Verb „monden“, das mit der Ent-
wicklung der Technik und der Kosmonautik in der Sprache aufkam,
oder die Verben „filmen“, „funken“, „tanken“. Dasselbe gilt auch für
Verben, die aus fremden Sprachen übernommen wurden: automatisie-
ren, rationalisieren, managen, boxen. Sie leben sich in die Sprache ein
und werden schon als „deutsche“ empfunden.
Es ist bekannt, dass die Einteilung in starke und schwache Verben auf
Jacob Grimm (1785 —1863) zurückgeht. Eben die starken Ver-
ben, die eine starke Formveränderung erfahren, verleihen der Sprache
ihren Klang.
Aus stilistischer Sicht sind nicht nur Verben von Interesse, die der all-
gemeinen Norm entsprechen, sondern auch Verben, die von dieser
244
Norm abweichen und den Text zu einer eigenartigen Erscheinung ma-
chen. Als Beispiel fuhren wir einen Scherztext an, der an Neologismen
nur so wimmelt, die als Autorenbildungen beurteilt werden, aber jedem
Zeitgenossen verständlich sind:
Wenn moigens mein Wecker
gejunghanst hat,
salamandre ich ins Bad,
palmolive mich gründlich,
blendaxe mir die Zähne,
philipse den Bart und
lasse mich ins Werk opeln.
Abends jedoch ople ich
nicht, sondern bundesbahne.
Zu Hause zeiss-ikone ich
die Tür auf, und wenn ich
mich austrevirat habe,
asbache ich dreimal kurz,
setze mich in den Schöner-
wohnen oder merseburgere
oder löwenthale oder
komissare oder zimmer-
manne, je nach Hörzu.
Mitunter, wenn ich ge-
burtstage oder jubiläe,
söhnleine ich sogar oder
henkelle trocken — denn
einmal geslogant, bleibe ich
Kunde.
Dieses Gedicht lässt sich nur in dem Fall entziffern, wenn der Leser
über bestimmtes Hintergrundwissen verfugt. Sonst bleibt das
Gedicht für ihn unverständlich und gleicht einem Rätsel. Der rätselhafte
Charakter dieses Textes besteht darin, dass der Autor ein Spiel mit dem
Leser beginnt. Wie auch das Rätsel, fordert dieser Text nicht Weisheit,
sondern Wissen. Die verschlüsselten Handlungen, die der Autor aus-
führt, sind semantisch fest an die Gegenwart gebunden und auf eine be-
stimmte Zeitperiode und Situation bezogen. Jeder im deutschen Raum
weilende Zeitgenosse des Autors weiß als potenzieller Kunde, dass
„Palmolive“ — eine Seifensorte, „Philips“ — ein Rasierapparat,
„Opel“ — eine Automarke und „Biendax“ — eine Zahnpaste sind. Die
Werbeslogans für diese Waren verfolgen ihn tagsüber auf den Seiten der
Zeitschriften und auf dem Bildschirm.
Aber auch allgemein bekannte Verben können vom Autor so uner-
wartet gebraucht werden, dass sie eigenartig wirken. So entsteht oft
eine verbale Metapher, die auch durch Bezeichnungübertragung zwi-
schen den Erscheinungen zu Stande kommt:
Die Klarinette hüpfte wie zehn Hühner bis in unsere Ecke.
Plötzlich wuchsen Schritte auf uns zu. (W. Borchert)
In den oben angeführten Sätzen von W. Borchert beleben die Ver-
ben das Leblose. In diesem Fall dürfen wir von Personifizierung spre-
chen. Die Übertragung menschlicher Eigenschaften, Merkmale und
Handlungen auf tierische und pflanzliche Organismen und auf
Nichtlebewesen schafft einen pragmatischen Effekt: sie bringt
Bi Id kraft und Poetizität, manchmal auch Humor und Sa-
tire in den Text hinein [s. Riesel, Schendels, 1975, 219]. Dieses
Stilistikum kennzeichnet die Sprache einiger Schriftsteller, die diesen
Effekt anstreben. So schildert E. Strittmatter im Roman „Ole Bien-
245
kopp“ die Natur als einen unmittelbaren Teilnehmer aller Ereignisse.
Sie lebt, verändert sich, fühlt mit. Ole, die Hauptgestalt des Romans,
sorgt für die Bienen (er heißt auch Bienkopp), er ist glücklich und die
Natur jubelt mit ihm zusammen:
Der Sommer summte durchs Land. Das Seegestrüpp summte und sang.
Vögel, Bienen und die Blätter der Bäume besangen sein löbliches Tun.
(W. Borchert)
Summen, singen, umtanzen, zittern, kommen, zurückweichen, lachen
sind die Verben, die in diesem Roman die Natur darstellen. Sie ist d y-
n a m i s c h, sie befindet sich immer in Bewegung und gleicht in dieser
Eigenschaft dem Haupthelden Ole Bienkopp. Der erste Satz des Ro-
mans lautet: Die Erde reist durch den Weltraum und gibt schon das Tem-
po und die Dynamik auf, wiederholt sich im Text des Romans einige
Male wie ein Leitmotiv und schließt den Roman mit einer optimisti-
schen Note.
Die verbale Metapher, die Personifizierung der Natur trifft man beson-
ders oft in p o e tis c h e n We rken. Ein krasses Beispiel für die Personi-
fizierung finden wir im folgenden Gedicht:
Für und für
Im ersten matten Dämmer thront
Der blasse, klare Morgenmond.
Den Himmel färbt ein kühles Blau,
Der Wind knipst Perlen ab vom Tau.
Der Friede zittert: ungestüm
Reckt sich der Tag, das Ungetüm,
Und schüttelt sich und brüllt und beißt.
Und zeigt uns so, was leben heißt.
Die Sonne hat den Lauf vollbracht,
Und Abendröte, Mitternacht.
Im ersten matten Dämmer thront
Der blasse, klare Morgenmond.
Und langsam frißt und frißt die Zeit
Und frißt sich durch die Ewigkeit.
(D. von Liliencron)
Der Autor, der vom literarischen Impressionismus be-
einflusst ist, stellt die Natur dar, als wäre sie ein Lebewesen. Das Haupt-
gewicht liegt beim Schaffen eines beweglichen, ausdrucksvollen Bildes
auf den Verben. Wie bekannt, waren die Impressionisten danach be-
strebt, die Veränderlichkeit, die Fließbarkeit der Welt zu zeigen. Deshalb
werden in dem Gedicht von Liliencron Verben gebraucht, die eine
Handlung bezeichnen: färben, abknipsen, sich recken, sich schütteln,
brüllen, beißen, fressen. Sie zeigen die Realität in zahlreichen Aspekten.
In den impressionistischen Werken wird der Luft und ihrer Schilderung
ein geräumiger Platz zugewiesen. Das sehen wir, wenn wir „die Haupt-
gestalten“ dieses Gedichtes zu bestimmen versuchen: Dämmer, Himmel,
Mond, Sonne, Wind, Abendröte, Mitternacht und Zeit spielen in dieser
feinfarbigen, fließenden, zitternden Welt eine besondere Rolle. Sie sind
lebendig, fühlend, schaffend und lassen uns die Luft spüren und ge-
nießen. Diese Atmosphäre entsteht im großen Maße dank der Verben,
246
deren Semantik nicht so sehr eine Handlung oder einen Zustand wie-
dergibt, sondern vielmehr den Eindruck, den der Gegenstand oder die
Erscheinung hinterlassen haben, was auch die Spezifik der impressionis-
tischen Sichtweise widerspiegelt.
Manchmal ersetzen die Xbrgangs- oder Handlunsverben metapho-
risch die so genannten „verba dicendi“ (die Verben des Sagens): sagen,
erzählen, antworten, fragen, die die direkte Rede einführen. Die Meta-
phorisierung macht den Text besonders ausdrucksvoll.
Das beweisen wir nun mit einem Beispiel, das ein Gespräch zwi-
schen zwei Personen darstellt. Die eine ist der junge Dorflehrer Siegel,
die andere merkwürdige Person — Bürgermeister Frieda Simson. Sie ist
dreißig, weder hübsch noch hässlich und leidet an Belehrungssucht.
Während des Krieges war Frieda Schreiberin in einer Kaserne, nach
dem Kriegsende versteckte sie sich auf einer Bruchinsel. Sie „machte
sich im Dorf nützlich“: sie half Kriegsschaden beseitigen, führte Proto-
kolle in den Versammlungen und „wuchs in die Parteiarbeit hinein“.
Dann ging sie in die Parteischule und lernte dort einige Zitate aus den
Lehrbüchern auswendig. So ist ihre Rede ein Gemisch aus Zitaten,
falsch gebrauchter Termini und der „Räubersprache“, die sie sich in der
Armee „zugezogen hatte“.
Frieda und Lehrer Siegel streiten zuweilen gelehrt und fahren aufeinander
los. Frieda fährt dabei im Tank mit drei Geschützrohren und Lehrer Siegel spa-
ziert zu Fuß.
„Der Mensch entwickelt sich“, sagt Frieda.
„Aber langsam“, gibt Lehrer Siegel zu bedenken, denn er hat soeben die
Bildnisse ägyptischer Kunst studiert.
Frieda fahrt mit Vollgas. „Der Mensch entwickelt sich von Stunde zu Stun-
de.“
Lehrer Siegel springt zur Seite. „Was das menschliche Mundwerk betrifft, so
sind wir einer Meinung, aber Herz und Hirn, und darauf kommt’s an.“
Frieda läßt die Motoren aufheulen. „Das Herz ist ein Muskel! Bizeps!“
„Aber die Seele!“ schreit Lehrer Siegel gequält.
Frieda überholt Lehrer Siegel. „Mistifizismus, Lyrik, Psychopathie, Melio-
ration und Reaktion!“
Lehrer Siegel läßt sich überholen, und bleibt eine Weile scheintot liegen,
dann steht er auf, rückt seine Brille zurecht und sagt: „Auch die marxistischen
Klassiker verschmähten den Begriff Seele nicht!“ (E. Strittmatter. „Ole Bien-
kopp“)
Eine treffende Wahl der Verben befreit E. Strittmatter von der Not-
wendigkeit, zusätzliche Details in den Text einzufuhren. Darin spiegelt
sich das Streben des Autors wider, nach dem von ihm verkündeten Prin-
zip „der Verknappung“ zu schreiben. Die Sätze, die die direkte Rede
einführen, sind selbstständig und abgeschlossen. Das gibt dem Autor die
Möglichkeit, in wenigen Zeilen ein eindrucksvolles Porträt zu schaffen,
oft mit Humor gewürzt, was wir im oben angeführten Text verfolgen
können.
247
Diese Vielfalt von Verben ist gut in belletristischen Texten,
überflüssig aber in den Texten der Sachprosa. Hier finden Termini
ihren Gebrauch:
Verwertung des Geräts, wenn es einmal ausgedient hat:
Die Kunststoffteile sind mit einer Materialkennzeichnung versehen und
können, wie die übrigen Werkstoffe auch, einer Wiederverwertung zugefuhrt
werden. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei
Ihrer Kommunalverwaltung erfragen.
Wenn wir Texte nach ihrer Expressivität beurteilen, so stellen wir
fest, dass die Sprache der Presse und Publizistik sich zwischen
diesen Funktionalstilen — dem Stil der schöngeistigen Literatur und
dem Stil des öffentlichen Verkehrs — befindet. In Zeitungsberichten
und Meldungen treffen wir neben neutralen Verben auch die Verben, die
über eine starke Ausdruckskraft verfugen:
Riirup: höhere Kassenbeiträge
Der Vorsitzende der Kommission zur Reform der sozialen Sicherungssyste-
me, Bert Rürup, erwartet einen weiteren Anstieg der Beiträge zur Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). Er rechne damit, dass die Beiträge von derzeit
14,3 Prozent auf 15 Prozent Ende des Jahres steigen werden, sagte Rürup dem
Magazin „Focus“. Vor dem Hinteigrund warnte er die Regierung davor, das
Sparkonzept seiner Kommission für das Gesundheitswesen zu verwässern.
Wenn Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) die Kassenbeiträge tatsäch-
lich unter 13 Prozent drücken wolle, dann könne sie aus dem Kommissionsvor-
schlag über 24 Milliarden Euro Einsparungen „nicht sonderlich viel heraus-
schneiden“. Schmidt hat bereits mehrere Vorschläge der Kommission verwor-
fen, darunter höhere Zuzahlungen bei Zahnbehandlungen oder eine generelle
Praxisgebühr für jeden Arztbesuch. („Frankfurter Allgemeine“)
Je nach Zeitungsgenre ist der Stil durch mehr oder weniger e x-
p r e s s i v e Ausdrucksweise gekennzeichnet. Die Expressivität ist in den
Texten dieses Funktionalstils zugelassen.
In wissenschaftlichen Texten werden Verben gebraucht,
die möglichst präzise und eindeutig den Gedanken des Autors zum Aus-
druck bringen. Auf die Emotionalität wird verzichtet. Es werden Streck-
formen gebraucht. Sie wurden lange Zeit als „Papierdeutsch“ verpönt, in
den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat sich aber ihre Ein-
schätzung geändert. Sie wurden nicht mehr als schwerfälliges, schlechtes
Deutsch verurteilt. Man begann ihre kommunikativen und stilistischen
Vorzüge zu untersuchen. Zu solchen analytischen Verbalverbindungen
gehören: große Beachtung finden, ein Versprechen geben, Anerkennung
finden, Abschied nehmen, zum Halten bringen, eine Entwicklung nehmen,
in Rechnung stellen, in Kenntnis setzen, zur Antwort geben, Vorbereitungen
treffen, den Rat geben, Hilfe leisten u.a.
Diese analytischen Verbalfügungen, die aus einem Xbrbalabstraktum
und einem Funktionsverb bestehen, können nicht immer durch ein sy-
248
nonymisches Verb ersetzt werden, weil sie die Information bereichern
und die Aussage inhaltlich präzisieren. Sie bringen berufliches
Kolorit in den Text und steigern manchmal die logisch-sachliche Ex-
pressivität, weil sie größeres Gewicht besitzen [vgl. Riesel, Schendels,
1975, 89, 115}. Davon zeugt auch das folgende Beispiel:
Literarische Texte müssen ihren spezifischen Beitrag zur Erfüllung der ver-
schiedenen Bildungs- und Erziehungsziele des FU (Fremdsprachenunterricht)
leisten. Wenn man den Erwerb sprachlich-kommunikativer Kompetenz in ei-
nem der Völkerverständigung dienenden FU als oberstes Ziel ansetzt, dann ha-
ben literarische Texte als Mittel zu dessen Erreichung zu fungieren, zugleich
aber ist auch das genußvolle Verstehen als Ziel des Unterrichts zu sehen. Mit
anderen Worten, es geht um die Schaffung von Verstehensvoraussetzungen, die
zugleich Interpretationsvoraussetzungen sind. (M. Löschmann. „DaF“, 1/88)
Die verbalen Kategorien — Zeit, Genus und Modus — haben einen
großen stilistischen Wert und wurden mehrmals in linguistischen For-
schungsbeiträgen behandelt. Wir werden auf die Kategorie der Zeit und
die Kategorie des Modus in den entsprechenden Abschnitten eingehen,
die der temporalen und der modalen Struktur des Textes gewidmet sind.
In diesem Abschnitt befassen wir uns mit dem Genus.
Das Passiv wird in dem Fall gebraucht, wenn der Blickpunkt des Au-
tors und seine Perspektive mehr auf dem Gegenstand der Handlung,
weniger auf dem Handlungsträger liegt. Der Handlungsträger wird dann
nicht mehr genannt. Der Gegenstand der Handlung wird schärfer her-
vorgehoben [s. Faulseit, Kühn, 1975, 152}. Das Aktiv und das Passiv ge-
statten also eine Darstellung aus unterschiedlichen Blickrichtungen.
Das Stativ als das dritte Glied in der Opposition „Aktiv — Passiv —
Stativ“ wird nicht von allen Forschem anerkannt. Es bezeichnet keine
Geschehensrichtung im Gegensatz zum Aktiv und zum Passiv, sondern
den Zustand des Satzsubjekts, der infolge einer abgeschlossenen Hand-
lung eingetreten ist [s. Riesel, Schendels, 1975, 132}.
Es ist bekannt, dass nicht alle Verben passivfähig sind. Die Ein-
schränkungen sind mit ihrer lexikalischen Bedeutung verbunden. Eine
besondere stilistische Wirkung haben aber die passivunfähigen Verben,
die trotzdem im Passiv gebraucht werden: Er wurde gegangen bedeutet,
dass der Mensch den Raum oder seine Dienststelle nicht freiwillig ver-
lassen hat. Solche Fälle behandelt man als eine Abweichung von
der grammatischen Norm undbetont, dasssie in der Sachpro-
sa unzulässig sind [vgl. Fleischer, Michel, 1977, 142}.
Man unterscheidet, wie bekannt, drei Passivstrukturen: (1) das drei-
gliedrige, (2) das zweigliedrige und (3) das eingliedrige Passiv. Jede Pas-
sivstruktur hat ihre stilistischen Leistungen.
1. Das dreigliedrige Passiv ist dadurch gekennzeichnet, dass sich in
dieser Konstruktion die Blickpunktrichtung ändert: Das Passiv schafft
eine rückläufige Darstellungsperspektive: das Objekt der Handlung
(Patiens) <- Handlung <- Urheber (Täter, Agens). Der aktive Satz ver-
249
folgt also den Verlauf der Handlung von seinem Ausgangspunkt zu sei-
nem Ziel. Der passive Satz geht vom Ende der Handlung, vom Ab-
schluss ihres Verlaufs her an den Sachverhalt heran. Das Satzsubjekt ist
in der Regel der Gegenstand der Äußerung und besitzt Themawert.
Dem Objekt kommt der Rhemawert zu. Da im passiven Satz das Satzob-
jekt Agens ist, verleiht ihm der passive Satz einen größeren semantischen
Wert. Außerdem verfugen das Passiv und das Stativ über die Opposition
von + Dat/durch + Akk. Mit den Semen „Urheber der Handlung/Ver-
mittler der Handlung“. Die Präposition „von“ gebraucht man vorwie-
gend für die Personenbezeichnung und „durch“ für die Gegenstandsbe-
zeichnung. In der Stilistik ist der Gebrauch der Opposition „von/durch“
anders auszuwerten: „von“ kann Naturerscheinungen als unabhängig
vom Menschenwillen wirkende, selbstständige Kräfte darstellen. Gefüh-
le, Empfindungen, Stimmungen erscheinen im passivischen Satz mit
der Präposition „von“, sowie auch Gegenstände, die aktiviert werden
sollen. Zur Verminderung der Aktivität des Agens dient die Präposition
„durch“ [s. Riesel, Schendels, 1975, 133—135\-,
Also lautete der öffentliche Aufruf: „Es soll in einem Wettstreit festgestellt
werden, wer die schönste Stimme hat...“ Als erste schlug die Nachtigall, und es
gab niemanden im Tal, dessen Herz von ihrer Stimme nicht gerührt worden
wäre. (K. Kauter. „Die Schwere des Richteramtes“)
Es... besteht die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit der Zuschauer ganz von
der visuellen Komik in Anspruch genommen wird... (J. Plank. „Bildschirm: Vi-
deo mit Köpfchen“)
Dann wurde die Eingabe durch einen reitenden Boten in die Stadt gesandt.
(Th. Storm)
2. Das zweigliedrige Passiv und das Stativ werden als Idealformen für
den Stil der Sachprosa anerkannt. In diesen Texten braucht der Ur-
heber der Handlung oft nicht genannt zu werden. Feststellungen, Be-
schreibungen, Denkresultate, Ergebnisse von Versuchen sind hier von
Belang. So lesen wir in einem wissenschaftlichen Beitrag:
...Sprache und Politik, Sprache und Wissenschaft, Sprache und Technik
sind als wichtige Kommunikationsbereiche und -anforderungen der Gegen-
wartssprache in die Überlegungen teilweise einbezogen worden, nicht aber ex-
plizierend angegangen; Lernbeziehungen sind kaum erwähnt worden; über
Norm und Variabilität wird manches im Konkreten ausgeföhrt, ohne die theo-
retischen Fragen aufzugreifen... („ZfG“, 4/80)
Diese Äußerung ist durch einen trockenen, offiziellen,
sachlichen Stil gekennzeichnet. Es wäre überflüssig, den Urheber
der Handlung zu nennen: da er nicht im Mittelpunkt der Äußerung
steht.
Im Vergleich zum Passiv bringt das Stativ weniger Bewegung und Le-
bendigkeit in die Schilderung, es „malt Ruhelage“ [s. Riesel, Schendels,
1975, 137}. Es betont den Abschluss oder das Ergebnis einer Handlung.
So beginnt zum Beispiel eine Miniatur von A. Seghers:
250
Der Baum des Odysseus
Sogar dieser Tag war zu Ende gegangen. Die toten Freier waren fortgetra-
gen, die Pfeile eingesammelt, das Blut war aufgewaschen. Mann und Frau sitzen
zum erstenmal wieder am Feuer beisammen wie in den alten Zeiten. Noch ein-
mal werfen die Götter auf dieses Paar einen letzten, schon gleichgültigen
Blick...
Vor den Augen des Lesers entsteht ein statisches Bild, eine „Ru-
helage“, die das Stativ schafft. Es entsteht der Eindruck, als ob wir Leser
der Schlussszene eines Trauerspiels beiwohnen: die Handlung ist abge-
schlossen und nun haben wir das Ergebnis.
3. Das eingliedrige Passiv stellt die Handlung isoliert von ihrem Trä-
ger dar: Es wird gelacht. Stilistisch gesehen, wird das eingliedrige Passiv
oft als Mittel der Entpersonifizierung gebraucht. In der Regel
erscheinen in dieser Struktur die Verben der menschlichen Tätigkeit:
Der Herr, den ich eben angestoßen hatte, kam mir empört nach. Ich ver-
stecke mich hinter Papa.
„Lausebengel, ich klebe dir eine...“
„Halt, hier wird nicht geklebt.“ (G. Holtz-Baumert. „Zitterbacke“)
Das Passiv dient hier also zur Hervorhebung des Vorgangs. Der Satz
bekommt den Charakter einer Verallgemeinerung.
Das eingliedrige (unpersönliche) Passiv dient häufig zum Ausdruck
eines kategorischen Befe hls: Es wird geschlafen).
Es kann auch die Dauer, Wiederholung oder Beständigkeit eines Vor-
gangs zum Ausdruck bringen.
§ 56. Die Interjektion
Die Interjektion dient bekanntlich zum Ausdruck von Gefühlen,
Empfindungen, Stimmungen, Willensäußerungen, ohne diese zu nen-
nen. Nach H. We i n r i c h sind sie sprachliche Zeichen, deren Bedeu-
tung darin besteht, beim Hörer ein lebhaftes Interesse für die gegebene
Situation zu erzeugen [vgl. Weinrich, 2003, 557],
Es ist auch bekannt, dass beim Gebrauch der Inteijektionen Ein-
schränkungen existieren: Inteijektionen sind n u r in Situationen zuge-
lassen, wo eine expressive, emotional gefärbte Rede angemessen ist.
Solche Situationen finden sich in der Alltagsrede und der schön-
geistigen Literatur.Im Stil der Wissenschaft und des öffentlichen
Verkehrs sind sie kaum anzutreffen. Zwischen diesen polaren Positionen
befindet sich der Stil der Presse und der Publizistik. Einige
Genres, die eine emotionale, unbefangene Rede nachahmen, können
den Gebrauch von „ach!“, „hurra!“, „pst!“ u.a. zulassen.
Bei der Übersetzung von Texten mit Inteijektionen muss man sich
gut in der Zielsprache auskennen, um die richtigen Entsprechungen zu
251
finden, denn Interjektionen sind kulturspezifisch. Vergleichen
wir das deutsche „öw!“ und das russische «ou!», das deutsche „hat-
schi!“, das russische «annxul», das japanische „gi/gid“ miteinander
oder das deutsche „miau“, das russische «May», das englische „meoiv*
und das chinesische „mao“ und wir verstehen, dass sie eine unentbehr-
liche Schicht unseres Hintergrundwissens bilden, wenn wir uns mit ei-
ner Fremdsprache beschäftigen oder zu einem fremdsprachigen Text
greifen.
Man klassifiziert die Interjektionen auf verschiedene Weise. So teilt
sie H. Weinrich in drei Gruppen ein:
1) situative Interjektionen — sie weisen den Hörer auf die Situation
hin und reklamieren dafür sein Interesse: hallo\, he\,pst\, halft,
2) expressive Inteijektionen — der Sprecher gibt mehr oder weniger
intensiv eine Gefühlslage zu erkennen und versucht ein emotionales In-
teresse beim Hörer zu erzeugen; das sind Lautkomplexe, die sonst nicht
als sprachliche Zeichen gebraucht werden: ah\, oh\, oje\-,
3) imitative Inteijektionen — das sind onomatopoetische Ausdrucks-
mittel; man „malt“ mit ihnen charakteristische Geräusche und Bewe-
gungen: hatschft schivups\, peng\ [s. Weinrich, 2003, 858—861}.
In der Wortart „Inteijektion“ können auch gattungstypische Varian-
ten ausgesondert werden. So erscheinen z.B. in Comics Inteijektio-
nen, die aus verkürzten Imperativen gebildet sind: ächz\ (Stöhnen);
würg\ (Ekel); seufz\ (Klage). Sie werden im jugendsprachlichen Register
gelegentlich auch mündlich gebraucht (ebenda).
Stark verbreitet sind Interjektionen in der Volkspoesie. Beson-
ders oft handelt es sich um imitative (onomatopoetische) Inteijek-
tionen. So finden wir in einem Volksrä tse/:
Pumpum! Pitschpatsch! In den Straßen,
Zickzack! Krachkrach! In den Gassen:
Sag mir, was
Ist denn das?
(Das Gewitter. Wind, Regen, Blitz und Donner)
Obwohl die Inteijektionen Gefühle und Empfindungen ausdrücken,
ohne sie zu nennen, können sie einen zusätzlichen Sinn in den Text
bringen. So können wir das folgende Gedicht von Rudolf Otto Wiemer
nur richtig interpretieren, wenn wir genau wissen, welches Gefühl und
welche Empfindung hinter jeder Interjektion stecken (wir behalten die
originelle Schreibung des Autors bei):
empfindungswörter
aha die deutschen
ei die deutschen
hurra die deutschen
pfui die deutschen
ach die deutschen
252
nanu die deutschen
oho die deutschen
hm die deutschen
nein die deutschen
ja ja die deutschen
Literaturnachweis
1. Bentzien U., Burde-Schneidewind G. u.a. Deutsche Volksdichtung. —
Leipzig, 1987.
2. Brinkmann H. Die deutsche Sprache: Gestalt und Leistung. — Düssel-
dorf, 1971.
3. Erben J. Deutsche Grammatik: Ein Abriß. — München, 1972.
4. Faulseit D., Kühn G. Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen
Sprache. — Leipzig, 1975.
5. Fleischer W.9 Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —
Leipzig, 1977.
6. Glinz H. Der deutsche Satz. Wortarten und Satzglieder wissenschaftlich
gefaßt und dichterisch gedeutet. — 4. Aufl. — Düsseldorf, 1965.
7. Hallwass E. Gutes Deutsch in allen Lebenslagen. — Düsseldorf; Wien.
8. Harweg H. Pronomina und Textkonstitution. — München, 1968.
9. Hillich R. „Ole Bienkopp“ — eine wichtige Zäsur in Strittmatters Schaf-
fen // Analysen, Erörterungen, Gespräche / E. Strittmatter. — Berlin, 1977.
10. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. — M., 1975.
11. Schendels E. I. Der Artikel als Gestaltungsmittel der Polyphonie im Wort-
kunstwerk// Zeitschrift für Germanistik. — 1981. — H. 3. — S. 314—321.
12. Schendels E.I. Deutsche Grammatik: Morphologie. Syntax. Text. —
M., 1988.
13. Schendels E.I. Die Kategorie Mensch in der deutschen Gegenwarts-
sprache // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-
forschung. - 1980. - Bd. 33. - H. 3. - S. 371-378.
14. Schneider PK Stilistische deutsche Grammatik. — Wien, 1963.
15. Weinrich H. Sprache in Texten. — Stuttgart, 1976.
16. Weinrich H. Textgrammatik der deutschen Sprache. — 2. Aufl. — Hil-
desheim; Zürich; New York, 2003.
17. Weinrich H. Wege der Sprachkultur. — Stuttgart, 1985.
18. AÖMOHU B. fl03TKKa K «ZjeMCTBKTejIbHOCTb. — JI., 1975.
19. BopOHUH C.B. OCHOBH 4>OHOCeMaHTKKK. — JI., 1982.
20. Bopohuh C. B. OoHoceMaHTmiccKHc nzjeii b aapyöcxHOM H3biKO3HaHmi:
OqepKW K K3BJie<ieHKH. — JI., 1990.
21. ramaynuHa E.X. PasroBopHo-oKpaiueHHbie aöcTpaKTHbie HOMUHauuu b
coßpeMeHHOM HeMeijKOM «3biKe: AßTope^)- OTC.... Kann. (Jmjioji. HayK. — M.,
2001.
22. Fuh fl. J7. IIosTKKa rpaMMaTK<iecKoro po^a. — fleTposaBOflCK, 1992.
23. XCypaenee A.TI. Oohctu^cckoc 3HaneHKe. — JI., 1974.
24. JhoKUHa E. B. HoMKHaTKBHoe npoerpaHCTBo (JpaaeojioruHecKKx ejjKHKij
c KOMnOHeHTaMM UBeTOOÖO3Ha<ieHKH B HeMeUKOM K aHDIKMCKOM H3bIKaX (KOr-
HUTKBHO-HOMKHaTKBHblM aCneKT): AßTOpCcJ). JJKC. ... Kami. 4)KJIOJI. HayK. — M.,
2004.
253
25. CwibMQH T. H. CrpyKTypHbie ocoGchhocth jiMpMHecKMX bcthbok npo~
3anneCKoro tckcth // IlpoßjieMbi jiMHrBMCTMHecKOM cthjihcthkh: Marepna-
jih HaynHOM KOH^epeHijHH. — M.» 1969. — C. 132— 133.
26. Cjioßapb jiHTepaTypoBonnecKHX TepMMHOB / IToa pejj. JI.H.TnMO^eeBa
m C.B.Typaeßa. — M., 1974.
27. Cjioßapb cjioBooßpaaoBHTejibHbix sjicmchtob HeMeijKoro H3bixa / Ilo/j
pyx. M.fl.CrenaHOBOM. — M., 1979.
28. CmenaHoe IO. C. CeMaHTHKa «UBeTHoro coHera» ApTiopa PeMÖo // Hsb.
AH CCCP. CepriH jiKTeparypbi m H3biKa. — 1984. — T. 3. — N° 4. — C. 341—347.
29. IIuebRH T.B. KaTeropHH onpejjejieHHocTH — HeonpejjejieHHocTH b
CTpyKType BOjinießHoii CKa3Kn: (Ha MaTepnajie aJißaHCKOM CKa3Kn) // KaTero-
pn$i onpejjejieHHocTH —HeonpeflejieHHocTH b cjiaBHHCKHX k ßajiKaHCKHx h3bi-
Kax. - M., 1979. - C. 330.
30. 3ko y. LUecTb nporyjioK b JiwrepaTypHbix Jiecax. — CII6., 2002.
Kapitel 12
SYNTAKTISCHE EINHEITEN IM TEXT
UND IHRE STILWERTE
§ 57. Der Satz. Der Satzumfang
Bekanntermaßen existieren mehrere Klassifikationen der Sätze. Je
nach dem Prinzip, das der Einteilung zu Grunde gelegt wird, unter-
scheidet man Aussage-, Frage- und Befehlssätze (nach der Redeab-
sicht), emotionale und neutrale Sätze, positive und negative Sätze, ein-
fache und komplexe Sätze, persönliche und unpersönliche Sätze. Aus
stilistischer Sicht sind nicht alle Charakteristiken wesentlich. Wir wer-
den deshalb nur einige davon näher betrachten.
Lange Zeit galt der Satz nicht nur als größte Spracheinheit, sondern
auch als größte kommunikative Einheit. Erst mit der Entwicklung der
Textlinguistik geriet der Text in den Mittelpunkt der Untersuchung der
menschlichen Rede. Heute spricht man schon über den Diskurs, der
den Rahmen eines Textes überschreitet. Der Satz bleibt aber nach wie
vor Objekt linguistischer Forschungen und wird als Bestandteil des Tex-
tes behandelt. Im Folgenden wenden wir uns einigen Charakteristiken
des Satzes zu.
Die Länge und die Kürze der Sätze hängen nicht nur vom Aus-
druckswillen der Schriftsteller und von den Gegenständen ihrer Darstel-
lung ab, sondern auch vom Zeitgeschmack, behauptet W.Schnei-
der. In der erzählenden Prosa, schreibt er, ist von den Romanen des Ba-
rocks und Wielands über Goethe, Keller und Fontane bis zum impres-
sionistischen Roman im Allgemeinen eine Abnahme langer Perioden zu
Gunsten kurzer Sätze zu beobachten. Der Gegenwartsroman, der unter
254
dem Einfluss der Umgangssprache steht, liebt die Kurzsätzigkeit
[s. Schneider, 1963, 434].
Als Beweise dafür führen wir einige Beispiele an. Zuerst einen
Satz aus G. Kellers (1819— 1890) Novelle „Romeo und Julia auf dem
Dorfe“:
Wie nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufrie-
denem Wohlwollen den Kindern mitteilten, die nicht von der Stelle wichen,
solange gegessen und getrunken wurde, ließen sie ihre Blicke in der Nähe und
Ferne herumschweifen und sahen das Städtchen räucherig glänzend in seinen
Bergen liegen; denn das reichliche Mittagsmahl, welches die Seldwyler alle
Tage bereiteten, pflegte ein weithin scheinendes Silbergewölk über die Dächer
emporzutragen, welches lachend an ihren Bergen hinschwebte.
Die angeführte Satzperiode, die aus 72 Wörtern besteht, bestimmt
das Tempo des Erzählens: langsam entfaltet sich dieser kunstvoll aufge-
baute Satz, und der Blick des Autors streicht um die Menschen, schweift
in die Berge und steigt zum Himmel empor, als ob die Menschen, die
Berge und der Himmel harmonisch miteinander verbunden wären und
ein Ganzes bildeten.
Ein anderes Beispiel stammt aus dem Roman von Chr.Wolf (geb.
1929) „Kindheitsmuster“:
Wer Hand an seine Kindheit legt, sollte nicht hoffen, zügig voranzukom-
men. Vergebens wird er nach einer Dienststelle suchen, die ihm ersehnte Ge-
nehmigung gäbe zu einem Unterfangen, gegen das der grenzüberschreitende
Reiseverkehr — nur als Beispiel — harmlos ist. Das Schuldgefühl, das Hand-
lungen wider der Natur begleitet, ist ihm sicher: Natürlich ist es, dass Kinder
ihren Eltern zeitlebens dankbar sind für die glückliche Kindheit, die sie ihnen
bereitet haben, und dass sie nicht daran tippen.
Dieser Absatz besteht aus 73 Wörtern und vier Sätzen. Er hat also fast
denselben Umfang wie der von Keller, besteht aber nicht aus einem
Satz. Das zeigt, dass die Behauptung von W. Schneider über die Abnah-
me der Satzperioden stimmt.
Das Streben nach Kurzsätzigkeit setzte sich in der Zeit des I m-
pressionismus durch. In der Geschichte der Malerei wurde die
Skizze nicht als Vorarbeit, sondern als selbstständiges Kunstwerk be-
trachtet. In der Literatur war auch die skizzenhafte Kleinform be-
liebt. Das Unfertige, nicht Durchgeformte, Skizzenhafte hat den
Reiz von Andeutungen und Anspielungen. Beispielhaft dafür waren
die Werke von Liliencron, P. Altenberg, A. Schnitzler u.a. [s. Schnei-
der, 1963, 440—441]. In unserer Zeit beobachten wir das Fort-
schreiten dieser Tendenz. Die Zeit der großen literarischen Formen
(der Epopöe, des Romans) ist vorbei. In den Vordergrund treten
Kurzformen, die unter den literarischen Formen immer mehr Platz
gewinnen.
Die Kurzgeschichte und die Miniatur entsprechen wohl besser dem
Gedankenlauf und der Ausdrucksweise der modernen Autoren, obwohl
255
die Erzählung und die Novelle heute ihre Bedeutung nicht verloren ha-
ben.
Die Kleinform verlangt auch eine andere Sprache. Zwar finden wir
noch bei Franz Kafka (1883— 1924) unter seinen Miniaturen, die er
Erzählungen nannte, Texte, die aus zwei Sprachperioden bestehen,
aber sie sind auch nicht mehr so lang, wie es im 19. Jahrhundert üblich
war:
Das Gassenfenster
Wer verlassen lebt und sich doch hier und da anschließen möchte, wer mit
Rücksicht auf die Veränderungen der Tageszeit, der Witterung, der Berufsver-
hältnisse und dergleichen ohne weiteres irgendeinen beliebigen Arm sehen will,
an dem er sich halten könnte — der wird es ohne Gassenfenster nicht lange
treiben. Und steht es mit ihm so, daß er gar nichts sucht und nur als müder
Mann, die Augen auf und ab zwischen Publikum und Himmel, an seine Fens-
terbrüstung tritt, und er will nicht und hat ein wenig den Kopf zurückgeneigt,
so reißen ihn doch unten die Pferde mit in ihr Gefolge von Wagen und Lärm
und damit endlich der menschlichen Eintracht zu.
Diesen Texten wurden künstlerische Geschlossenheit
und Vo 11 e n d u n g zugesprochen. Ihr sentenzartiger Charakter dik-
tiert die Wähl der Sprachmittel. Das Satzsubjekt wird durch das Prono-
men ausgedrückt. In den Sätzen werden viele Abstrakta gebraucht. Das
Prädikat steht im generalisierenden Präsens. Diese Sprachmittel messen
dem Text einen verallgemeinernden Charakter bei. Die Sätze sind leicht
zu erfassen und leicht zu behalten.
In der modernen Pro s a finden wir auch kürzere Sätze:
Ich kann meinem Lehrer nicht helfen, wenn es soweit ist. Ich kann mich
nicht flach machen wie Wasser und in sein Haus dringen. Das ist der Herbst,
hat mein Lehrer gesagt, Vater und Mutter sind fort. Wie sich die Berge hinzie-
hen mit ihren Namen, als liefe einer dem Namen des anderen nach. (J.Aichin-
ger. „Der Bastard“)
Heute begegnen wir auch den so genannten „Kürzestgeschichten“,
wie z. B. bei E. Strittmatter in seinem „Schulzenhofer Kramkalender":
Roman
Mein Roman ist der große Bruder dieser kleinen Geschichten. Er ist eifer-
süchtig und stößt mich: Immer die Kleinen!
Dieser Ganztext ist ein Sonderfall, besteht aber aus zweigliedrigen
Sätzen. Er ist einer Notiz aus dem Tagebuch ähnlich, die später überlegt
und vielleicht weiterentwickelt werden soll.
Die tägliche Umgangssprache bevorzugtkurzenebengeord-
nete Sätze, schreibt W. Schneider. Ihre Verwendung in Romanen und
Novellen ist nicht nur auf das Gespräch beschränkt und „greift auch auf
den epischen Bericht über“. Das wirkt flüchtig, ungepflegt, nachlässig
und oberflächlig [vgl. Schneider, 1963, 440].
256
In den anderen Genres — Notizen, Skizzen, Aufzeichnun-
gen — können kurze Sätze auch einem anderen Ziel dienen, z.B. der
Beschleunigung des Tempos. So empfinden wir die Hast des
Autors, wenn wir die folgenden Sätze lesen:
Gittertür, erstes Schloss, zweites, drittes — schnell auf und zu und rein. Bin
soeben aus dem Schneetreiben nach Hause gekommen. Gashahn auf, nein, so
schlimm ist es noch nicht, nur für einen Tee, mit einem kleinen Schuss. Das
wird herrlich. Und wieder den Braunbären auf der Straße entwischt... Klischee
im Schnee. (Z. Kuntzsch. „Kleines Sibirisches Tagebuch“)
Zum Schaffen dieses hektischen Tempos trägt das Weglassen der Ver-
ben in den meisten Sätzen und des Pronomens „ich“ im zweiten Satz
bei. Dadurch entsteht die Dynamik, die der Autor anstrebt.
Der Hang der modernen Literatur zur Verkürzung des Satzumfangs
wird durch folgende Gründe erklärt:
1) durch den Einfluss der Umgangssprache, den wir schon betont
haben;
2) durch die mündliche Aufnahme der Information aus den Massen-
medien;
3) durch das Streben nach Lakonismus [vgl. Riesel, Schendels, 1975,
164].
Aber W. Schneider, der über die Vorliebe des Gegenwartsromans zur
Kurzsätzigkeit schrieb und so eingehend die Rolle des kurzen Satzes in
der Stilistik untersuchte, konnte sich wohl kaum vorstellen, dass die
Sprache mancher deutscher und österreichischer Autoren sozusagen in
eine „Satzlosigkeit“ ausartet. Als Beispiel führen wir ein Gedicht von
Ernst Jandl an:
da busch
buschda
dabusch
buschdada busch
buschdada
buschdabusch buschda
buschdadada
buschdabusch buschdada buschdadada
buschdadadada busch
da
daa
daaa
daaaa
daaaaa
daaaaaa
daaaaaaa
buschdabusch buschbuschbusch buschdada
buschdabusch buschdada
buschdada
bsch
9 EoraTbipeoa 257
Es ist die Sache der Literaturforscher, zu bestimmen, zu welchem
Genre dieser Text gehört und ob er überhaupt zum Stil der schöngeisti-
gen Literatur gezählt werden kann. Der Autor selbst nennt seine Werke
„Gedichte“ und lässt sie unter dem Gesamttitel „Sprechblasen“ veröf-
fentlichen. Wir können nur feststellen, dass der deutsche Satz, so wie er
in der Grammatik definiert wird und in der Regel einen Sachverhalt be-
zeichnet, in diesem Fall nicht vorhanden ist. Die Anhänger solcher
Dichtungen behaupten, dass der Autor dank dieser Form dem Leser
mehr Freiheit gibt, den Inhalt zu deuten und seine Fantasie zu
entwickeln.
Der Satzumfang hängt natürlich von dem Funktionalstil, der literari-
schen Richtung und dem Individualstil ab. Empirische Angaben ergeben,
dass der mittlere Umfang eines deutschen Satzes 22,1 Wörter zählt. Je
nach den Funktionalstilen schwankt diese Zahl von 27,8 in der philoso-
phischen Literatur bis 19,3 in der Dichtersprache. In einigen Textsorten
kann die Wortzahl noch niedriger sein [s. Riesel, Schendels, 1975, 164\.
Im belletristischen Text kann der Satzumfang mit anderen
stilistischen Mitteln zum Schaffen eines Bildes beitragen. Beweisen wir
das am Beispiel einer lyrischen Miniatur vom E. Strittmatter:
Die Schwäne
Neun junge Schwäne waren’s im Mai, acht waren’s im Juni, sechs im Sep-
tember. Wer hat drei Schwäne vom See gerissen? Der Habicht, die Weihe, ein
großer Hecht?
Das Leben hat die Schwäne gerissen. Der Mensch sagt dem Leben nichts
Böses nach. Er nennt die Fraßgier des Lebens — den Tod.
Der Textanfang ist ein komplexer Satz, der aus drei Teilsätzen besteht.
Es wird mitgeteilt, wie schnell sich die Zahl der Schwäne verringert: je
näher der Herbst, desto weniger Schwäne bleiben auf dem See. Die Nu-
meralien, die ihre Zahl bezeichnen, kommen in der Reihenfolge: neun—
acht—sechs. Der Gedanke über das Verschwinden der Schwäne wird
durch ein syntaktisches Mittel unterstützt — durch die Reduzierung
des Satzumfangs: der erste Bestandteil des Satzes ist ein zweiglied-
riger erweiterter Satz, der aus sechs Gliedern besteht. Der zweite Teil ist
kürzer und enthält nur vier Glieder, der dritte Teil ist der kürzeste und be-
steht nur aus zwei Satzgliedern. Die Numeralien, die in absteigender Li-
nie im Text erscheinen, und die reduzierte Satzstruktur unterstützen ei-
nander und wirken bei der Entstehung des künstlerischen Bildes — eines
leer werdenden Sees, eines Xfergehens — zusammen.
Selbstverständlich ist die Sprache der Wissenschaft weni-
ger emotionell und mehr auf das Lesen (ein Artikel) oder auf ein kon-
zentriertes Hören (ein Vortrag) gerichtet. Der Satzumfang ist viel größer
und lässt kein Spiel mit der Satzstruktur zu. Dazu ein Beispiel aus einem
wissenschaftlichen Artikel:
Auch im Zentrum unserer Überlegungen in diesem Aufsatz steht die Frage
nach einer präzisierten Wesensbestimmung des Kompositionsbegriffs und nach
258
Möglichkeiten einer kategorialen Ausgrenzung von kompositorischen Einhei-
ten, ohne dass damit alles, was den Charakter von Elementen und Relationen
im Rahmen eines strukturierten Ganzen hat, als „kompositorisch“ qualifiziert
werden soll. (G. Michel)
Dabei ist die Umgangssprache durch kurze Sätze gekenn-
zeichnet. Das können wir an einem Fragment des Telefongesprächs aus
dem Buch von R. Brons-Albert „Standarddeutsch“ sehen:
A und B kennen sich nicht, B wohnt in derselben Wohngemeinschaft wie eine
Kommilitonin von A.
A'. Guten Tag, hier ist A. Ist die X da?
B\ Nee, die is nich da, die is im Moment, ich glaube in Hilden oder so, bei
ihrem Freund.
A: Ah so...
B: Die wird also in den nächsten 2 — 3 Wochen kaum hier auftauchen.
A: Ah so! Ehm, was is denn/hat denn der Freund bestanden?
B: Der ist ja noch nicht fertig.
A: Der ist ja noch nicht fertig?
B: Nee, ich glaub, der hat die mündlichen Prüfungen noch vor sich!...
Die Satzstruktur ist in diesem Gespräch locker. Einige Sätze werden
nicht einmal bis zu Ende ausgesprochen. Dem Umfang nach sind sie
alle kurz, was dem Alltagsgespräch eigen ist.
§ 58. Wiederholung der Satzstruktur
In dem angeführten Telefongespräch begegnen wir der stilistischen
Figur „Wiederholung“. Besonders oft greifen zu diesem Stilmittel Auto-
ren in belletristischen Texten. Man kann drei Arten der Wiederholung
unterscheiden:
a) eine vollständige Wederholung des Satzes, bei der nicht nur die
syntaktische Struktur, sondern auch die lexikalische Füllung des Satzes
wiederholt wird;
b) die Wederholung eines Teils des Satzes;
c) die Wiederholung des syntaktischen Satzmodells bei unterschied-
licher lexikalischer Füllung.
1. Eine vollständige Wiederholung des Satzes treffen wir besonders oft
in belletristischen Texten, in erster Linie in Texten mit lyri-
schem Charakter. Wenden wir uns nun einem konkreten Text zu, einer
lyrischen Miniatur von E. Strittmatter aus seinem Buch „Schulzenhofer
Kramkalender“:
Verwirrung
Es war noch dunkel. Ich ritt in den Morgen. Der Rauhreif stand starr, und
die Bäume knallten im Wald. Ein hungriger Hase hockte am Wege und fraß ver-
dorrte Grasnelkenstengel. Seit fünfzehn Tagen hatten wir Frost.
259
Ein Fuchs schlich den arglosen Hasen an. Ich scheuchte den Hasen, er
sprang in den Busch. Die Stute erschrak, sie wendete, wollte davon. Ich zügelte
sie im singenden Schnee.
Auf dem See barst das Eis. Grüne Sterne starren ins Schilf, es klirrte wie
Glas, und es brach, wenn mein Bügel es streifte. Seit fünfzehn Tagen hatten wir
Frost.
Im matten Frühdunst ritt ich zurück. Die Häuser hockten hinter befreiten
Bäumen; ihre Fenster waren hinter Läden verkrochen. Im Stall brannte Licht.
Der Pferdemeister war fröhlich und sagte: „Zu Mittag wird’s taun, der Wind
kommt südwest. Ich hörte den Fünfuhrzug hinterm Wald.“
Ich kam von draußen und wußte es anders: der Wind kam aus Ost. — Die
Hoffnung hatte den Meister verwirrt. Seit fünfzehn Tagen hatten wir Frost,
Diesen Text durchdringen einige Topikketten, die Textteile mitei-
nander verbinden. Er unterscheidet sich aber von anderen Miniaturen
dadurch, dass sich an seiner Isotopie nicht nur einzelne Lexeme beteili-
gen, sondern ganze Sätze mit der vollen Wiederholung des Satzmodells
und seiner lexikalischen Füllung.
Solch ein mehrmals wiederholter Satz spielt die Rolle des Refrains:
„Seit fünfzehn Tagen hatten wir Frost“. Bei der Wederholung erfüllt
er die anaphorische Funktion, d. h. er verweist auf die Ersterwäh-
nung dieses Satzes und stellt die Verbindung zwischen den Absätzen
her. Vereinzelte, scheinbar voneinander unabhängige Tatsachen — er-
starrte Bäume, der vor Hunger arglos gewordene Hase, das klirrende
Schilf, die hinter den verschneiten Bäumen hockenden Häuser, die
verwirrten Menschen — werden inhaltlich durch den Refrain verbun-
den. Er nennt den Grund dieser merkwürdigen Veränderungen in der
Natur: „Frost“.
Mit dem Refrain wird in den Text auch die subjektive Einschätzung
des Autors hineingebracht, denn bei jeder Wederholung bekommt die-
ser Satz einen zusätzlichen Inhalt. So erwirbt er am Ende des ers-
ten Absatzes den Untertext: der Frost war hart. Am Ende des dritten Ab-
satzes kommt der neue Untertext hinzu: der Frost ist ein Zauberer, der
Wunder vollbringt. Am Ende des fünften Absatzes tritt er auch in der
Rolle des Textschlusses auf und teilt mit, dass nicht nur die Natur, son-
dern auch die Menschen vor Frost müde sind — so lange dauerte er.
Der Refrain bildet auch eine Grenze zwischen den kompositionellen
Teilen des Textes, die thematisch selbstständig sind. Er signalisiert den
Abschluss eines Themas und den Beginn eines neuen. Er dient also als
Mittel der Textsegmentierung.
Einer vollen Wederholung begegnen wir im schon zitierten Roman
von E. Strittmatter „Ole Bienkopp“, wo der Satz Die Erde reist durch den
Weltraum mehrmals wiederholt wird und als Verflechtungsmittel im
Rahmen des Ganztextes auftritt. Er bildet eine Isotopiekette, die
aus den Teilen des Textes eine Ganzheit bildet.
Ein anderes Beispiel für die Wederholung der Satzstruktur finden
wir im Gedicht von G. Trakl:
260
Rondel
Verflossen ist das Gold der Tage,
Des Abends braun und blau Farben:
Des Hirten sanfte Flöten starben
Des Abends braun und blau Farben
Verflossen ist das Gold der Tage.
Dieses Gedicht ist nach dem Prinzip des Chiasmus (der Kreuzfigur)
aufgebaut. Der zweite Teil des Gedichtes besteht nicht nur aus den Wie-
derholungen. Es ist vielmehr das Spiegelbild des ersten Teils. Eine Deu-
tung der Gedichte von Trakl ist schwer: sie sind originell und rätselhaft.
Sie zeugen vom Streben seiner Seele nach Schönheit, von der Sehnsucht
nach der verlorenen Harmonie. Dieses Streben können wir auch in dem
angeführten Gedicht verfolgen: der Chiasmus verleiht dem Text einen
rhythmischen Wert und eine bestimmte architektonische Klarheit und
Eleganz. Die Kreuzfigur macht die Struktur des Gedichtes vollendet
schön und geschlossen.
2. Die Wiederholung eines Satzteils kann einige Arten des Paralle-
1 i s m u s hervorrufen. Die Wederholung der Satzstruktur wird oft durch
die Wederholung einiger Lexeme begleitet. Dabei wird nicht unbedingt
der ganze lexikalische Bestand des Satzes wiederholt. Es können nur eini-
ge Positionen sein, die in verschiedenen Sätzen ähnlich sind. Das reicht
aber schon für die Entstehung des Parallelismus der ersten und der letzten
Stelle im Satz. Wenden wir uns einem konkreten Text zu:
Archimedes suchte, für die physikalische Welt, den einen festen Punkt, von
dem aus er sich’s zutraute, sie aus den Angeln zu heben. Die soziale, morali-
sche und politische Welt, die Welt der Menschen nicht aus den Angeln, sondern
in die rechten Angeln hineinzuheben, dafür gibt es in jedem von uns mehr als
einen archimedischen Punkt. Vier dieser Punkte möchte ich aufzählen.
Punkt 1: Jeder Mensch höre auf sein Gewissen] Das ist möglich. Denn er
besitzt eines. Diese Uhr kann man weder aus Versehen verlieren, noch mutwil-
lig zertrampeln. Diese Uhr mag leiser oder lauter ticken — sie geht stets richtig.
Nur wir gehen manchmal verkehrt.
Punkt 2: Jeder Mensch suche sich Vorbilder] Das ist möglich. Denn es exis-
tieren welche. Und es ist unwichtig, ob es sich dabei um einen großen toten
Dichter, um Mahatma Gandi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt,
wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wmperzucken
das gesagt und getan hätte, wovor wir zögern. Das Vorbild ist ein Kompass, der
sich nicht irrt und uns Weg und Ziel weist.
Punkt 3: Jeder Mensch gedenke immer seiner Kindheit] Das ist möglich.
Denn er hat ein Gedächtnis. Die Kindheit ist das stille, reine Licht, das aus der
eigenen Vergangenheit tröstlich in die Gegenwart und Zukunft hinüberleuch-
tet. Sich der Kindheit wahrhaft erinnern, das heißt: plötzlich und ohne langes
Überlegen wieder wissen, was echt und falsch, was gut und böse ist... Die Kind-
heit ist unser Leuchtturm.
Punkt 4: Jeder Mensch erwerbe sich Humor] Das ist nicht unmöglich.
Denn immer und überall ist es einigen gelungen. Der Humor rückt den Augen-
261
blick an die richtige Stelle. Er lehrt uns die wahre Größenordnung und die gül-
tige Perspektive. Er macht die Erde zu einem kleinen Stern, die Weltgeschichte
zu einem Atemzug und uns selber bescheiden. Das ist viel. (Erich Kästner)
In dem angeführten Text fangen alle Absätze außer dem ersten mit
dem Substantiv „Punkt“ an. Die ersten Sätze haben eine ähnliche syn-
taktische Struktur (Sh Vf S) und eine lexikalische Wiederholung „Jeder
Mensch“. Dank dieser Wiederholung entsteht der Parallelismus der ers-
ten Stelle, der die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Teilen des Textes und auf die Weiterentwicklung
des Themas lenkt („archimedische Punkte“ in jedem Menschen). Da-
durch wird die Isotopie des Textes verstärkt und deutlich gemacht und
der Textzusammenhang gesichert. Einen großen Beitrag leisten dazu
auch die Numeralien. Sie erfüllen sowohl eine anaphorische als auch
eine kataphorische Funktion: Punkt 1 lässt uns annehmen, dass später
auch Punkt 2 vorkommt (die kataphorische Funktion). Punkt 2 bedeu-
tet, dass es früher auch den Punkt 1 gab (die anaphorische Funktion).
Das wiederholt sich dreimal und schafft aus den einzelnen Absätzen ein
Ganzes. Zu der Entstehung des Parallelismus tragen auch die Verbalfor-
men bei: alle Verben stehen im Präsens Konjunktiv und drücken die im-
perativische Modalität aus.
3. Die Wiederholung der Satzstruktur kann zur Entstehung eines
syntaktisch-thematischen Parallelismus führen. Er ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente, die ihn hervorrufen, nicht
unbedingt wiederholt, sondern nur thematisch verwandt sind,
an gleichen Stellen im Satz erscheinen und gleiche Funktionen als
Satzglieder erfüllen.
So baut E. Strittmatter seine Kalendergeschichte „Großvaters Welt“
nach dem Prinzip des syntaktisch-thematischen Parallelismus:
Die Tiere hatten für ihn eine ins Menschliche übersetzte Sprache.
Der Kater vor dem Scheunentor sagte zur Katze auf dem Heuboden: „Ka-
tharina, komm mal raus, komm mal raus!“
Der Hengst rief der Stute zu: „Hiiier bin ich, hiiier!“, und die Kohlmeise
sang: „Hier sitz ich fein, hier sitz ich fein!“
Die Krähen ermuntern im Winter einander: „Knoche dürr, Knoche dürr. —
Klaue ab! Klaue ab!“, und die Schwalbe sang im Sommer am Hausgiebel: „Ho-
sen flicken, Hosen flicken? Kein Zwirm, kein Zwirrn.“
Der Grünspecht schrie nach Großvaters Auslegung im Frühling: „Weib,
Weib, Weib!“ und im Herbst: „Strick, Strick, Strick!“
Der Tauber gurrte: „Heb den Rock hoch, heb den Rock hoch!“, und der
Goldammerhahn sang im Birkenwipfel: „Wie, wie, wie hab ich dich lieb!“
Die Substantive, die am Anfang der Sätze stehen, verfügen über
eine bestimmte semantische Äquivalenz: sie gehören zu einer themati-
schen Gruppe „Tierwelt“. In der syntaktischen Satzstruktur erfüllen
sie die Rolle des Satzsubjekts, mit dem jeder Satz beginnt: Die Tiere...
der Kater... der Hengst... die Krähen... der Grünspecht... der Täuber.
262
Mit diesen Substantiven sind noch einige Satzobjekte thematisch
verwandt: die Katze, die Stute. Sie bilden also eine topikale Kette, die
den ganzen Text durchdringt und seine Isotopie verstärkt. Das Substan-
tiv „Tiere“, das an der Spitze dieser Topikkette steht, ist Bedeu-
tungskondensat und umfasst die Bedeutungen aller Substantive,
die ihm in den nächsten Sätzen folgen. In diesem Fall sprechen wir über
den syntaktisch-thematischen Parallelismus der ersten Stelle, der durch
den thematischen Parallelismus der zweiten Stelle unterstützt wird. Als
Prädikate werden da Verben gebraucht, die als verba dicendi bezeichnet
werden können. Sie fuhren die direkte Rede ein und bilden auch eine
Topikkette: sagte... rief zu... sang... ermunterten... sang... schrie... gurr-
te... sang.
Im Text „Großvaters Welt“ ist der Gebrauch des syntaktisch-thema-
tischen Parallelismus mit der inhaltlichen Seite verbunden. Im Text fehlt
die Fabel. Er ist auf der Aufzählung einzelner Tatsachen aufgebaut. Die
Aufmerksamkeit des Lesers wird nicht auf die Entwicklung der Hand-
lung gerichtet, sondern darauf, über welche Tiere der Autor spricht und
wie er sie charakterisiert. Die Gestalt jedes Tieres und jedes Vogels wird
mit geringen Sprachmitteln geschaffen. Zu zählen sind das Verb, das die
direkte Rede einführt und dem „Sprechenden“ eine Charakteristik gibt
{rief zu, sang, gurrte), die direkte Rede, die das Sprachporträt des perso-
nifizierten Tieres schafft, die Lautmalerei. Der Autor versucht für die
Laute, die den Tieren und Vögeln eigen sind, eine Entsprechung in der
menschlichen Sprache zu finden. Das Hauptaugenmerk gilt der Äuße-
rung, der direkten Rede. Alles, was sie begleitet, ist maximal ver-
einfacht. So entstehen einfache, einander ähnliche Satzkonstruktionen,
die sich am Parallelismus beteiligen. Einfache Komposition, Personifi-
zierung und Lautmalerei messen dem Text die Schlichtheit und die Nai-
vität bei, die Folkloretexten eigen sind.
§ 59. Verblose Sätze
Es ist bekannt, dass der typische deutsche Satz über ein Verb als Prä-
dikat verfügt. Selbstverständlich gibt es auch verblose Sätze (e i n-
gliedrige Sätze „Ruhe!“, „Abend.“ und elliptische Sätze „Ich
nicht.“, „Träume—Schäume.“), aber sie werden nicht in allen Funktio-
nalstilen zugelassen und sind nicht so verbreitet wie Sätze mit dem ver-
balen Prädikat. In der Regel werden sie in Telegrammen verwendet,
wo man sich knapp ausdrücken soll.
Zeitungsanzeigen, die auch knapp und sachlich sein sollen, er-
halten verblose Sätze:
Arbeiten mit PC und Internet*.
Sehr gute Bezahlung bei freier Zeiteinteilung.
Infos anfordem unten ivu>w. 12jobs.com.
263
Trotz der Erwartungen werden aber auch in den Anzeigen oft
Verbalsätze gebraucht, die die Sachlichkeit dieser Texte nicht verlet-
zen:
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine erfahrene
KINDERFRAU
zur Betreuung der beiden kleinen Kinder der Familie und zur Übernah-
me von damit zusammenhängenden weiteren Aufgaben. Die Arbeitszeit soll
bei flexibler Zeiteinteilung 40 Stunden pro Woche betragen, die Bereitschaft
zur Betreuung in den Abendstunden vorausgesetzt. An dieser Stelle legen wir
besonderen Wert auf Erfahrungen im Umgang mit kleinen Kindern, eine
sorgfältige und selbständige Arbeitsweise, Ehrlichkeit und sehr gute Um-
gangsformen:
Der Haushalt liegt in verkehrsgünstiger Lage in Berlin-Charlottenburg.
Ausführliche Zuschriften erbitten wir unter 6101750.
Verblose Sätze kennzeichnen auch Sprichwörter und Apho-
rismen, die nach Kürze streben:
Guter Mut, halbe Arbeit.
Großer Prahler, kleiner Tuer.
Kaiser oder nichts!
Diese Struktur macht die Aussage schlagkräftig und einprägsam.
Belletristische Texte, die zum kleinen Genre gehören, sind
auch nicht selten auf verblosen Nominalsätzen aufgebaut. Der Autor
greift zu diesen Strukturen, wenn er danach strebt, Situationsbilder zu
schaffen oder ein stilles Betrachten darzustellen, wie es in der folgenden
lyrischen Miniatur von M. Jendryschik der Fall ist:
Nachlaß
Der Lodenmantel, grüngrau verwaschen. Er als Kind: ein Foto. Das Fahr-
rad auf platten Füßen, Marke Mifa, gepflegt. Nägel. Senfgurken in Gläsern da-
neben. Stapel Zeitungen. Kopierstifte. Eine Rolle Kupferdraht, mit verschlis-
senen Leinen umwickelt. Adreßzettel, vergilbt. Pummlige Weiber auf Ansichts-
karten. Eine Geschichte des Deutschen Reiches in drei Bänden. Farbtöpfe.
Briefe der Kinder. Ein Gruß aus den Alpen. Eine Kelle, abgebrochen der Stiel.
Das angefangene Jahr.
Die gehäuften Substantive fixieren nicht nur die Gegenstände, die
die Augen des Autors, aber damit auch die Augen des Lesers sehen. Sie
sind, nach W. Schmidt, Symbole für Gedanken- und Gefühlsbestände.
Manchmal haben sie den Charakter von Chiffren, die zu enträtseln
sind und die das Vertrautsein mit der geistigen Welt des Dichters vo-
raussetzen [vgl. Schneider, 1963, 430]. Heute nennen wir dieses „Ver-
trautsein“ gemeinsames Hintergrundwissen, das der Au-
tor und der Leser haben sollen, damit der Text richtig verstanden wer-
den könnte.
264
Der verblose Satz soll nicht unbedingt aus Substantiven bestehen. Oft
sind es Präpositionen und Adverbien, die eine Bewegung be-
wirken. So enthält der folgende Text keine finiten Verben. Neben den
Substantiven schaffen Präpositionen und Adverbien, die auf die Rich-
tung hinweisen, ein hektisches Tempo:
Geschafft!
Schon 8! Welch ein Schreck! Wieder einmal verschlafen! Raus aus dem Bett!
Rein in die Sachen. Ins Bad geschossen. Seife, Waschlappen. Zahnbürste,
Handtuch. Hahn auf — kein warmes Wasser. Hahn zu. Haare glatt. Wie immer
starr! Schnell an den Frühstückstisch. Brötchen her. Butter drauf Marmelade
driiber. Kaffee nach. Los. Schultasche geschnappt. Wieder mal nicht gepackt.
So. In Ordnung: Der linke Schuh weg. Mütze auf Schal um. Mantel an. Treppe
runter und in den Bus hinein. Geschafft!
Zu der Dynamik dieses Textes trägt auch die Wo r t w a h 1 bei: der
Autor wählt nur kurze Wörter aus, die die Bewegung nicht behindern
und einen Rhythmus schaffen: die Substantive Schreck, Bett, Bad,
Hahn, Schal, Bus, die Adjektive und Adverbien glatt, starr, schnell,
schon, so. Sie sind einsilbig und wirken sehr rhythmisch. Der Satz
wird bewegt und lebendig. Es kommt eine spürbare Spannung zu
Stande.
§ 60. Die Parzellierung
Diese Erscheinung wird in der Stilistik schon längst als ein Kennzei-
chen der schöngeistigen Literatur anerkannt. W. Schneider
nennt sie „sprachlichen Pointillismus“ und sieht darin eine Folge der
impressionistischen, skizzenhaften Kurzsätzigkeit [Schneider, 1963,
443].
Es ist allgemein bekannt, dass die Parzellierung darin besteht, dass
einzelne Satzglieder oder Satzteile als scheinbar selbstständi-
ge Sätze auftreten. Punkte schaffen Pausen und erfordern jedes Mal
ein Sinken des Stimmtons. Die klangliche Selbstständigkeit bewirkt
auch eine gewisse inhaltliche Selbstständigkeit. So gewinnen die Teil-
aussagen an Gewichtigkeit und Eindringlichkeit [s. Schneider, 1963,
443].
Die Parzellierung als Hervorhebung einzelner Satzglieder kann ver-
schiedenen Zielen dienen. Zeigen wir das an einigen Beispielen. Das
erste ist eine lyrische Miniatur von W. Trampe.
Der Dampfer
Der lang angehaltene Ton. Hinter dem Wald. Das ist der weiße Dampfer. Er
fahrt durch die Luft und hat kein Geheimnis. Nur diesen Ton, der sonderbar
klingt. Der uns verschwistert und anrührt. Obwohl wir schweigen. Das klingt
noch. Der weiße Dampfer. Das ist die Antwort, die wir uns immer gewünscht
265
haben. Weil wir nicht Abschied nehmen können, wenigstens manchmal nicht
und jetzt.
Jeder Satzteil, der nun als ein selbstständiger Satz fungiert, gewinnt
an zusätzlicher Bedeutung in der inhaltlichen Textstruktur. Statt des
Satzes Der lang angehaltende Ton hinter dem Wald ist der weiße Dampfer,
haben wir drei Sätze. Genauso sind auch der vierte (Erfahrt...), der
fünfte (Nur diesen Ton...), der sechste (der uns...), der siebente (Obwohl
wir...) und der letzte Satz (Weil wir...) aufgebaut: sie stellen nur Te i le
eines zusammengesetzten Satzes dar und können leicht und ohne jegli-
che Xferänderung ihrer Struktur in ein Ganzes zusammengefügt werden.
Diese von dem Autor eingeführte Zerrissenheit schafft den so genannten
„Stotter-“ oder „Asthma-Stil“, der den stockenden unregelmäßigen
Atem eines an Atemnot leidenden Menschen nachahmt. So entsteht das
Bild eines schnaufenden, kurze Hupsignale hervorbringenden Damp-
fers.
Der „Asthma-Stil“ wird oft in der Werbung eingesetzt. Dann ist
sein Ziel das Hervorheben jeder Eigenschaft, das Betonen der Qualität
der Ware:
Holen Sie sich die frische Fa — mit der wilden Frische von Limonen. Kühl wie
der Ozean. Wild wie Brandung. Das prickelt. Belebt. Macht hellwach.
Solche Kunststücke wären im Stil des öffentlichen \ferkehrs und im
Stil der Wissenschaft mit ihrem Hang zur Sachlichkeit und zu einer
trockenen, genauen Wiedergabe der Information unzulässig.
§ 61. Die Aussage-, Frage- und Aufforderungssätze
Wie gesagt, unterscheidet man Sätze auch nach der Redeab-
sicht.
Der Aussagesatz herrscht in den meisten Texten aller Funktionalsti-
le. Man kann kaum etwas Allgemeingültiges über diese Satzart sagen.
Seinen stilistischen Wert bestimmen der Inhalt, syntaktische Struktur,
Wortstellung und Wortwahl sowie auch andere Charakteristiken.
Die Aufforderungssätze sind bestimmten Genres und Textsorten ei-
gen. Sie sind gut in der Alltagsrede und in manchen Textsorten des
Stils des öffentlichen Verkehrs, im Stil der Wissenschaft aber
sind sie fehl am Platz. Eingehender wird diese Satzart im Abschnitt be-
handelt, der der modalen Textstruktur gewidmet ist.
In demselben Abschnitt werden auch die Wunschsätze analysiert, die
auch zur Gestaltung der modalen Charakteristik des Ganztextes beitra-
gen.
Die Fragesätze werden als starke voluntas-Signale eingeschätzt
[E.U.Große, 1976]: sie verlangen nach einer sprachlichen Hand-
lung — nach einer Antwort. Welcher Stilwert den Fragesätzen zu-
kommt, kann man anhand des folgenden Auszugs aus F. Glausers Er-
266
zählung „Berichte in der Nacht“ verfolgen, die unerwartet mit einem
Fragesatz beginnt:
Nun, junger Mann? Was sagen Sie jetzt? Sie haben wohl nicht gedacht, daß
ich mich an Ihren Tisch setzen würde? Sie waren tapferer, als Sie mit Ihrer Sui-
te zusammensaßen, den aufgedonnerten Mädchen — obwohl aufgedonnert ein
altmodisches Wort ist und abgedonnert für Ihre Begleiterinnen besser passen
würde. Als Sie in Gesellschaft waren, da hatten Sie ein besseres Maul. Warum
sind Sie auch zurückgeblieben, allein? Ein wenig Kater gehabt? Die Gesell-
schaft ist Ihnen auf die Nerven gegangen.
Der Text ist von Fragen durchdrungen. Sie sind an einen fiktiven
Gesprächspartner gerichtet, den der Autor der Erzählung nie zu Worte
kommen lässt. So entsteht ein fiktiver Dialog, der nur die Repliken eines
Gesprächspartners enthält. Die Fragesätze machen aber die Rede des
Sprechenden lebendig, bringen Emotionalität und Bewegung hinein
und verstärken den Eindruck eines Gesprächs.
Selbstverständlich geht es hier nicht um rhethorische Fragen, die kei-
ne Antwort erwarten und auf eine andere Reaktion angewiesen sind: sie
gelten eher als Behaupten eines Gedankens, dessen Inhalt als unbezwei-
felbar gilt [s. Schneider, 1963, 426].
Ein anderes Beispiel für die Rolle der Fragesätze finden wir in der
Miniatur von E. Erb.
Der Besuch
Haben Sie ein Pferd? Hab ich eins? Wollen Sie mich runterstoßen? Mich
drauf setzen? Kommen Sie zu handeln? Zur Gesellschaft? Zu mir? Soll ich
fliegen? N., sind Sie N.? Der N.? Ein N.? „Möchten Sie Erdbeeren?“ — „Sag
ich nicht nein“.
Die scheinbar sinnlosen Sätze, miteinander inhaltlich nicht verbun-
den, sind aber in einem Text vereinigt und geben die Atmosphäre eines
Besuches wieder: die Gespräche, die Gesprächspartner zu nichts ver-
pflichten, der rasche Themenwechsel und viele Fragen. In der Rolle ei-
nes Bindemittels zwischen den Sätzen tritt in diesem Fall der Titel
auf. Er bestimmt die Situation und erklärt die seltsame Wahl der Satz-
struktur.
Lange Zeit galt der Satz, wie gesagt, als größte syntaktische Einheit
und größte kommunikative Einheit, die einerseits der Sprache als Sys-
tem, andererseits der Rede zugeordnet wurde.
Laut modernen Ansichten auf die Sprache ist der Satz die minimale
sprachliche Einheit, in der unsere Gedanken geprägt und ausgedrückt
werden und mit deren Hilfe die Menschen kommunizieren. Die Bestim-
mung des Satzes als kleinster kommunikativer Einheit, also als kleinster
Redeeinheit, bedeutet, dass es auch größere Einheiten gibt, die eine
kommunikative Funktion haben.
Der heutige Stand der Linguistik ist durch das Interesse am Text als
einer kohärenten (zusammenhängenden) Satzfolge gekennzeichnet, die
267
als Äußerung fungiert. Es wird behauptet: Nur texthafte und
textwertige Sprache ist das Kommunikationsmittel zwischen den
Menschen.
Im Xfergleich zu anderen Einheiten ist der Text nicht nur die größte
oberste Einheit mit eigener interner syntaktischer Struktur. Auf die Be-
handlung des Textes und seiner Struktur werden wir in den Kapi-
teln 13—17 eingehen.
Literaturnachweis
1. Brons-Albert R. Gesprochenes Standarddeutsch: Telefondialoge. — Tü-
bingen, 1984.
2. Große E. U, Text und Kommunikation. — Stuttgart, 1976.
3. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. — M., 1975.
4. Schneider W. Stilistische deutsche Grammatik. — Freiburg; Basel; Wien,
1963.
Kapitel 13
DER TEXT. DIE TEMPORALE STRUKTUR
DES TEXTES
Wir beginnen unsere Abhandlung über den Text mit der folgenden
Bemerkung: Jeder Text, sei es ein belletristischer, ein publizistischer
oder ein wissenschaftlicher Text, ist auf die Wirklichkeit bezogen. Die
Bezogenheit des Textes auf die Wirklichkeit, auf die reale oder die fiktio-
nale, vom Autor erfundene Welt, nennt man Aktualisierung des Textes.
Sie kommt durch die Benennung der konkreten Gegensätze zu Stande,
durch Äußerungen über Tatsachen und Situationen, durch die Bestim-
mung von Zeit der Handlung und Ort der Handlung. Die Aktualisierung
ist eine unabdingbare Eigenschaft eines jeden Textes.
Als Textaktualisatoren treten fünf Textstrukturen auf: die temporale,
die lokale, die personale, die referentielle und die modale Textstruktur.
Jede Struktur hat in den verschiedenen Funktionalstilen und Genres
ihre Besonderheiten. Wir sehen die Aufgabe der Textstilistik unter ande-
rem auch darin, diese Besonderheiten zu untersuchen.
§ 62. Die Kategorie der Zeit und ihre Aspekte
Die Kategorie der Zeit gehört zu den wichtigen textkonstituierenden
grammatischen Kategorien, die im stilistischen Aspekt eine bedeutende
Rolle spielen. Mit Hilfe dieser Kategorie werden die Gleich-, Wr- oder
Nachzeitigkeit ausgedrückt. Die Tempora können als Stilelemente ge-
268
nutzt werden und zur Eigenartigkeit des Textes beitragen. Sie wirken im
Rahmen des Textes mit anderen Sprachmitteln (morphologischen, syn-
taktischen, Wortbildungsmitteln) zusammen und schaffen eine einheit-
liche temporale Charakteristik des Gesamttextes. Man unterscheidet
verschiedene Zeitbegriffe.
1. Die objektive oder die reale Zeit. Sie existiert unabhängig vom Men-
schen und ist, wie bekannt, eine der Existenzformen der Materie: alle
materiellen Erscheinungen existieren in Raum und Zeit. Beide Existenz-
formen der Materie unterscheiden sich durch eine Reihe wesentlicher Pa-
rameter voneinander, darunter auch dadurch, dass der Raum dreidi-
mensional und die Zeit eindimensional ist. Alle Ereignisse ver-
laufen in einer Richtung, und zwar von der \fergangenheit über die Ge-
genwart in die Zukunft. Die Bewegungsrichtung ist unumkehrbar.
2. Die subjektive oder die individuelle Zeit. Sie stellt die Widerspiege-
lung der realen zeitlichen Verhältnisse im menschlichen Bewusstsein
dar. Das Zeitempfinden ist bei jedem Menschen sehr subjektiv.
Der Mensch empfindet die Geschwindigkeit der Zeitentwicklung unter-
schiedlich. Die subjektive Zeit kann zwei Richtungen haben: von der
Gegenwart in die Zukunft und von der Gegenwart in die Vergangenheit.
3. Die dichterische (fiktive, poetische) Zeit. Sie wird in der Fantasie
eines Dichters, eines Schriftstellers geschaffen. Die dichterische Zeit ist
die Daseinform der idealen Welt, der ästhetischen Wirklich-
keit; sie ist das temporale Kontinuum der geschilderten Ereignisse und
unterscheidet sich stark vom realen Zeit-Raum-Kontinuum [vgl. Typa-
eßa, 1979,14. 23]. Die dichterische Zeit ist (ebenso wie auch die subjek-
tive), umkehrbar. Sie entwickelt sich auch in zwei Richtungen: von der
Gegenwart in die Zukunft und von der Gegenwart in die Vergangenheit.
Sie kann Sprünge machen, erlaubt Rückblenden und Vorblenden. Das
Tempo der dichterischen und der objektiven Zeit fallen nicht zusam-
men. Die dichterische Zeit kann sehr schnell verlaufen oder sich ganz
langsam entwickeln.
Die dichterische Zeit ist aufs engste mit dem Genre, mit der dichteri-
schen Methode, mit der literarischen Richtung verbunden.
In der Epoche des Romantismus, im Ritterrom a n erscheint zum
ersten Mal in der Literatur das subjektive Spiel mit der Zeit. Die Zeit
wird verlangsamt, beschleunigt, zusammengepresst. M. M. B a c h t i n
betonte, dass die Abenteuerzeit des Ritterromans im Zusammenhang
mit der Symbolik, mit der märchenhaften Wunderwelt gestaltet wurde.
Deshalb wurde auch die Zeit wunderbar: sie ließ die Stunden dehnen
und die Tage bis auf einige Minuten zusammenpressen [s. BaxraH,
1975]. Durch die Veränderung des Tempus, so D. S. Lichatschov,
kann beim Leser die notwendige Stimmung geschaffen werden
[vgl. JInxa<ieB, 1979, 248],
Die dichterische Zeit ist eine komplexe Struktur. Sie setzt sich aus
folgenden Bestandteilen zusammen: aus der Zeit des Autors, der Zeit
der handelnden Personen und der Zeit des Lesers.
269
4. Die konzeptuale Zeit. Darunter verstehen wir die Zeitform der
ivissenschaffliehe n Texte. Im Unterschied zur belletristischen
Literatur spiegelt der wissenschaftliche Text unmittelbar die Wirklich-
keit wider, macht es aber auf der Ebene von Modellen oder Konzepten.
Die konzeptuale Zeit unterscheiden sich von der künstlerischen Zeit
durch folgende Merkmale:
— Die konzeptuale Zeit ist frei von subjektiver Zeitempfindung.
— Der wissenschaftliche Text modelliert eine verallgemeinerte Situa-
tion und das spiegelt sich in der Struktur der Zeit wider.
— Bei der Beschreibung statischer Momente (verschiedene Regeln
und Gesetze) werden das Präsens und das Passiv bevorzugt.
— Bei der Beschreibung dynamischer Momente (die Durchführung
der Experimente) werden das Präsens und die Vergangenheitsformen
gebraucht [s. Typaeaa, 1985, 27].
5. Die grammatische Zeit. Sie ist spezifisch für jede Sprache, d. h. jede
Sprache hat ihr System der Zeitformen.
Die chinesische und japanische Sprachen haben eine zweigliedrige
Opposition: die Vergangenheit — die Nichtvergangenheit. Die russische
und einige slavische Sprachen haben eine dreigliedrige Opposition: die
Gegenwart — die Vergangenheit — die Zukunft. Die romanischen und
germanischen Sprachen haben ein ganzes System: die Vergangenheit —
die Vorzeitigkeit in der Vergangenheit — die Gegenwart — die Zu-
kunft — die Nachzeitigkeit in der Zukunft [s. IIoTaeHKO, 1985].
Diese temporalen Verhältnisse werden durch verschiedene gramma-
tische Mittel ausgedrückt: in den indoeuropäischen Sprachen durch
\ferben, Partizipien, Infinitive und andere Formen, in der vietnamesi-
schen Sprache — durch Prädikative, in der chinesischen Sprache —
durch Wörter mit zeitlicher Bedeutung, durch den Kontext, durch die
Situation.
Auch das deutsche Zeitsystem hat seine Besonderheiten. Jede der
sechs Zeitformen hat eine Hauptbedeutung und eine oder mehre-
re Nebenbedeutungen.
Die Hauptbedeutung des Präsens ist die Angabe der Gegenwart. Sei-
ne Nebenbedeutungen sind: das iterative Präsens — bezeichnet eine
sich wiederholende Tätigkeit; das qualitative — charakterisiert die
Eigenschaften des Subjekts; das generelle — hat einen hohen Grad
der Verallgemeinerung; das futurische — bezeichnet eine Handlung
in der Zukunft; das historische — ersetzt das Präteritum bei der
Schilderung in der Vergangenheit; das imperativische — dient als
Synonym für den Imperativ.
Das Präteritum hat als Hauptbedeutung die Bezeichnung der Ver-
gangenheit. Es hat zwei Nebenbedeutungen in der erlebten Rede (d. h.
in der Reflektionsdarstellung der handelnden Personen): das p r äsen-
tische Präteritum — es bezeichnet die Gegenwart vom Standpunkt
der handelnden Person aus und das futurische — es lässt sich durch
das Futur ersetzen.
270
Das Perfekt hat als Hauptbedeutung die Angabe der Vergangenheit,
der Gegenwartsbezogenheit, der Abgeschlossenheit der Handlung. Sei-
ne Nebenbedeutung ist das futurische Perfekt (bei der Schaffung
einer zukunftsorientierten Perspektive).
Das Plusquamperfekt bezeichnet die Vorzeitigkeit in der Vergangen-
heit. Als Nebenbedeutung wird sein Gebrauch zum Ausdruck der Nach-
zeitigkeit, d. h. einer nachfolgenden Handlung betrachtet. Dann betont
diese Zeitform die Abgeschlossenheit einer Handlung. In der erlebten
Rede kann das Plusquamperfekt die Vorzeitigkeit in der Zukunft be-
zeichnen, sowie auch das Futur II.
Die Hauptbedeutung des Futurs I besteht in der Bezeichnung der
Zukunft. Die Nebenbedeutung besteht in der Angabe einer Annahme
in Bezug auf die Gegenwart (das modale Futur). Das Futur I kann
auch mit Hilfe der Intonation imperativisch wirken. Manchmal
wird das Futur im allgemeinen Sinn gebraucht, hauptsächlich in
Sprichwörtern.
Das Futur II hat drei Bedeutungen: Die Hauptbedeutung besteht in
der Angabe der relativen Zeit — Vorzeitigkeit in der Zukunft. Es kann
auch eine nachfolgende abgeschlossene Handlung bezeichnen. Das
modale Futur II drückt eine Vermutung in Bezug auf die Vergangen-
heit aus [ausführlich darüber: Schendels, 1988, 48— 58}.
Jede Zeitform hat ihren stilistischen Wert. So erscheint z. B. das ge-
nerelle Präsens dank seinem verallgemeinernden Charakter in verschie-
denen Sprüchen. Sentenzen. Sprichwörtern, Feststel-
lungen von Gesetzmäßigkeiten. Das futurische Präsens stellt
das zukünftige Geschehen so lebhaft dar, als ob es gegenwärtig wäre.
Das historische Präsens verleiht der Erzählung eine besondere Be-
deutung und Spannung. Das Ereignis rückt aus der Vergangenheit in die
Gegenwart hervor. Solche Übertragung nennt man „grammatische Me-
tapher“. Das historische Präsens kann auch als Durchgangsform eines
literarischen Werkes gewählt werden. Dann verliert diese Form
die Wirkung der lebhaften Vergegenwärtigung und wird zur erzählenden
Zeitform. Das imperativische Präsens klingt kategorisch und resolut.
Das Präteritum eignet sich dank seiner einfachen synthetischen
Form für die epische Darstellung. Außerdem wird es oft bei der Wie-
dergabe der erlebten Rede gebraucht.
Die Gegenwartsbezogenheit lässt das Perfekt im Gespräch, in der
direkten Rede gebrauchen, sowie in einer einzelnen zu betonenden
Mitteilung. Das Eröffnungsperfekt im ersten Satz eines Abschnittes
und das Schlussperfekt im letzten Satz bilden einen Rahmen und wer-
den dann „Rahmenperfekt“ genannt. Wenn der Text im Perfekt erzählt
wird, so wirkt er zerhackt, aufgeregt. Ihm fehlt die Gleichmäßigkeit der
präteritalen Erzählung.
In einigen Mundarten ist das Präteritum verschwunden, statt dessen
erscheint in einer mündlichen oder dialektal gefärbten Er-
zählung das Perfekt. Dabei geht es jedoch nicht um Aufregung.
271
Das Plusquamperfekt in der Bedeutung der Nachzeitigkeit kann ei-
nen raschen und plötzlichen Abschluss bezeichnen.
Das modale Futur I und Futur II sind typisch für die direkte
Rede [ausführlichdarüber: Schendels, 1988, 48—58].
Wie schon gesagt, existiert zwischen den grammatischen Zeitfor-
men eine bestimmte Synonymie. Im Kontext können sie einander er-
setzen. So kann das Präsens in einer Erzählung über vergangene Ereig-
nisse statt des Präteritums gebraucht werden und das Präteritum er-
setzt das Präsens in der erlebten Rede. Der Austausch der Formen ist
aber nur im Großkontext mit Hilfe der Umschalter möglich. Es ist
auch zu betonen, dass nicht nur die Nebenbedeutungen einen Aus-
druckswert besitzen. Die Hauptbedeutungen haben auch Stilwirkun-
gen. Sie sind von der Lexik, von der semantischen Assimilation der
Nachbarformen, von ihrer Anordnung und Gebrauchsfrequenz, von
der gesamten Sprechsituation beeinflusst [vgl. Riesel, Schendels
1975, 106—107].
Analysieren wir einen Text aus der Zeitschrift „Bunte“ (unter Rubrik
„Kultur-News“):
Theater
Berlin
William Shakespeares Tragödie „Hamlet“ gehört zu den bedeutendsten
Theaterstücken der Welt. Am 21. Juni widmet der TV-Sender 3sat dem Meis-
terwerk deshalb einen ganzen Abend. Ab 20.15 Uhr wird die legendäre Spiel-
filmversion des „Hamlet“ von 1948 mit Laurence Olivier ausgestrahlt. Danach
überträgt der Sender aus der Berliner Volksbühne das Multimedia-Theaterpro-
jekt „Hamlet X— Die Welt ist aus den Fugen“ von Schauspieler Herbert
Fritsch. Dabei soll aus insgesamt III Fragmenten eine eigene, multimediale
„Hamlet-Welt“ entstehen.
Weitere Mitwirkende: Corinna Harflouch, Martin Wuttke, Meret Becker,
Mattias Schweighöfer, Hannelore Hoger und Anna Thalbach. („Bunte“, Nq 26,
2003)
Der oben angeführte Text stellt ein glänzendes Beispiel für die Zeit-
formensynonymie. Im ersten Satz (William Shakespeares Tragödie...)
wird das Präsens in seiner qualitativen Bedeutung gebraucht. In
den nachfolgenden Sätzen ändert sich seine Bedeutung. Wenn wir die
Tatsache berücksichtigen, dass der Text am 18.6. gedruckt wurde und
über die Ereignisse berichtet, die erst am 21.6. stattfinden, d.h. drei
Tage später, so wird klar, dass das Präsens in diesen Sätzen in seiner fu-
turischen Bedeutung erscheint. Das Ersetzen einer analytischen Form
(des Futurs) durch eine synthetische (das Präsens) entspricht vollkom-
men den pragmatischen Aufgaben einer Zeitungsmeldung: in
knapper und möglichst gedrängter Form eine genaue Information zu
bringen.
Am Beispiel dieses Textes sieht man auch die Wirkung des Groß-
kontextes: nur unter Berücksichtigung der im ganzen Text zer-
272
streuten Zeitangaben ist es möglich, den Zeitbezug der Ereignisse zu be-
stimmen.
Die Besonderheiten des deutschen Zeitsystems und der stilistische
Wert jeder Zeitform sind hier nur skizzenhaft dargelegt, weil sie schon
mehrmals und eingehend in den Beiträgen und Lehrbüchern behandelt
wurden. Unser Anliegen besteht vielmehr darin, die textbildenden stilisti-
schen Potenzen dieser Formen im Rahmen eines Ganztextes zu zeigen.
Mit der Entwicklung der Textlinguistik begann eine neue Etappe in
der Erforschung der Tempuskategorie. Man behandelte den Zeitfor-
mengebrauch in verschiedenen Texten, wobei man nicht den Textteilen,
sondern dem Ganztext das Hauptaugenmerk schenkte. So teilte
H. We i n r i c h die Sprachtätigkeit des Menschen in zwei Bereiche ein.
Das sind die „besprochene Welt“ und die „erzählte Welt“.
Zu der besprochenen Welt gehört nach H. Weinrich das Sprechen, das
mit verschiedenen Arten der praktischen Tätigkeit der Menschen verbun-
den ist. Dazu gehören Dialog, Zeitung, Lyrik, literarische Essays, wissen-
schaftliche Darstellungen, Beratungen; Selbstgespräche, Beschreibungen,
Briefe, Diskussionen, Bühnenanweisungen, Referate. Das Gemeinsame
für sie ist, dass in ihnen die Welt nicht erzählt wird. Als Merkmal dieser
Texte dient die gespannte Handlung. Es geht um die Dinge, die
den Sprecher unmittelbar betreffen. In diesen Texten wird die „Tempus-
gruppe I“ gebraucht: Präsens, Perfekt, Futur I. Diese Gruppe heißt auch
„Tempusgruppe der besprochenen Welt“ oder „besprechende Tempora“.
Sie signalisieren: entspanntes Zuhören ist nicht gestattet.
Zur erzählten Welt gehören Roman, Novelle und Erzählung. Das ih-
nen Gemeinsame ist das Erzählen. Die Funktion der Tempora besteht
darin, dem Hörer Nachricht davon zu geben, dass diese Mitteilung eine
Erzählung ist. In diesen Texten werden die Tempora der Gruppe II ge-
braucht: Präteritum, Plusquamperfekt, Konditionalis I. Sie heißen auch
„Tempora der erzählten Welt“ oder „Erzähltempora“ [s. Weinrich, 1975].
§ 63. Monotemporale und polytemporale Texte
Vom Standpunkt der grammatischen Zeit aus lassen sich alle Texte in
zwei Gruppen teilen: in monotemporale Texte, die durch den Gebrauch
einer Zeitform gekennzeichnet sind, und polytemporale Texte, in denen
zwei oder mehrere Tempusformen vertreten sind. Der Stilwert jeder ein-
zelnen Zeitform wurde schon in Abschnitt 1 behandelt. Nun besteht un-
sere Aufgabe darin, die Rolle der Zeitformen im Rahmen des Ganztex-
tes zu zeigen.
Monotemporale Texte
Im Text mit einheitlicher Zeitform erfüllt die grammatische Zeit eine
Reihe von Aufgaben:
10 fioraTbtpena
273
1. Sie sichert die Kohärenz des Ganztextes, die zu den
führenden Textkategorien gehört. Weil alle Verben im monotemporalen
Text in einer und derselben Zeitform stehen, sind sie durch ein und das-
selbe Merkmal charakterisiert: beim Präteritum — „das Nichtzusam-
menfallen mit dem Redemoment“ und beim Präsens — „das Zusam-
menfallen mit dem Redemoment“. So bilden alle Sätze im Text, abge-
sehen von ihrem Inhalt, eine formelle Ganzheit.
2. Sie schafft die so genannte „Barriere zwischen realer
und fiktionaler We 1t“, zwischen der realen und der künstleri-
schen Zeit beim Gebrauch des Präteritums und beseitigt diese Barriere
beim Gebrauch des Präsens.
3. Sie aktiviert den Leser, fuhrt ihn in die Handlung hinein, ver-
wandelt ihn in den Teilnehmer der Handlung beim Gebrauch des Prä-
sens und umgekehrt, distanziert den Leser von dem Geschehen,
lässt ihn die Ereignisse von der Seite aus beobachten, nachdenken, ver-
gleichen beim Präteritum.
Ein Beispiel des monotemporalen Textes finden wir in der folgenden
lyrischen Miniatur von R. Putzger
Abendspaziergang
In den Ästen der großen Birke hängt die Sonne wie eine Riesenapfelsine.
Ich gehe langsam über die Wese zum See. Vorbei an den Ebereschen, zu den
Weiden hin. Ihre langen dünnen Zweige bewegen sich leicht im Abendwind.
Das Schiff biegt sich landwärts. Ruderboote liegen im Sand. Zwischen den
Steinen und angespültem Holz stehen im seichten Uferwasser die Schwäne, sie
haben ihre Köpfe in die Federn gesteckt, kleine Wellen umspülen die schwar-
zen Schwimmflossen. Über dem See liegt ein blauer Schleier, der am anderen
Ufer in ein schwebendes Weiß übergeht. Dazwischen baut die Sonne eine flim-
mernde Straße. Auf der Straße kleine schwarze Punkte. Bleßhühner im letzten
Abendlicht. Am Ende des schmalen Bootssteges sitzen ein alter Mann und ein
Kind nebeneinander. Beide halten Angeln in das Wasser. Hinter ihnen zwei
Katzen. Es ist sehr still. Alle vier denken an Fische.
Diese kurze Skizze eines Sommerabends ist von Ruhe und Stille
durchdrungen. Der Text ist einem Gemälde ähnlich, so greifbar, an-
schaulich und deutlich hat der Autor die letzten Stunden des verge-
henden Sommertages geschildert. Die Miniatur ist eigentlich eine
Einladung an den Leser, dieses Bild zu genießen. Der Autor ist be-
strebt, die Barriere zwischen der realen Welt des Lesenden und der
poetischen, fiktionalen Welt wegzuräumen. Die Intention des Au-
tors, den Leser mitempfinden und mitfühlen zu lassen, wird mit Hil-
fe von verschiedenen Mitteln erreicht. Uns interessiert aber in erster
Linie die Leistung der Verben. Sie werden alle im Präsens gebraucht
und verfügen über ein und dasselbe Sem: „Zusammenfallen
mit dem Redemoment“. So entsteht der Eindruck der Anwe-
senheit des Lesers an dem Ort und zu dem Augenblick, die vom Au-
tor beschrieben werden. Außerdem sorgt das gemeinsame Sem für
274
den inhaltlichen und strukturellen Textzusammenhang, das heißt, für
seine Kohärenz.
Ein anderes Beispiel veranschaulicht die Wirkung des Präterits im
monotemporalen Text.
Lindenblüten
(PK Trampe)
Die Lindenblüten fielen herab. Sie trafen sich unter den Bäumen und nah-
men die Blüten in die Hand. Über ihnen lagerte das dunkle Geäst, und sie
saßen ruhig auf den Straßensteinen. Sie wendeten die Blüten, hin und her. Auf
den Rückseiten waren die Adern zart und blaß. Sie fielen wie Segelschiffe aus
den Bäumen, flirrend, sanft trudelten sie zu Boden und wurden aufgesammelt.
Sie erinnerten sich an den Tee, aber sie konnten keine Beziehung herstellen,
die Blüten lagen zu geheimnisvoll in ihrer Hand. Überhaupt schien sich etwas
in ihnen zu verbergen, aber sie fanden den Anfang nicht. Sie sammelten die
Blüten auf und taten sie in den Leinenbeutel. Der Beutel füllte sich. Zwischen-
durch sprachen sie. Aber im Grunde warteten sie auf die Lindenblüten, von de-
nen es nicht viele gab.
Das Ereignis, das in diesem Text dargestellt ist, wird von einem Ab-
stand gezeigt, als wäre es eine Märchengeschichte aus alten Zeiten,
ohne konkrete Orts- und Zeitangaben, ohne genaue Hinweise darauf,
wer unter diesem geheimnisvollen „sie“ verborgen ist. Die Beteiligung
des Lesers an der Handlung, wenn auch eine fiktive, ist nicht nötig.
Das Anliegen des Autors besteht darin, diese Geschichte sinnvoll zu
gestalten und den Leser diesen Sinn raten zu lassen. Die Schönheit des
belletristischen Textes besteht unter anderem auch in der Möglichkeit
für jeden Leser, zwischen den Zeilen zu lesen und das Seine in jedem
Text zu finden. Die Assoziationen, die das Dargestellte hervorruft,
fußen nicht nur auf den lexikalischen Mitteln, sondern auch auf der
Leistung der Verben. Das Präterit verleiht dem ganzen Text den Cha-
rakter einer ruhigen Erzählung, schafft die Atmosphäre, die nach
J. Trier durch Mangel an affektischer Beteiligung des Autors gekenn-
zeichnet ist, durch „Entängstigung“, „Entlastetsein von aller Verant-
wortung“. Diese ruhige Stimmung ist durch eine Barriere gesi-
chert, die das Präteritum zwischen der realen und der fiktionalen Welt
schafft. Die Textkohärenz ist durch das einheitliche Sem aller Verben
im Text gewährleistet: „das Nichtzusammenfallen mit
dem Redemoment“.
In den monotemporalen Texten erscheint oft der so genannte Rhyth-
mus der Prosa. Die Frage über den Rhythmus eines prosaischen Textes
ist bis heute nicht eindeutig gelöst, obwohl sie bereits in den 20er Jahren
gestellt wurde [s. ToMameBCKKu, 1929]. Dabei spricht man nicht über
die rhythmisierte Prosa, über die Gedichte in Prosa. Es sind vielmehr
ein prosaisches Werk und seine Gestaltung gemeint.
Unter Rhythmus versteht man die Entwicklung des ganzen Werks, die
Dynamik des Sujets, die Entwicklung der literarischen Charaktere.
275
Eine Grundlage für die rhythmische Gestaltung des prosaischen Tex-
tes bilden linguistische Erscheinungen. In erster Linie wird die syn-
taktische Satzstruktur genannt. Lexikalische und fonetische
Mittel stehen im Hintergrund [s. XupMyHCKun, 1966].
Nach Meinung einiger Sprachforscher ist der Gebrauch der \ferben
in einer Zeitform im Rahmen des ganzen Textes auch ein wichtiges Mit-
tel für die Erzeugung des Rhythmus in einem prosaischen Werk. Diese
Erscheinung wird „rhythmisches temporales Kontinuum“ genannt. Es
bildet den Bestandteil einer wichtigen grammatischen Kategorie des
Textes — der Kategorie des Kontinuums.
Unter Kontinuum versteht man eine logische Verbindung zwischen den
einzelnen Sätzen, den transphrastischen Ganzen, Absätzen und größeren
Einheiten des Textes.
Dabei ist der Ort der Handlung genau lokalisiert und die Zeit in ihrer
konsequenten Folge gegeben [vgl. IIIneTHbiii, 1980, 5—11}. LR.Gal-
perin bezeichnet das Kontinuum als eine grammatische Kategorie und
betont, dass es eine integrierende Funktion im Text erfüllt [s. lajibne-
Pkh, 1977].
Ein Beispiel für die Leistung der grammatischen Zeitform stellt die
folgende Miniatur von P. Bichsei dar:
Die Beamten
Um zwölf Uhr kommen sie aus dem Portal, jeder dem nächsten die Tür hal-
tend, alle in Mantel und Hut und immer zur gleichen Zeit, immer um zwölf
Uhr. Sie wünschen sich, gut zu speisen, sie grüßen sich, sie tragen alle Hüte.
Und jetzt gehen sie schnell, denn die Straße scheint ihnen verdächtig. Sie
bewegen sich heimwärts und fürchten, das Pult nicht geschlossen zu haben. Sie
denken an den nächsten Zahltag, an die Lotterie, an das Sporttoto, an den
Mantel für die Frau und dabei bewegen sie die Füße und hie und da denkt ei-
ner, dass es eigenartig sei, dass sich die Füße bewegen.
Beim Mittagessen fürchten sie sich vor dem Rückweg, denn er scheint ih-
nen verdächtig und sie lieben ihre Arbeit nicht, doch sie muß getan werden,
weil Leute am Schalter stehen, weil die Leute kommen müssen und weil die
Leute fragen müssen. Dann ist ihnen nichts verdächtig, und ihr Wissen freut
sie, und sie geben es sparsam weiter. Sie haben Stempel und Formulare in ih-
rem Pult, und sie haben Leute vor den Schaltern. Und es gibt Beamte, die ha-
ben Kinder gern und solche, die lieben Rettichsalat, und einige gehen nach der
Arbeit fischen, und wenn sie rauchen, ziehen sie meist die parfümierten Tabake
den herben vor, und es gibt auch Beamte, die tragen keine Hüte.
Und um zwölf Uhr kommen sie alle aus dem Portal.
Die Idee einer monotonen Tätigkeit, des Sich-Wiederholens wird
durch mehrere linguistische Erscheinungen unterstützt. Darunter soll
die syntaktische Satzstruktur genannt werden, die als Prädi-
kat oft Reflexivverben enthält: Sie wünschen sich... sie grüßen sich... sie
bewegen sich... sie fürchten sich... Diese Auf-sich-Gerichtetheit der
Handlung macht das Geschilderte geschlossen, auf eine kreisähnliche
276
Bewegung eingestellt. Dazu kommt noch die mehrmalige Wiederholung
des Satzes mit demselben Subjekt „Leute“: ...weil Leute am Schal-
ter stehen, weil die Leute kommen müssen und weil die Leute fragen müs-
sen. Monoton wirken auch mehrere Sätze mit der Konjunktion „und“
an der ersten Stelle: Und jetzt gehen sie... und dabei bewegen sich die
Füße... und da denkt einer... und sie lieben... und ihr Wissen... und sie ge-
ben es weiter... und sie haben Leute... Und es gibt Beamte... Auch der
Schlusssatz — eine der starken Positionen des Textes — beginnt mit
„Und“. Eine gewisse Eintönigkeit entsteht dank dem mehrmals wieder-
holten Pronomen „sie“ in der Position des Satzsubjekts. Zur Entstehung
einer logischen \fcrbindung zwischen den Sätzen im Rahmen des Ganz-
textes tragen in bedeutendem Maße die Verben bei, die in einer Zeit-
form stehen — im iterativen Präsens. Das dadurch entstehende
rhythmische temporale Kontinuum spiegelt die Hauptidee des Textes
wider — einer sich tagaus, tagein wiederholenden, beinahe mechanisch
ausgefuhrten Tätigkeit und sorgt für Kohärenz des Ganztextes. Dank
dem Präsens existiert keine Barriere zwischen der Welt des Lesers und
der fiktionalen Welt. Der Leser empfindet das Geschilderte als etwas gut
Bekanntes, mehrmals Gesehenes und Aktuelles.
Und nun ein Text, der zum Stil der Presse und Publizistik
gehört:
Medien
Sommer-Fernsehen. Immer mehr Deutsche verbringen ihren Urlaub im ei-
genen Land — nur die Fernsehsender stellen sich nicht darauf ein. In der Feri-
enzeit gehen sie ihren alten Trott und wiederholen die Wiederholungen. Auch
auf die Gefahr, sich zu wiederholen, können Zuschauer und SPECTATOR nur
zum wiederholten Mal darauf aufmerksam machen. („Bunte“, 2003, N° 28)
Dieser Text ist ein Exempel für die engste Zusammenwirkung der gram-
matischen und lexikalischen Mittel im Rahmen eines Ganztextes. Der Text
basiert auf einer der Nebenbedeutungen des Präsens — auf dem iterativen
Präsens, das eine sich wiederholende Tätigkeit bezeichnet. Diese Bedeu-
tung der Zeitform wird durch ein lexikalisches Mittel — eine Topikkette
unterstützt: ...wiederholen ... Wiederholung ...wiederholen ... (zum) wieder-
holten (Mal). Diese aufdringliche Repetition eines und desselben Stamms
schafft teils einen komischen Effekt, teils den Eindruck eines Zungenbre-
chers, der immer leicht behalten wird. Der Autor erreicht sein pragmati-
sches Ziel: diese Information bleibt im Gedächtnis des Lesenden haften.
Polytemporale Texte
Die meisten belletristischen Texte sind polytemporal. Die
komplizierte Struktur der dichterischen Zeit fordert verschiedene Mittel
und verschiedene Verfahren für ihre Gestaltung.
In einem monotemporalen Text sprechen wir über das temporale
Kontinuum, in einem polytemporalen Text — über das temporale Dis-
277
kontinuum, d.h. Zeitformenwechsel (nach der Terminologie von
T.LSsilman «epeMeHHaa vepecnojiocuna»).
Polytemporal sind oft lyrische Werke. Sie schildern einzelne
Momente, die mit dem seelischen Zustand des Menschen verbunden
sind, seine Erinnerungen, Hoffnungen und Fantasien. Da die zeitliche
Perspektive sich unentwegt verändert — es gibt zahlreiche Rückblenden,
Vorblenden, Rückkehr in die poetische Gegenwart, — erfolgt auch ein
rascher Wechsel der grammatischen Zeitformen.
Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit klarem metallenem Schlag:
mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann —
und ich fasse den plastischen Tag.
Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut,
ein jedes Werden stand still.
Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut
kommt jedem das Ding, das er will.
Nichts ist mir zu klein, und ich lieb es trotzdem
und mal es auf Goldgrund und groß,
und halte es hoch, und ich weiß nicht, wem
löst es die Seele los.
(R.M. Rilke)
Den Eindruck eines persönlichen Erlebnisses unterstützt auch die
„ZcA-Form“, die für die lyrischen Werke genauso kennzeichnend ist.
Das Ich des Autors oder des lyrischen Helden macht das Geschilderte in
einem ganz besonderen Maße wahrheitsgetreu, beinahe dokumenta-
risch. Die Gestalt des lyrischen Helden und seine Zeit beeinflussen stark
die Struktur der dichterischen Zeit. Manchmal distanziert sich der lyri-
sche Held von den beschriebenen Ereignissen, dann wird das Präteritum
eingeführt, das eine andere Zeitschicht oder Erzählperspektive darstellt
(Nichts war noch vollendet,..). Die Rückkehr in die dichterische Wirk-
lichkeit wird durch die Einführung des Präsens gekennzeichnet (Meine
Blicke sind reif...).
In der lyrischen Miniatur „Großvaters Welt“ von E. Strittmatter wird
die Gestalt des Autors/des lyrischen Helden im ersten Satz und dann
erst wieder im Schluss eingeführt:
Großvaters Welt
Großvater wurde neunzig Jahre alt, und ich sah ihn nie mutlos, nie kraft-
los. (...)
Manchmal mein ich, Großvater sei ein Dichter gewesen, einer, dem sein
hartes Leben nicht Zeit ließ, aufzuschreiben, wie er die Welt so sah.
Die Einführung des Ichs im letzten Absatz des Textes bedeutet den
Wechsel der allgemeinen Erzähl Perspektive, die aus
der zeitlichen, lokalen und Personalperspektive besteht. Anders gesagt,
278
beginnt der Leser die geschilderten Ereignisse unter einem anderen Ge-
sichtswinkel zu sehen.
Der Textanfang ist im Präteritum gestaltet. Die nachfolgenden
Sätze stehen auch im Präteritum. Der Autor distanziert sich vom
Dargebotenen, indem er nach einem tiefen Erfassen des Erlebten
strebt. Er preist die Weisheit seines Großvaters, seine Lebenserfah-
rung und Beobachtungsgabe. Diese Charaktereigenschaften belegt
der Autor mit konkreten Beispielen. Das Präsens erscheint zuerst in
der direkten Rede (die Worte des Großvaters und der Tiere), und
dann am Ende, das eine Schlussfolgerung darstellt. Es betont noch
einmal die Distanz zwischen der Zeit des Autors und der erzählten
Zeit.
Ein Beispiel aus der Publizistik'.
Fest des Geistes in Heidelberg
Hermann-Lenz-Preis'. So nobel wurde Joseph Zoderer gefeiert
Barocke Gebäude, sommerliche Lichtspiele auf dem Neckar — so präsen-
tierte sich Heidelberg, die Stadt der Romantik, den Teilnehmern des Her-
mann-Lenz-Preises. Man sah, was Friedrich Hölderlin 1800 dichtete: „Du,
der Vaterlandsstädte Ländlichschönste, (...) wo im heiteren Thal, an den Hü-
gel gelehnt, oder dem Ufer hold, deine fröhlichen Gassen unter duftenden
Gärten ruhn.“
In diesem Ambiente verlieh Verleger Hubert Burda, 63, den renommierten,
mit 15 000 Euro dotierten Preis an den Südtiroler Schriftsteller Joseph Zoderer,
67 („Der Schmerz der Gewöhnung“). Autor Peter Hamm hielt die Laudatio
vor einem illustren Kreis von Literaten und Dichterfreunden und hob das Mo-
tiv der Heimatlosigkeit bei Zoderer hervor. Der Geehrte erwiderte scherzhaft:
„Ich bin erschrocken, schreibe ich in all meinen Romanen das Gleiche?“ Aber
die Ehrung rührte ihn sichtlich: „Es ist eine einmalige Erfahrung, unter den
vielen gescheiten Menschen hier in die Mitte genommen zu werden“. In Erin-
nerung behalten wird er auch die Fahrt über den Neckar: „Der war schon bei
Eichendorf ein Kultfluss und auch Jean Paul und Mark Twain sind auf ihm wie
wir zur Wolfsburg gefahren“.
Der Empfang im historischen Haus Buhl wurde zum Highlight: Im Garten
zwischen Walderdbeeren lasen neben Zoderer die Lenz-Stipendiaten Julia
Schoch, 29, Jörg Matheis, 33, und Denis Mikan, 29 sowie die Träger des Hu-
bert-Burda-Preises für junge Lyrik aus Osteuropa, Constantin Virgil Banescu,
35 (Rumänien), Katerina Rudcenkova, 72 (Tschechien) und Istvan Vorös, 39
(Ungarn). Ihn inspirierten die drei Tage gleich zu einem neuen Gedicht über
den ehemaligen Studienort von Hermann Lenz (1913—1998). („Bunte“, 2003,
No 28)
Der oben angeführte Text ist polytemporal. Seine temporale Basis-
form ist das Präteritum. Es schafft eine ruhige Atmosphäre des Erzäh-
lens und auch eine bestimmte Distanz zwischen der Welt des Lesers
und dem geschilderten Ereignis. Die Intention des Autors besteht darin,
den Leser möglichst genau über das Geschehen zu informieren, aber
gleichzeitig auch seine Gefühle mitspielen zu lassen: er soll die ruhige,
279
romantische Stimmung, die in Heidelberg herrschte, genießen und seine
Vorstellungen über diese historische Stätte erfrischen. Das Präteritum
ermöglicht es, schöne Bilder mit einem leichten Hauch der Vergangen-
heit zu überziehen. Einige Sätze, die den Anfang und den Schluss des
Textes gestalten und Heidelberg gewidmet sind, bilden einen wertvollen
Rahmen für die Schilderung der letzten Ereignisse und messen ihnen
auch einen bestimmten Wert bei. Nun gewinnen sie auch an Bedeutung
und gehören in die Geschichte. Das Informieren über die letzten Ereig-
nisse zerstören diesen Eindruck keinesfalls, denn sie sind auch im Prä-
teritum dargeboten.
Das Erzählklima wird durch die Einschaltung der direkten
Rede belebt, wo selbstverständlich auch die Zeitformen der „bespro-
chenen Welt“ erscheinen: das Präsens (...schreibe ich in all meinen Ro-
manen...), das Perfekt (...Jean Paul und Mark Twain sind... gefahren)
und das Futur (In Erinnerung behalten wird er...). Die Einfühung der di-
rekten Rede mit den präsentischen Zeitformen verleiht dem Text einen
dokumentarischen Charakter und verstärkt seine Gebundenheit an die
Realität. Dieser Eindruck wird auch durch genaue Angaben über das Al-
ter der Stipendiaten und über die Buchtitel unterstützt.
Die Leistung des Tempussystems in diesem Text besteht auch im
Schaffen der Textkohärenz: gleiche Zeitformen tragen dazu bei,
dass einzelne Sätze zu einem Textganzen verbunden werden, inhaltlich
und auch strukturell.
Polytemporal ist die Textsorte Erinnerungen. Sie besteht ge-
wöhnlich aus einigen Episoden. Der Autor greift dabei zu verschiedenen
Zeitschichten, Vorblenden und Rückblenden und gestaltet seinen Text
als ein buntes Bild, das voller subjektiver, individueller Einschätzung ist.
Gewöhnlich erscheinen da dementsprechend drei oder vier Zeitformen,
die ein temporales Diskontinuum schaffen, den Text aber lebendig und
farbenfroh machen und das Leben in seiner beweglichen Vielfalt darstel-
len.
Polytemporal sind auch die meisten Pa rabeln. Ihre Polytempora-
lität ist durch ihre Pragmatik bestimmt. Die Parabel schildert in der Re-
gel eine Geschichte, etwas „Aus-dem-Alltag-Gegriffenes“: Der Anfang
ist faktual und wird in der Mitte weiterentwickelt. Die Verben stehen
hauptsächlich im Präteritum, was für einen narrativen Text charakteris-
tisch ist. Weil die Parabel zu den „belehrenden“ Texten gehört, enthält
ihr Schluss gewöhnlich eine Moral, also einen Gedanken, der für alle
Zeiten gültig ist. Diese Gültigkeit für alle Zeiten gibt das Präsens wieder.
Das Präteritum und das Präsens in ihrem Zusammenwirken machen
den Text der Parabel polytemporal.
Wie bekannt, wird in manchen belletristischen Texten die
Hauptidee nicht explizit, sondern implizit gegeben. Der Leser soll
sie aus dem Sprachmaterial, aus der Textkomposition „herauskriegen“.
Dazu kann auch die temporale Struktur beitragen. Versuchen wir das am
Beispiel einer lyrischen Miniatur zu veranschaulichen.
280
Im Hofe
Gestern ging ein Gewittergruß nieder. Die Hafersaat dankt grün für den
Kopfdung.
Am Loch des Starenkastens gieren die Jungstare mit gelbgerandeten
Schlünden. Die Schwalben fliegen wieder hoch. Sie fangen Federn für ihre
Nester. Im Bachtal schäumt das Wiesenkraut, und die Fliederdolden senden
duftende Liebestelegramme an Kleinkäfer und Geziefer.
Im Gärtchen wachsen die Blumen ein.
Bald werden sie blühn, aber werden sie verraten, wie man aus Hofsand Duft
und Farben macht? (E. Strittmatter)
Dieser Text ist eine von 200 Miniaturen des Buches „Schulzenhofer
Kramkalender“. Ihrem Charakter nach sind sie den Kalendergeschich-
ten und Notizen aus dem Tagebuch ähnlich. Dabei sind sie zweifellos
lyrische Texte, mit einem tiefen Gefühl des Autors gefärbt, von seinen
innigsten Empfindungen durchdrungen. Nach Meinung von T. I. S s i 1 -
man ist jeder Text aus einem Tagebuch, jede Notiz außerordentlich
wichtig sowohl für den Autor, der seine Ansichten zu äußern sucht, als
auch für den Leser, der danach strebt, die Welt des Autors zu begreifen.
Diese Texte sind immer „ein Knoten der Gedanken“. Deshalb
soll jeder Text aus dem Tagebuch eingehend untersucht und allseitig
kommentiert werden. Man soll ihn in Zusammenhang mit der Gegen-
wart und der Vergangenheit bringen und auf die Zukunft projizieren. Er
soll als ein Teil des gesamten Schaffens betrachtet werden [s. CmibMaH,
1977].
Vom Standpunkt der dichterischen Zeit aus gibt es im Text „Im
Hofe“ drei Schichten: „gestern“, „heute“ und „morgen“ (oder „bald“),
das heißt, die nächste Zukunft. Sie werden durch entsprechende Zeit-
formen arrangiert — das Präteritum, das Präsens und das Futur — und
bilden eine ununterbrochene Linie. Die Richtung der dichterischen Zeit
entspricht der Richtung der objektiven Zeit. Dabei wird der heutige Tag
als Resultat des gestrigen und als eine Grundlage für den morgigen Tag
beurteilt. Die Idee der Erblichkeit, einer ununterbrochenen Entwick-
lung wird dank der grammatischen Zeitformen hervorgehoben. Das ent-
spricht vollkommen einer Tendenz in der modernen Literatur, die den
größten Schriftstellern unserer Epoche eigen ist. Sie besteht darin, dass
die Aufeinanderfolge verschiedener Zeitperioden in ihrer Verbunden-
heit, in ihrem Zusammenhang gezeigt wird, sei es ein großes episches
Werk oder ein kleines lyrisches Gedicht [s. MoTbuieua, 1974].
§ 64. Die Kategorie der Zeit in verschiedenen Funktionalstilen
Im künstlerischen Werk schafft der Autor eine fiktive Welt,
in der fiktive Personen leben und handeln. O. I. Moskalskaja
schreibt über die Bezogenheit des literarischen Textes auf die Wirklich-
keit: Der Text bezieht sich aber auf die Wirklichkeit auf eine Weise, die
281
für die belletristische Literatur spezifisch ist. Er bezieht sich auf eine be-
sondere künstlerische Welt, die auf der Vorstellungskraft des Schriftstel-
lers beruht und Fiktives und Reales miteinander verknüpft [vgl. Mos-
kalskaja, 1984, P7].
Über diese Verknüpfung des Fiktiven mit dem Realen spricht
Christa Wolf in einem Aufsatz über die schöngeistige Literatur:
„Lassen wir Spiegel das Ihre tun: spiegeln. Sie können nichts anderes.
Literatur und Wirklichkeit stehen sich nicht gegenüber wie der Spiegel
und das, was gespiegelt wird. Sie sind ineinander verschmolzen im Be-
wußtsein des Autors“ [Wolf, 1985, 55].
Die vom Autor erfundenen Personen leben und wirken in einem be-
stimmten Ort und in einer bestimmten Zeit. Ort und Zeit der Handlung
können explizit gegeben werden oder implizit angedeutet, d.h. sie erge-
ben sich aus der Situation. Der Leser ist in der Regel über Zeit und Ort
der beschriebenen Ereignisse hinreichend informiert. Fehlende oder un-
zureichende Orts- und Zeitangaben im Mikrotext kompensiert der
Großtext [vgl. Moskalskaja, 1984, 111].
In einigen Genres fehlen objektive Angaben des Ortes und der Zeit.
So heißt es in den Märchen bei völliger Loslösung der Fiktion von
der Wirklichkeit: Es lebte einmal...; Es war einmal in einem Königreiche
In der Fabel fehlen oft sogar unzureichende Angaben. In diesem Fall
spricht man von Nullindizien:
Äsopus und der Esel
Der Esel sprach zu dem Äsopus: Wenn du wieder ein Geschichtchen von
mir ausbringst, so laß mich etwas recht Vernünftiges und Sinnreiches sagen.
Dich etwas Sinnreiches! sagte Äsop; wie würde sich das schicken? Würde
man nicht sprechen, du seist der Sittenlehrer und ich der Esel? (G. E. Lessing)
Für die Fabel, deren Gestalten symbolisch und der Inhalt belehrend
sein soll, ist nicht von Beleg, wann und wo etwas geschah. Ihr Wesen ist
der allegorische Sinn, den der Leser erkennen soll und der be-
sonders deutlich in der Moral ausgedrückt wird.
Die meisten epischen Texte sind aber im Präterit geschrieben. Es
schafft „das Erzählklima“ und gilt als grundlegende Zeitform der bellet-
ristischen Literatur. K. Hamburger nennt das Präteritum in der Er-
zählung das „narrative“ oder „epische“ Präteritum. Es verliert bei fiktio-
nalem Erzählen seine grammatische Funktion und bezeichnet nicht mehr
das Vergangene. K. Hamburger zeigt es am Beispiel des Satzes Herr X war
auf Reisen. Dieser Satz bekommt in verschiedenen Sprechsituationen un-
terschiedliche Zeitbedeutungen. Als Äußerung über die Wirklichkeit be-
zeichnet er die Vergangenheit. Das Präteritum drückt aus, dass das Ereig-
nis vor dem Zeitpunkt der Rede stattgefunden hat. Wenn dieser Satz im
Roman erscheint, so versetzt er den Leser in die Gegenwart der Roman-
handlung. Der Satz bedeutet: Herr X ist auf Reisen.
Das epische Präteritum lässt sich mit den Adverbien „heute“ und
„morgen“ verknüpfen. So sind in der Belletristik solche Sätze durchaus
282
möglich wie: Heute durchstreifte er zum letzten Mal die europäische Hafen-
stadt, denn morgen ging sein Schiff nach Amerika [s. Hamburger, 1968, 65].
Die Vergangenheit in der epischen Erzählung wird nach K. Hamburger
nur durch das Plusquamperfekt wiedergegeben. Im Romantext kann es
heißen: Morgen war Weihnachten und niemals: Gestern war Weihnachten,
sondern nur: Gestern war Weihnachten gewesen [Hamburger, 1968, 66],
Die Aufgabe des Präterits besteht also darin, nicht auf die Vergangen-
heit zu verweisen, sondern eine bestimmte Distanz zwischen der Zeit
des Lesers und der Erzählzeit zu schaffen, eine Barriere zwischen der
realen und der fiktiven Welt. Im Text entsteht eine ruhige, spannungslo-
se Atmosphäre. Dabei lässt der Autor den Leser nicht mitwirken, son-
dern das Beschriebene „aus der Feme“ beobachten und ihn eine objek-
tive Einschätzung geben.
Originell, obwohl nicht unumstritten sind die Überlegungen von
Jost T r i e r, die er vor 40 Jahren in einem Beitrag über die Zeitform
im heutigen Deutsch geäußert hat. Einerseits sind vier Jahrzehnte ein
bedeutender Zeitabschnitt für die Entwicklung einer Sprache, für die
Bereicherung ihres Wortschatzes, was auf bestimmte Prozesse im Leben
der ganzen Gesellschaft zurückzuführen ist. Andererseits ist dieser Ab-
stand nicht groß genung, um bedeutende Veränderungen im grammati-
schen Sprachbau zu verzeichnen. Deshalb sind die Ansichten von
J. Trier auch heute aktuell und können für die gegenwartsorientierte
Sprachanalyse von Interesse sein.
J. Trier stellt zwei Formen einander gegenüber: das Imperfekt (das
Präterit) und das Perfekt. Das Imperfekt nennt er eine „Erzählvergan-
genheit“, das Perfekt ~ eine „Vorgegenwart“: „Wo ich die Nachwirkung
nicht ins Auge fasse, ... brauche ich das Imperfekt. ...Wo ich rückbli-
ckend urteile, diskutiere, Folgen bemerke, für mich und meine Hörer
Folgerungen ziehe, brauche ich das Perfekt“ [J. Trier, 1966, 77]. Diese
Erzählvergangenheit ist durch Mangel an affektischer Beteiligung des
Autors, durch Zurückhaltung des Urteils, durch gleichmäßig verteilte
Liebe, durch sehr geringe Beteiligung der Rechtfertigung, der Klage und
der Anklage gekennzeichnet. Die Erzählvergangenheit ist für J. Trierdas
Tempus der Entängstigung, des Entlastetseins von aller Verantwortung.
Die Vorgegenwart (das Perfekt) wird gekennzeichnet durch affektive
Beteiligung des Sprechenden, durch den Aufruf zu innerer Beteiligung
der Hörer, durch die Nähe zu Rechenschaft, Rechtfertigung und Verant-
wortung, durch die Affinität zu allem, was Gewissen ist und sagt. Das
umschreibende Perfekt ist die Redeweise, die den Redenden als einen in
der Angst, in der Sorge und in der Verantwortung Stehenden darstellt
[s. Trier, 1966, 72].
Die unmittelbare Verbindung zwischen dem emotionalen Zustand
des Autors und dem Gebrauch einer grammatischen Zeitform kann als
strittig gewertet werden, verdient, aber ohne Zweifel Aufmerksamkeit ei-
nes engagierten Sprachforschers, um unterstützt oder widerlegt zu wer-
den.
283
Das Präterit ist die führende Zeitform, aber bei weitem nicht die ein-
zige, die in der Erzählprosa erscheint. Neben dem Präteritum kann
in den belletristischen Texten auch das Präsens gebraucht werden. Es
wirkt in diesem Fall wie das Präterit: es verliert seine Hauptbedeutung
(die Angabe der Gegenwart) und bekommt die Benennung „erzäh-
lendes Präsens“. Als Beispiel sei E.Strittmatters berühmter Ro-
man für Kinder „Tinko“ erwähnt, wo die ganze Handlung, die Erinne-
rung des Autors an die Kindeijahre, im Präsens geschildert wird.
Es kann auch das historische Präsens sein, mit seiner Bele-
bung der Handlung:
Die Uhr hat zu Ende geschlagen, Nelly rennt zum Flurspiegel und glättet
mühelos das Gesicht. (Da stand also schon die weiße Flurgarderobe mit dem
viereckigen Spiegel.) Der Antwort auf die brennende Frage, ob Liebe wirklich
um kein Stück kleiner wird, wenn man sie unter mehrere aufteilt, ist sie nicht
nähergekommen. Dummchen, sagt die Mutter, meine Liebe reicht doch für
dich und das Brüderchen. (Chr. Wolf. „Kindheitsmuster“)
Das Präsens entsteht auch in einem belletristischen Werk in
den Äußerungen über die Wirklichkeit, die in den Text eingeflochten
sind und mit einer bestimmten künstlerischen Idee beladen sind:
Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es
von uns ab und stellen uns fremd. (Chr. Wolf. „Kindheitsmuster“)
Solche Texte nennen noch nicht die erdachten Personen der fiktio-
nalen Welt. Der Leser wird dadurch noch nicht aus der Welt der Realität
in die Welt des Künstlers versetzt. Es ist nur eine Äußerung über die
Wirklichkeit und enthält deshalb die entsprechenden Tempusformen
[s. Moskalskaja, 1984, 144\.
In Bezug auf das Genre und die Textsorte lassen sich einige Tenden-
zen im Zeitformengebrauch nachweisen. So herrscht im Roman wie
gesagt hauptsächlich das Präteritum, obwohl auch da einige Varian-
ten vorkommen.
In der Kurzgeschichte überwiegt laut Meinung von L.Rohner
das Präteritum. Das historische Präsens wird auffallend selten ver-
wendet, meist bloß in kurzen Einblenden und ist auch „nur ein Notbe-
helf*. Noch seltener werden kleine Passagen im Futur erzählt. Be-
merkenswert ist auch die darauffolgende Erklärung, warum eigentlich
das Präteritum in der Kurzgeschichte erscheint: Das Feld des Kurzge-
schichtenautors ist nicht die Übervergangenheit, sondern die Vor ge-
gen wart. „Seine“ Zeit wäre das Perfekt, denn die Kurzgeschichte
schöpft aus der Vorgegenwart, aus der jüngsten Vfergangenheit. Darin
gibt es sehr viel von der Gegenwart. Diese Vergangenheit hat der Autor
miterlebt, sie ist für ihn nicht abgetan, abgelebt. Doch sind Texte mit
lauter Vferben in dieser zusammengesetzten Form untauglich.
Der Autor der Kurzgeschichte strebt auch danach, das Dargestellte
zu vergegenwärtigen. Diese Vergegenwärtigung erreicht er durch ver-
schiedene Verfahren:
284
1. Durch das Durcherzählen in einem Zug, ohne We c h s e 1 der
Erzählebene. Dabei gibt es weder ein Vorgreifen (Später sollte er er-
fahren, dass..,) noch ein Zurückgreifen (Einst hatte er gehofft, dass...).
Die Reihenfolge ist richtig. Der Erzähler gerät nie ins Bild. Die Zeit
wird gerafft. Die Formel dieses Erzählens ist: „Dann... und dann...“.
2. Durch das Verfahren, wenn der Erzähler hin und wieder in den
Hintergrund tritt, und die Zeit „erzählt sich selbst“. Dazu verwendet der
Autor zwei Methoden:
a) die P a n o r a m a t e c h n i k, die auf der Montage beruht. Es gibt
keine Fabel mit profilierten Figuren. Die Zeit fuhrt den Leser;
b) das „freischwebende“ Selbstgespräch. Es wird meist
in der ZcA-Form geführt. Es wird versucht, den Leser mit dem Erzähler
gleichzusetzen [vgl. Rohner, 1976, 186—208].
Es lassen sich auch in den anderen Genres bestimmte Gesetzmäßig-
keiten beim Zeitformengebrauch feststellen.
Die Novelle ist von der temporalen Seite her nicht einheitlich.
Ihre Blütezeit fallt auf das 19. Jahrhundert. Die Werke von T. Storm,
P. Heise, B. Auerbach, A. Chamisso und T. A. Hoffmann enthalten in der
Regel keine Hinweise auf die objektive Zeit und nur synsemantische
(nicht selbstständige) Zeitangaben: hier, da, danach, vorher usw. In den
Novellen des 20. Jahrhunderts, die von F. Fühmann, A. Seghers,
E. Neutsch, E. Panitz und W. Bredel geschaffen wurden, finden wir ein
enges Zusammenwirken zwischen objektiver und künstlerischer Zeit. In
den Texten erscheinen genaue Daten, Realien, es werden reale histori-
sche Ereignisse genannt, die die erzählte Geschichte in der objektiven
Zeit anordnen. Als Genre ist die Novelle hauptsächlich polytemporal.
Die Basisformen sind das P r ä t e r i t und seltener das Präsens. Sie
kann retrospektive Einblenden haben [s. JleßqeHKo, 2003, 109].
Die Anekdote und der Witz werden in der deutschen Literatur-
wissenschaft als selbstständiges Genre behandelt. Es wurde auch eine
„Anekdotentheorie“ ausgearbeitet. Als Klassiker dieses Genres gilt
W. S c h ä f e r, der diese beinahe vergessene Kunstart ins Leben zurück-
gerufen hat. Als temporale Hinweise können in der Anekdote die Er-
wähnung oder Beschreibung historischer Ereignisse, Daten oder Namen
berühmter Menschen gelten (ebenda). Wenn wir unter dem Witz eine
lustige kurze Geschichte aus dem Alltagsleben verstehen, in der das Er-
eignis sehr knapp und humorvoll dargestellt wird, so können wir feststel-
len, dass der Witz an die objektive Zeit nicht gebunden ist. Da der Witz
oft zwei Bestandteile hat — die Autorenrede und die Repliken der Per-
sonen,—so kann er auch poly temporal sein:
Der Friseur fragt einen Kunden nach seinen Wünschen. Der sagt: „Ich
möchte gern die linke Seite ganz glatt, rechts zehn bis elf Stufen, vorn ein paar
Haare in die Stirn, und hinten eine Strähne, die über die Anzugjacke fällt.
Der Friseur schüttelt den Kopf: „Das kann ich nicht.“ „Wieso nicht?“
fragt der Kunde. „Vor drei Wochen haben Sie mir die Haare doch auch so ge-
schnitten.“
285
Die Parabel als ein Text allegorischen, belehrenden Charakters
hat ihre Besonderheiten. Sie entsteht und existiert nur um zu belehren,
wie man in einer konkreten Situation handeln muss. In der Parabel fehlt
jegliche Beschreibung: weder die Natur noch die Charaktere der Men-
schen werden dargestellt. Aber die Parabel neigt zu einer tiefen „Weis-
heit“ religiöser oder moralistischer Art. Seinerzeit war sie Vbrbild für an-
dere Genres didaktischen Charakters (die frühchristliche und mittelal-
terliche Literatur). Im 20. Jahrhundert greifen F. Kafka, B. Brecht,
A. Camus [ka'my:] und J.-P. Sartre [sartr(o)] zur Parabel [s. JIcb^chko,
2003, 165}. Die Parabel lässt sowohl retrospektive als auch prospektive
Einblenden machen. Ihre Basisform ist das P r ä t e r i t, aber die Parabel
ist polytemporal, denn sie kann außer der Autorenrede auch die direkte
Rede der handelnden Personen enthalten. Außerdem kann auch die
Moral im Präsens gestaltet werden:
Merke: Man muß in der Ferne nichts tun, worüber man sich daheim nicht
darf finden lassen.
Merke: Es gibt Untertanen, über welche kein Gras wächst. (P. Hebel)
Das Märchen als ein Genre der Xblkspoesie unterscheidet sich
von den anderen (Sage, Legende) dadurch, dass der Märchenerzähler
und die Hörer es wie eine poetische Erdichtung aufnehmen. In tempo-
raler Hinsicht hat das Märchen keine genauen Angaben. Es ist poly-
temporal: die Basisform ist das Präterit, in der direkten Rede der
Märchengestalten sowie auch in den Anfangs- und Schlussformeln, wo
der Autor sein Ich einführt, erscheinen das Präsens und das Per-
fekt.
Das heute populär gewordene Genre der Kriminalgeschichte
und des Kriminalromans gehört zur so genannten „Unterhal-
tungsliteratur“: das spannende Sujet, verwickelte Wege, die die Roman-
helden gehen sollen, um ans Ziel zu gelangen, reißen die Leser mit. Die
Kriminalgeschichte ist entweder im Präterit oder im Präsens ge-
schrieben, hat zahlreiche retrospektive Einblenden, was durch das Sujet
bedingt wird, und ist polytemporal [s. JIcb^chko, 2003, 212— 217}.
Wenden wir uns den künstlerisch-dokumentarischen Genres zu, so
finden wir auch da einige Charakteristiken der temporalen Textstruktur,
die für das Genre typisch sind.
Das Essay kennt zwei Arten: das dokumentarische und das künst-
lerische Essay. Das Typische für beide Arten ist die Charakteristik der
Menschen, die als Träger von Mängeln oder Tugenden auftreten. Oft ist
das Essay satirisch zugespitzt, indem der Autor danach strebt, die Objek-
te seines Interesses allseitig zu zeigen. Deshalb werden in den Text pros-
pektive und retrospektive Einblenden eingeführt, die den Text polytem-
poral gestalten. Die Basisform ist das Präterit [vgl. JleßqeHKo, 2003,
229—231}.
Wie das Wesen der Memoiren schlussfolgern lässt, enthalten sie
viele retrospektive Episoden und sind also polytemporal.
286
Der Privatb rief hat als Hauptform das Präsens, lässt aber
auch andere, hauptsächlich präsentische Formen zu. Für den Brief sind
auch retrospektive und prospektive Teile typisch. Dieses Genre wird oft
in der künstlerischen Literatur nachgeahmt: Manche Novellen werden
in Form eines Privatbriefes geschrieben (z. B. St. Zweigs „Der Brief eines
Unbekannten“) oder der Brief erscheint im Text als ein Schalttext, als
„Text im Text“. In diesen Fällen bleibt die Struktur des Briefes erhalten.
Indem die epischen Formen der Dichtung durch den Gebrauch des
Präteritums gekennzeichnet sind (sie heißen auch „Formen mit Prä-
teritalbasis“), ist für die lyrische Poesie das Präsens typisch.
Das lyrische Gedicht ist die Widerspiegelung des Jetzt-Empfindens des
Autors, für dessen Darstellung im Text sich besonders gut das Präsens
eignet.
Im Drama erscheinen alle Zeitformen, die die „besprochene Welt“
charakterisieren. Die Repliken der handelnden Personen enthalten die
Verben in präsentischen Formen (das Präsens und das Perfekt),
weil sie die mündliche Alltagsrede nachahmen, mit ihrer Vielfalt von
Zeitformen und Zeitformenübergängen. Der Text eines dramatischen
Werkes hat dazu noch mehrere Bühnenanweisungen, die, falls sie aus
zweigliedrigen Sätzen bestehen, auch mit Hilfe des Präsens gestaltet
werden.
§ 65. Das Temporalnetz und seine Aufgaben im Text
In den anderen Funktionalstilen hängt die temporale Struktur von
der pragmatischen Aufgabe des Textes ab.
In Zeitungstexten^ die dazu berufen sind, aktuelle Ereignisse
und Probleme zu beleuchten, spielen genaue Hinweise auf Zeit und Ort
der Handlung eine unbestreitbar große Rolle.
Der Zeitungsstil ist durch präzise Zeit- und Ortsangaben gekenn-
zeichnet. Reportagen, Mitteilungen, Zeitungsberichte und andere Gen-
res enthalten genaue Hinweise darauf, in welchen zeitlichen und örtli-
chen Rahmen sich das Ereignis abspielt. Sie sind hauptsächlich poly-
temporal:
Über drei Millionen Haushalte beziehen Wohngeld
Wiesbaden — Die Zahl der Haushalte mit Wbhngclduntcrstützung ist im
Jahr 2002 erneut um zehn Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt
am Montag in Wiesbaden mitteilte, betrug die Zahl der Empfänger-Haushalte
Ende 2002 rund 3,1 Millionen. Dies seien acht Prozent aller Haushalte in
Deutschland. Die Gesamtausgaben betrugen im Jahr 2002 bundesweit rund
4,5 Mrd. Euro. Dies sind 11,8 Prozent mehr als im Jahr davor. („Die Welt“)
Im Stil der Wissenschaft hängt der Gebrauch der Zeitfor-
men vom Thema ab. Wenn der Autor ein historisches Ereignis be-
schreibt, so sind Daten und andere temporale Angaben ein untrennbarer
287
Teil der inhaltlichen Textstruktur. In anderen Forschungsbereichen kön-
nen sie entweder nicht so reichlich vertreten sein oder sogar fehlen: es
wird verallgemeinert, definiert, erörtert, das allgemein Gültige formu-
liert, was eigentlich keine Positionierung in Zeit und Ort braucht:
Das Wesen der Polysemie und Homonymie besteht darin, dass mit einer
Form verschiedene Bedeutungen verknüpft sind.
Im Stil des öffentlichen Verkehrs gibt es auch große Unter-
schiede. In der Gebrauchsanweisung sind die Nullindizien durch die
Pragmatik des Textes zu erklären:
Die Anleitung beschreibt hauptsächlich mit der Fernbedienung ausgeführte
Bedienungsvorgänge, doch die gleichen Bedienungsvorgänge können auch mit
den Tasten am Gerät ausgeführt weiden, welche die gleiche oder die ähnliche
Bezeichnung aufweisen.
Der Lebenslauf enthält stets explizite temporale und lokale An-
gaben. So werden in einem Programmheft die Teilnehmer des musikali-
schen Wettbewerbs „Franz Schubert und die Musik der Moderne“ vor-
gestellt:
Anna Bruner. Geboren 1972 in der Schweiz. Mit drei Jahren Beginn des Vio-
linspiels. Preisträgerin einiger Jugendmusikwettbewerbe. Geigerische Ausbildung
bei Elisabeth und Rudolf Weber-Erb und bei Thomas Füri an den Konservatorien
Zürich und Basel. 1992 Abschluß mit Lehrdiplom, 1995 Konzertreifediplom mit
Auszeichnung. Zweifache Gewinnerin des „Kiefer-Habitzel“-Stipendiums. Von
1989 bis 1996 Mitglied des Kammerensembles ARS AMATA ZÜRICH.
Im Text als einem Ganzen wirken also alle grammatischen und lexi-
kalischen Einheiten und Kategorien zusammen. Das enge Zusammen-
wirken der lexikalischen und grammatischen Einheiten wurde auch frü-
her beobachtet und beschrieben. So entstand der heute weit gebrauchte
Begriff „Feld“, dessen Ausarbeitung schon in den 20er Jahren des
20. Jahrhunderts begann. Das Feld vereinigt alle in der Sprache existie-
renden Einheiten, die zum Ausdruck eines semantischen Sachverhalts
dienen — der Temporalität, der Modalität, der Pluralität usw. So existie-
ren dementsprechend das Feld der Zeit (das Temporalfeld und das Tem-
pusfeld), das Feld der Modalität, das Feld der Pluralität. Einige Felder
haben eine komplexe Struktur und werden in einige Mikrofelder geglie-
dert. So besteht z.B. das Feld der Zeit aus drei Mikrofeldem: dem
Mikrofeld der Gegenwart, dem Mikrofeld der Ver-
gangenheit und dem Mikrofeld der Zukunft.
Jedes Feld hat eine und dieselbe Struktur. Es besteht aus dem Kem,
oder der Dominante, und der Peripherie. Den Kern bildet das univer-
sellste Mittel, das den betreffenden Sachverhalt besonders deutlich zum
Ausdruck bringt. Periphere Sprachmittel sind diejenigen, die den
Sachverhalt nicht so intensiv ausdrücken.
Den Kem des Temporalfeldes bilden die verbalen Zeitformen. Sie
sind ein universelles und ein obligatorisches Mittel des Zeitausdrucks.
288
Die meisten Sätze in der deutschen Sprache sind zweigliedrig und ha-
ben ein Verb als Prädikat in einer bestimmten Zeitform. Alle anderen
Mittel erscheinen im Text nicht so regelmäßig. Das können Substanti-
ve und Adjektive mit temporaler Bedeutung sein (Jahr, Stunde, heutig),
temporale Adverbien (jetzt, morgen), temporale Konjunktionen (nach,
bevor, ehe, sobald, sogleich u.a.), Infinitiv I und Infinitiv II, die die
Gleichzeitigkeit oder die Vorzeitigkeit der Handlung in Bezug auf die
Handlung des Prädikats ausdrücken, Partizipien I und II, Wortbil-
dungsmittel (Präfixe und Halbpräfixe wie Vor-, Nach-, Post-, Ur-
usw). Für eine genaue Zeitangabe wird ein Zahlwort in den Text ein-
geführt (im Jahre 1945).
Eigentlich erfüllen die grammatischen und lexikalischen Mittel bei
der Zeitangabe verschiedene Funktionen. Die grammatische
Zeit bestimmt, ob über die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft
gesprochen oder geschrieben wird und ob es sich um die Gleichzeitig-
keit, Vorzeitigkeit oder Nachzeitigkeit handelt (das zeitliche Xferhältnis
wird auch mit Hilfe der Partizipien I und II und der Infinitive I und II
zum Ausdruck gebracht).
Die lexikalischen Mittel konkretisieren den zeitlichen Plan
und das zeitliche Verhältnis zwischen den Ereignissen, präzisieren und
modifizieren die Zeitbedeutung. Semantisch können sie auch stärker
sein als die Zeitform des Verbs und sie neutralisieren. Im Satz Morgen
komme ich um fünf Uhr ist das Adverb „morgen“ stärker als das Präsens
und bestimmt den Bezug auf die Zukunft. So entsteht die Transposition
einer Zeitform auf der Ebene einer anderen — wie gesagt kann das Prä-
sens auch eine Handlung in der Zukunft oder in der Vergangenheit be-
zeichnen (futurisches oder historisches Präsens), das Perfekt wird in Be-
zug auf die Zukunft gebraucht (z. B. im nachdem-SaXz).
Grammatische und lexikalische Mittel, die eine gemeinsame Bedeu-
tung zum Ausdruck bringen, sind unter dem Begriff „Feld“ vereinigt.
Heutzutage spricht man über das grammatisch-lexikalische Feld (E. Iy-
jibira, E. UleHziejibc), bzw. über das grammatisch-semantische Feld
(K.-E. Sommerfeldt, G. Starke). Unabhängig davon, welcher Terminus
gebraucht wird, handelt es sich in allen Fällen um die Gesamtheit a 1 -
I e r sprachlichen Mittel, seien es grammatische, lexikalische oder Wort-
bildungsmittel, die einen semantischen Sachverhalt ausdrücken. Es geht
also um eine pragmatische Kategorie.
In einem konkreten Text können wir nur einige Bestandteile des
grammatisch-lexikalischen Feldes treffen. Aus dem umfangreichen Feld
werden nur die Elemente erwähnt, die für die Gestaltung des Textes un-
entbehrlich sind und den Forderungen des Genres und des Funktional-
stils entsprechen.
Die Gemeinschaft der sprachlichen Mittel, die als Realisierungdesgram-
matisch-lexikalischen Feldes im konkreten Text auftreten, heißt Textnetz.
Im Unterschied zum Feld ist das Netz eine syntagmatische
Kategorie, die Kategorie des Textes.
289
Umfang und Bestand des Textnetzes sind in verschiedenen Texten
unterschiedlich. Sie hängen von vielen Faktoren ab. Dazu gehören der
Inhalt des Textes und seine pragmatischen Ziele, die Besonderheiten
des Funktionalstils, des Genres, der Textsorte, des individuellen Stils
des Autors. In einigen Texten ist das Temporalnetz verzweigt und um-
fangreich, in anderen gering.
So enthält das Temporalnetz einer Ze itungsmeldung in der Re-
gel genaue Zeitangaben:
Frankfurt, 28. April. Der Landesvorsitzende der Berliner CDU, Christoph
Stölzl, will auf einer Vorstandssitzung am Montag Abend vermutlich mitteilen, ob
er auf dem Parteitag am 24. Mai abermals für den Parteivorsitz kandidieren wird.
Der Autor eines Zeitungsartikels, der umfangreicher ist als eine Zei-
tungsmeldung, nimmt Stellung zu einem aktuellen Problem, erörtert die
Position der Redaktion und behandelt Schwerpunkte. Deswegen besteht
sein Temporalnetz in der Regel aus den Verben in einer präsentischen
Form (im Präsens oder im Perfekt), aus temporalen Adverbien und Ad-
jektiven (heute, gestern, bald, jährlich, täglich u.a.), temporalen Kon-
junktionen (als, wenn, bis usw.) und genauen Zeitangaben (Substantiv
mit einem Zahlwort).
Der Bestand des Temporalnetzes hängt, wie gesagt, in bedeutendem
Maße vom Genre und Funktionalstil ab. Die pragmatische Zielstellung
diktiert auch die Wahl der sprachlichen Mittel, die den Text gestalten.
Wenn für einen belletristischen Text die ästhetische Funktion von be-
sonderer Bedeutung ist, so verfolgt der Autor eines Zeitungstextes ande-
re Ziele, was sich in der Wahl der Sprachmittel widerspiegelt. Zeigen wir
das am Beispiel des folgenden Textes:
Peter Handke, 60, Poet („Über die Dörfel), hat am 18. Juni die Ehrendok-
torwürde der Universität Salzburg „für seine Verdienste um Wissenschaft und
Kunst“ erhalten. Handke lebte von 1979 bis 1987 in Salzburg, wo er u.a.
„Nachmittag eines Schriftstellers“ schrieb. Zuletzt veröffentlichte er eine Über-
setzung des altgriechischen Dramas „König Ödipus“ von Sophokles — es wurde
im Mai am Wiener Buigtheater uraufgeführt. („Bunte“, 2003, N° 26)
Das Temporalnetz dieses kurzen Berichtes (Rubrik „Personalien“)
besteht aus fünf Vollverben in zwei Zeitformen: im Eröffnungsperfekt
(...hat ...erhalten) und im Präteritum (...lebte ...schrieb ...veröffentlichte
...wurde urauf geführt). Auch da leistet das Präteritum seine Dienste: es
schafft eine ruhige Atmosphäre des Berichtens über ein stattgefundenes
Ereignis. Die pragmatische Aufgabe dieses Textes — die Leser über die
letzten Ereignisse zu informieren — verlangt auch genaue Zeitangaben,
die mit Hilfe von Substantiven mit temporaler Bedeutung und Numera-
lien, die die Zeit konkretisieren, in den Text eingeführt werden (am 18.
Juni... von 1979 bis 1987... im Mai). Ein Glied des Temporalnetzes ist
auch das Zeitadverb „zuletzt“. Ein mehrgliedriges Temporalnetz mit ge-
nauen Zeitangaben ist für diese Textsorte kennzeichnend. Das Anliegen
des Autors — in einer knappen Form möglichst viel Information zu ge-
290
ben — ist erreicht. Der Text enthält keine Epitheta, keine Vergleiche
oder andere auffallende Stilistika. Er wirkt sachlich, präzise, informativ.
Die Textsorte Chronik ist zeitgebunden. Die Chroniken beschrei-
ben eine historische Zeitperiode oder ein historisches Ereignis und ent-
halten deswegen genaue Zeitangaben:
16. Juli 1969: Der erste Mensch betritt den Mond
Ein ununterbrochener Fortschrittoptimismus bestimmt das Lebensgefühl der
60er Jahre. Mit der Landung von zwei US-Astronauten auf dem Mond erfüllt
sich ein jahrhundertealter Traum der Menschheit. In den kommenden Jahrzehn-
ten verstärken sich die Bemühungen — auch in Zusammenarbeit zwischen Ost
und West — die Lebensbedingungen im All zu erforschen und Alternativen zum
Leben auf der Erde zu untersuchen. (Chronik des 20. Jahrhunderts)
Die temporale Struktur des Textes entspricht der Intention des Au-
tors: in einer kurzen Form eine knappe aber auch möglichst volle Infor-
mation über ein historisches Ereignis zu geben, es auf der Zeitachse an-
zuordnen, seine Auswirkung auf die Weltgeschichte zu deuten und die
Haupttendenzen im öffentlichen Leben zu verzeichnen. Das Temporal-
netz besteht aus folgenden Gliedern: dem Präsens, das das zu schildern-
de Ereignis lebendig macht, den temporalen Substantiven (Juli, Jahre,
Jahrzehnte), den Numeralien (16., 1969, 60er), die eine genaue zeitliche
Charakteristik geben und das Ereignis besonders genau in der Weltge-
schichte fixieren, einem temporalen Adjektiv (jahrhundertealt) und ei-
nem Partizip I (kommend). Dieser Bestand des Temporalnetzes ist für
die Textsorte „Chronik“ eigentlich typisch.
Auf genauen temporalen Angaben ist der Text der Bi ografi e ge-
baut. Das folgt aus der pragmatischen Zielstellung dieser Textsorte: in
einer knappen Form, sachlich und ohne jegliche persönliche Beteiligung
über die wichtigsten Etappen im Leben eines Menschen zu informieren:
Elke Erb, 18.2.1938 Scherbach (Eifel). Erb siedelte 1949 in die DDR über;
sie studierte, unterbrochen durch längere Arbeit in der Industrie, 1957—63
Germanistik und Slawistik in Halle, arbeitete dann als Verlagslektorin und ist
seit 1966 freischaffend; P.-Huckel-Preis für Lyrik 1988 und H.-Mann-Preis der
Akademie der Künste der DDR 1990.
Wenden wir uns einem früher angeführten Text zu — der Miniatur
von P. Bichsei „Die Beamten“ (siehe S. 276) und versuchen seine tem-
porale Struktur näher zu bestimmen.
Das Temporalnetz besteht aus 34 Verben im Präsens (kommen... wün-
schen sich... grüßen sich... tragen... gehen... scheint... usw.). Die temporale
Charakteristik des Textes beschränkt sich nicht nur auf die verbalen For-
men, die keine konkreten Zeitangaben enthalten und die Gegenwart als
eine unbegrenzte Zeitstrecke verzeichnen. Für einen genaueren zeitlichen
Hinweis sorgen die lexikalischen Mittel: das Substantiv mit dem Zahlwort
(um) zwölf Uhr, das dreimal im Text wiederholt wird und dabei einmal mit
dem Temporaladverb „immer“, die Substantive (an den) Zahltag und
291
(beim) Mittagessen, das Adjektiv „nächst“ (an den nächsten Zahltag), das
Adverb Jetzt“ und der Infinitiv II (nicht) geschlossen (zu) haben. Sie re-
geln den Wechsel der Zeitperspektive und kennzeichnen den Übergang
von einer zeitlichen Schicht zur anderen (von der Gegenwart zur Vergan-
genheit oder zur Zukunft). Obwohl der Text grammatisch gesehen mono-
temporal ist (alle Verben stehen im Präsens), ist die Struktur seiner dich-
terischen Zeit bei weitem nicht so einfach. Sie widerspiegelt den Gedan-
kenlauf einer kleinen sozialen Gruppe — der Beamten — und damit auch
eine gewisse Beschränktheit ihrer Lebensinteressen — sie laufen im Krei-
se, sie leben nach einer ein für allemal eingeführten Ordnung. Das drei-
mal wiederholte um zwölf Uhr bildet eine zeitliche Achse, um die sich ihr
Leben dreht. Aber obwohl ihr Weg keine besondere Abwechslung zulässt
(aus dem Portal — heimwärts — der Rückweg ins Büro), wandern ihre Ge-
danken in die Vergangenheit (sie fürchten, das Pult nicht geschlossen zu ha-
ben), in die Zukunft (...Sie denken an den nächsten Zahltag...), und keh-
ren in die Gegenwart zurück, mit ihrem Alltag, mit den Leuten am Schal-
ter, mit den Kindern und dem Rettichsalat. Diese Veränderungen, Rück-
und Vorblenden werden in der Sprache des Textes fixiert und kommen
durch das Temporalnetz zum Ausdruck.
Die temporale Struktur des Textes spielt eine bedeutende Rolle bei
der Veränderung einer anderen Charakteristik des Textes: sie kann das
Tempo der Handlung beschleunigen oder verlangsamen.
Der Autor kann die Zeit raffen oder ausdehnen. Die Geschichte, die
vom Autor erzählt wird, „kann dahinbrüten oder raffen, zum Ausgangs-
punkt zurückkreisen oder mit Siebenmeilenstiefeln ausholen. Dabei
wird stets ein Weg zurückgelegt, eine Erzählstrecke und eine Zeitspan-
ne“ [Rohner, 1976, 186].
Wenn in einer Zeitperiode viele Ereignisse vorfallen, so entsteht beim
Leser der Eindruck, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Wenige Ereignisse
hingegen verlangsamen das Tempo. Schriftsteller, die nach Verlangsa-
mung der Zeit streben, führen Beschreibungen verschiedener Art
in den Text ein (z. B. die Beschreibung der Natur). Die Autoren, die ei-
nen schnellen Zeitlauf darstellen, vermeiden statische Beschreibungen
[s. JlnxaqeB, 1979, 217].
Literaturnachweis
1. Buscha J., Freudenberg-Findeisen R. u.a. Grammatik in Feldern. — Mün-
chen, 2001.
2. Hamburger K. Die Logik der Dichtung. — 2. AufL — Stuttgart, 1968.
3. Moskalskaja O.I. Textgrammatik. — Leipzig, 1984.
4. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. — M., 1975.
5. Rohner L. Theorie der Kurzgeschichte. — Wiesbaden, 1976.
6. Schendels E.I. Deutsche Grammatik: Morphologie. Syntax. Text. — M.,
1988.
7. Sommerfeldt K. E., Starke G. Grammatisch-semantische Felder der deut-
schen Sprache der Gegenwart. — Leipzig, 1984.
292
8. Trier J. Unsicherheiten im heutigen Deutsch // Jahrbuch des Instituts für
deutsche Sprache. 1966/67. Sprache der Gegenwart. 2. Sprachnorm, Sprach-
pflege, Sprachkritik. — Düsseldorf.
9. Weinrich H, Tempus. Besprochene und erzählte Welt. — Stuttgart, 1975.
10. Wolf Chr. Fortgesetzter Versuch. Aufsätze, Gespräche, Essays. — Leip-
zig, 1985.
11. EaxmuH M.M. OopMbi BpcMeHM h xpOHOTona b poMane. OqepKH no hcto-
pwqecKow hosthkc // Bonpocbi jiHTepaTypbi h sctctmkh / M.EaxTHH. — M.,
1975.
12. TcuibnepuH H.P. TpaMMaTHHecKnc KaTeropnn TCKcra (onbiT o6o6iuchm») /
/ K3BecTn» AH CCCP. Cepua Jinrepaiypbi n »3biKa. — 1977. — T. 36. — Ne 6. —
C. 522-532.
13. Ty/ibiea E.B., Ulendejibc E.H. FpaMMaTHKO-JiCKcnLiecKne nojia b coßpe-
MCHHOM HeMCIJKOM H3bIKC. — M., 1975.
14. XupMyHCKuü B. M. O pHTMnqecKow npo3e // Pyccxa» jmTepaTypa. —
1966. - Ne 4.
15. JleeneHKO M.H. TeMnopajibHO-JiOKajibHas apxHTCKTOHMKa xyuoxecTBeH-
HHX TCKCTOB pa3JIHHHbIX XaHpOB. — M., 2003.
16. Jluxanee ff.C. flosTHKa apeBHepyccKOw JiHTepaTypbi. — M., 1979.
17. Mombuieea T.JI. O bpcmchm h npocTpaHCTBe b cobpcmchhom 3apyÖex-
hom poMane // Phtm, npocrpancTBo n BpeM» b JinTepaiype n ucKyccTBe. — M.,
1974.
18. Ho3dpuna JLA. rioaTHKa rpaMMaTHHecKux KaTeropnw: Kypc jickuhw
no MHTepnpeTaunn xy/xoxecTBeHHoro tckctb. — M., 2004.
19. IIomaeHKo H.A. K BpeMeHHOMy ocbochkk) bpcmchhow crpyKTypbi flencr-
BUTejibHocTn // Bonpocbi »3biKO3HaHn». — 1985. — Ne 6. — C. 43 — 52.
20. CuAbMüH T.H. 3aMeTKH o jinpHKe. — JI., 1977.
21. ToMaiueecKuü E.B. Phtm npo3bi // O crnxe. — M.; JI., 1929.
22. Typaeea 3.B. KaTeropn» BpeMenn. BpeM» rpaMMaTnqecKoe n BpeMH xy-
ZioxccTBeHHoe. — M., 1979.
23. Typaeea 3,B. TeMnopajibna» crpyicrypa HayqHbix n xyfloxecTBeHHbix
TexcTOB // OyHKunonajibHbie cthjih. JInHrBOMeTOflnHecKne acneKTbi. — M.,
1985. - C. 26-38.
24. IIInemHbiü K. M. JlnnrBocTnjincTnqecKne w CTpyKTypHO-KOMno3nuwoH-
Hbie ocoöchhocth TeKCTa KopoTKoro paccKaaa: (na MaTepnane aMepnKaHCKOü
jmTepaTypbi): AßTopecJ). anc.... Kami. (Jhjioji. HayK. — M., 1980.
Kapitel 14
DIE LOKALE STRUKTUR DES TEXTES
§ 66. Der Raum als eine Kategorie der Poetik
Der Raum ist genauso wie die Zeit eine der fundamentalen Kategori-
en der Weltauffassung eines Menschen, eine der bedeutendsten Katego-
rien des menschlichen Bewusstseins.
293
Wie die Zeit, ist auch der Raum durch einige Arten vertreten:
1. Der physikalisch-geometrische Raum existiert als objektive Realität
unabhängig vom Bewusstsein eines Menschen. Das ist die objektiv-reale
Existenzform der Materie. Die Bewegung der Materie geht im Raum vor
sich und ist mit einer Ortsveränderung verbunden. Der reale Raum ist
dreidimensional.
2. Der Mensch nimmt den Raum subjektiv auf. Die menschliche
Sprache beschreibt eben diesen subjektiv aufgenommenen Raum und
spiegelt sowohl universelle Züge der Aufnahme als auch Unterschiede
wider, die mit der Lebensweise der Menschen verbunden sind, also die
nationale Spezifik dieser Aufnahme.
Wie bekannt, ist für die russische Landschaft hauptsächlich die
waagerechte Orientierung im Raum typisch. Das findet seine Wi-
derspiegelung in der russischen Sprache. Für Völker, die in den Bergen
leben, ist die senkrechte Orientierung im Raum charakteristisch,
was auch in ihrer Sprache fixiert wird [s. RKOBJieBa, 1994, 20],
3. Bei der Analyse eines belletristischen Textes spricht man vom
künstlerischen Raum. Darunter versteht man das Weltmodell ei-
nes Autors, das in der Sprache seiner räumlichen \brstellungen aus-
gedrückt wird. Der künstlerische Raum ist ein Kontinuum, in dem die
handelnden Personen leben und wirken und die Handlung sich entwi-
ckelt [vgl. JIoTMaH, 1968, 6], Man zählt ihn zu den Kategorien der Poe-
tik, d. h. der inneren Struktur der Beziehungen, die unter den Elemen-
ten des Textes existieren.
Mit Hilfe des künstlerischen Raums kann der Autor verschiedene Auf-
gaben lösen: temporale Kategorien gestalten, den Helden in eine Kon-
fliktsituation einführen, die dem dargestellten Ort eigen ist, der Person
eine modale Charakteristik geben, komische Effekte bei der Deformie-
rung des Raumes schaffen. Dabei kann sich der Autor neben der handeln-
den Person befinden, er kann dieser Person folgen und alle Ereignisse ein-
schätzen. Er kann sich auch von einer Person zu einer anderen bewegen
oder das Geschehene „von oben“ beschreiben. Das macht die Darstel-
lung umfangreich und objektiv [s. VcneHCKHö, 1995, 80—81],
In der Literaturwissenschaft unterscheidet man verschiedene Typen
des künstlerischen Raums:
1) den Punktraum, den linearen Raum, den Flächenraum, den Volu-
menraum;
2) den begrenzten/nicht begrenzten Raum;
3) den Alltagsraum/den Zauberraum;
4) den Außenraum/den Innenraum;
5) den Raum/das Chaos;
6) den gerichteten/den nicht gerichteten Raum u. a. [s. JIoTMaH,
1968].
Die Charakteristiken des Raums hängen vom Genre, von der Zeit, in
der das Werk geschaffen wurde, sowie auch von der literarischen Richtung
und von den individuellen schöpferischen Vorlieben des Schriftstellers ab.
294
So finden wirim mittelalterlichen Abenteuerroman einen
abstrakten Raum. Im Ritterroman beginnt ein subjektives Spiel
mit dem Raum: der Raum kann verletzt und verzerrt werden
[vgl. BaxiuH, 1975, 2?5]. Im 7?o/mfl« des 19. Jahrhunderts, wo
Fragen über die individuelle Verantwortung und Aktivität des Menschen
gestellt und gelöst wurden, ist der Raum in den Werken der großen Meis-
ter verschieden: bei I. Turgenjew ist er fixiert, bei L.Tolstoi und
F.Dostojewski nicht fixiert [s. JIoTMan, 1968, 48 — 50].
In anderen Genres ist der Raum auch anders. So ist der Raum im
Märchen weit, unbegrenzt, unendlich und irreal. Inder
Chronik ist der Raum auch groß, aber real. Das entspricht voll-
kommen der Weltanschauung der Menschen im Mittelalter. Im 16. und
17. Jahrhundert verändert sich die Aufnahme des geografischen Raums
und damit auch ihre Schilderung im belletristischen Werk. Es erscheinen
Details, Eindrücke des Autors, Beschreibungen der Ereignisse
[s. JluxaqeB, 1979, 351], Es lässt sich schlussfolgern, dass die Schilde-
rung des Raums in einem Text mit den Ansichten der Menschen über
den geografischen Raum aufs engste verbunden ist.
In den Werken der modernen Literatur finden wir auch einige Cha-
rakteristiken des Raums, die „genregebunden“ sind.
So ist zum Beispiel die amerikanische „short story“ durch das
räumliche Kontinuum gekennzeichnet [vgl. IIIneTHbiit, 1980].
Im deutschen Hörspiel werden die Szenen schnell gewechselt.
Der rasche Szenenwechsel fordert auch einen konsequenten Ausdruck
des räumlichen Kontinuums, das viel deutlicher vertreten ist
als das zeitliche Kontinuum [s. III,ep6a, 1981, 22],
Im deutschen Arbeiterlied werden vier Arten des Raumes aus-
gesondert: 1) der dokumentarische Raum, der mit geografischen
und historischen Realien versehen ist; 2) der soziale Raum, der eine
bestimmte Information über die Personen und ihre sozialen Koordina-
ten enthält; 3) der religiös-ästhetische Raum, der die Verstel-
lungen des Autors wiedergibt; 4)der Bühnenraum, der das Wesen
des Volksliedes als Spiel zum Ausdruck bringt [vgl. MapueHKo, 1983,
16—18\.
Es muss betont werden, dass die temporalen und lokalen Textstruk-
turen so eng miteinander verbunden sind, dass sie manchmal in der
Textlinguistik als eine einheitliche Textcharakteristik behandelt werden.
So spricht O. I. M o s k a 1 s k a j a über die so genannte „lokal-temporale
Achse“, die aus Substantiven und Pro-Adverben besteht, die gemeinsa-
me Funktionen erfüllen: sie aktualisieren den belletristischen Text, d. h.
machen ihn realitätsbezogen, entwickeln das Erzählen in Zeit und
Raum und schaffen seine Kohärenz [s. Moskalskaja, 1984, 112, 115].
Wir werden aber diese zwei Aspekte eines Textes getrennt vonei-
nander analysieren, um sie eingehender untersuchen zu können. Da-
bei werden aber die Zusammenhänge betont, die zwischen ihnen
existieren.
295
§ 67. Der linguistische Aspekt der lokalen Textstruktur
Der linguistische Aspekt der lokalen Textstruktur ist weniger erforscht
als der der temporalen. Das lässt sich dadurch erklären, dass weder die
deutsche noch die russische Sprache über eine morphologische Katego-
rie verfügen, die den Raumbegriff zum Ausdruck bringen könnte (im
Unterschied zur Zeit, die ihre morphologische Kategorie hat — die Ka-
tegorie der grammatischen Zeit). Außerdem erscheinen die lokalen An-
weisungen im Satz und im Text nicht so regulär wie die temporalen, die
schon in jeder verbalen Zeitform vorhanden sind.
Das Hauptmittel, das zum Benennen des Handlungsortes dient, sind
lokale Adverbialbestimmungen im Satz, die besonders oft
durch die Adverbien „hier“, „da“, „dort“ u.a. und durch die S ufa-
st ant ive mit oder ohne Präposition ausgedrückt werden: auf der
Straße, zu Hause, im Gebäude, im Land usw.
Die lokalen Angaben sind auch genregebunden. Wenn Zeitungstexte,
Reportagen, Chroniken und Biografien immer explizite Ausdrucksmit-
tel der Zeit und des Handlungsortes enthalten, so fehlen diese Mittel
sehr oft in belletristischen Texten. In Folkloretexten, z. B. in Märchen
und Fabeln mit ihrer völligen Loslösung von der Wirklichkeit, sowie in
Sprichwörtern, Sprüchen, Sentenzen haben wir es in der Regel mit
Nullindizien zu tun [vgl. MocKajibCKa», 1981, 777]:
Übung macht den Meister. (Sprichwort)
oder:
Das Roß und der Stier
(eine Fabel von G. E. Lessing)
Auf einem feurigen Rosse floh stolz ein dreister Knabe daher.
Da rief ein wilder Stier dem Rosse zu: „Schande! Von einem Knaben ließ’
ich mich nicht regieren!“ „Aber ich“, versetzte das Roß. „Denn was für Ehre
könnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen?“
In der Erzählung trifft man oft genaue Ortsangaben. Es werden
die Stadt, die Bewegungsrichtung oder der Handlungsort genannt, die
dem realen Raum oder einem erfundenen Ort entsprechen. Öfter ist der
Text p o 1 y 1 o k a 1: er ist in der Regel umfangreich und die handelnden
Personen bewegen sich im Rahmen des genannten Ortes. Der Leser
wird schon am Anfang des Textes über den Ort der Handlung unter-
richtet.
Die Kriminalgeschichte und der Kriminalroman unter-
scheiden sich von den anderen Genres in lokaler Hinsicht dadurch, dass
sie einen festgelegten Handlungsort haben, der auf einen realen
geografischen Ort bezogen ist. Das erklärt sich durch das Streben der
Kriminalliteratur „wahrheitsgetreu“ zu wirken. Die handelnden
Personen sind keine statischen Figuren, sie sind lebendig und bewegen
sich im angegebenen Raum. Im Text wird ihr Stellenwechsel fixiert. So
entsteht ein polylokaler Text.
296
§ 68. Das Lokalnetz. Monolokale und polylokale Texte
Um die lokale Charakteristik eines Textes zu bestimmen, greifen wir
wieder zum Begriff „Netz“ und verstehen darunter alle sprachlichen Mit-
tel, die dem Leser die Orientierung im fiktionalen, künstlerischen Raum si-
chern.
Dazu gehören Substantive mit lokaler Bedeutung (die Straße, zu
Hause, im Land usw); Adjektive mit lokaler Bedeutung (städtisch, dörf-
lich usw); Adverbien (draußen)', Präpositionen, die auf die Bewegungs-
richtung oder auf die Lage des Menschen oder des Gegenstandes hin-
weisen (auf, in, über, unter, vor, hinter, zwischen usw); die Präfixe (run-
ter-, raus-, herum- usw.); lokale Gliedsätze.
Wie auch bei der Bestimmung der temporalen Struktur, finden wir im
Bestand des Lokalnetzes bedeutende Unterschiede je nach Genre und
Textsorte. Wenden wir uns einem Text zu, der zum so genannten „klei-
nen Genre“ gehört, — E.Erbs lyrischer Miniatur „Ein Wanderer“. Sie
beginnt mit dem Satz:
Ein Vierjähriger geht durch das wieder frische, nachgewachsene Gras des
Obstgartens hin zu allen Bäumen, von einem zum anderen im Zickzack, und
nimmt sich von den Früchten, unreif und reif, die das Geäst zu ihm hinunter-
reicht, er ißt, es fliegen Teile.
Das Lokalnetz dieses Textes besteht aus verschiedenen Gliedern: das
sind das Substantiv „Obstgarten“, die Präpositionen „durch“, „von“,
„zu“; das Adverb „hin“, die zusammen den künstlerischen Raum be-
stimmen. Das Kind bewegt sich zwischen den Bäumen. Der Raum ist
also begrenzt und schon am Anfang des Textes verzeichnet. Weiter wird
der Raum nicht mehr erwähnt. Alle Glieder des Lokalnetzes sind also
im ersten Satz konzentriert und bilden einen lokalen Komplex.
Da die Handlung sich an einem und demselben Ort entwickelt, spre-
chen wir in diesem Fall über das monolokale Netz.
Ein polylokales Netz finden wir in der folgenden Miniatur von E. Erb:
Die Küche
Der erste Satz ist: die Ente schwimmt auf dem Teich.
Der zweite Satz ist: die Ente brät in der Pfanne.
Der dritte Satz ist: die Schafgarbe wächst die Wege
entlang.
Der vierte Satz ist: mein zweijähriger Sohn trinkt
am Küchenschrank Schafgarbentee.
Den Zusammenhang des ersten und dritten Satzes
nenne ich: draußen.
Den Zusammenhang des zweiten und vierten: die Küche.
Gasflamme, Ente und Bratfett hängen Gerüche
in die vom Architekten der Ausbeuter eng gestaltete Küche.
Den gedachten Dingen wohnt inne ein Streben,
als wollten sie miteinander leben.
297
Diese gereimten Zeilen enthalten einige Ortsangaben, die die lo-
kale Textstruktur bilden. Wir verzichten darauf, den tieferen Sinn
dieser Miniatur zu ergründen, und nennen nur die Glieder des Lo-
kalnetzes: die Küche,., auf dem Teich... in der Pfanne... die Wege ent-
lang... am Küchenschrank... draußen... die Küche... in die Küche. Der
Text ist also auf der Gegenüberstellung „innen — draußen“ aufge-
baut, die Beschreibung bewegt sich von einem Ort zu einem anderen.
Der Ortswechsel bedingt also den polylokalen Charakter der
Textstruktur.
Ein polylokales Netz hat der Text einer Chronik’.
Erste Tour de France
1. Juli (1903). Als sich in den früheren Morgenstunden um 3.16 Uhr in Pa-
ris 60 Radprofis zu einer Rundfahrt durch Frankreich in Bewegung setzen, ist
das später populärste Straßenrennen der Welt, die Tour de France, geboren.
Henry Desgrange, einer der ersten Radsportler Frankreichs, hat ein Jahr
an der Idee dieser Rundfahrt gearbeitet, die seiner Zeitung ,,L’ Auto“ zu
mehr Popularität verhelfen soll. Gegenüber der täglich erscheinenden Sport-
zeitung „Le Velo“ mit 100000 Auflage fristet Desgranges Blatt ein Schatten-
dasein, das durch die Berichterstattung über die Rundfahrt aufgebessert wer-
den soll. Nachdem Victor Goddet, der Schatzmeister des kleinen Blattes, die
Kasse zur Verfügung stellt, schreibt Desgrange im Mai die Tour de France in
,,L’ Auto“ aus. Er lockt die Radprofis mit Preisgeldern von 20000 Franc, da-
von 3000 für den Sieger. Für die ersten 50 der Gesamtwertung gibt es jeden
Tag fünf Franc.
Das ausgeklügelte Budget des Veranstalters läßt 60 Fahrer für diese erste
Rundfahrt zu, die sich vom 1. bis 19. Juli auf sechs lange Etappen durch Frank-
reich machen: Paris — Lyon: 467 Kilometer, Lyon — Marseille: 374 Kilometer,
Marseille — Toulouse: 434 Kilometer, Toulouse — Bordeaux: 268 Kilometer,
Bordeaux — Mantes: 425 Kilometer und Mantes — Paris: 460 Kilometer.
21 Teilnehmer, darunter der Deutsche Josef Fischer (München), erreichen
nach 2428 Kilometern das Ziel und kommen auf ein Stundenmittel von
25,288 Kilometern. Sieger wird der Franzose Maurice Garin nach 93:29:00
Stunden reiner Fahrt. Er gewann 1897 und 1898 das Rennen Paris—Roubaix
und wurde bei dieser Fernfahrt 1896, 1899 und 1900 jeweils dritter. 1902 siegte
er bei Bordeaux—Paris. Die Tour wird für den Veranstalter Desgrange noch
nicht der erhoffte Erfolg, er will aber im nächsten Jahr einen zweiten Versuch
starten.
In diesem Text werden einige Etappen des Straßenrennens ge-
nannt, die mit einigen geografischen Namen verbunden sind: sie zei-
gen die Richtung, in der sich die Radfahrer bewegen. Ihr rascher
Wechsel spiegelt das hohe Tempo der Bewegung wider. Das polylokale
Netz, das den Ortswechsel wiedergibt, besteht hauptsächlich aus Sub-
stantiven (Paris, Frankreich, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux,
Mantes, Roubaix). Dazu gehören auch einige Substantive, die thema-
tisch mit dem Raumbegriff verbunden sind (Rundfahrt, Straßen, Ziel,
Rennen, Tour).
298
Außerdem besteht die Aufgabe der lokalen Anweisungen darin, dem
Text einen dokumentarischen Charakter beizumessen, was den
Anforderungen entspricht, die an publizistische Texte gestellt werden.
Dieser Text veranschaulicht auch ein enges Zusammenwirken von
zwei Kategorien: Zeit und Raum in einigen Textsorten. Er enthält
viele Zeitanweisungen (7. Juli, 3.16 Uhr, 93 Stunden, 1897usw.), die so
zahlreich sind und so schnell wechseln wie die Ortsangaben. Diesen Zu-
sammenhang nennen wir nach M. M. B a c h t i n den Chronotopos. Er
erfüllt im analysierten Text einige Aufgaben: er gewährt dem Leser einen
Überblick über Orte und Zeiten und schafft eine Bewegung, ein schnel-
les Tempo des Erzählens sowie gleichzeitig eine Distanz zwischen der
Welt des Lesers und der Welt der daigestellten Ereignisse.
Selbstverständlich gibt es Texte, in denen lokale Angaben einen be-
sonderen Platz in der Inhaltsstruktur einnehmen und sogar unentbehr-
lich sind. Soz.B. im Lebenslauf'.
Ich heiße Helmut Dunkelacker und bin 1937 in Frankfurt geboren. Ich bin
also jetzt 52 Jahre alt. Ich bin das einzige Kind von Hermann und Ursula Dun-
kelacker. Mein Vater war Maurer. Er ist 1944 an der Ostfront gefallen. Während
des Krieges wohnte ich bei meiner Tante Renate auf der Schwäbischen Alb.
Danach habe ich weiter in Frankfurt gelebt...
Ich ging in eine Berufsschule und machte eine Ausbildung als Maschinen-
arbeiter. Ich arbeitete dann zwanzig Jahre bei einer Firma in Frankfurt...
Im Text der Biografie darf also keine Ortsangabe weggelassen wer-
den, denn eben die Information, die in diesen Einheiten enthalten ist,
wird erfragt. Das polylokale Netz verzeichnet den Lebensweg des Men-
schen mit seinen „Zwischenstationen“.
Hat der Text den Charakter einer Verallgemeinerung, einer Feststel-
lung, so ist er durch Nullindizien gekennzeichnet oder durch ein karges
Lokalnetz:
In der Berufswelt hat der Computer einen festen Platz erobert. Gleich, ob
man als Werkzeugmacher, Sekretärin oder als Lehrer sein Geld verdient.
Grundkenntnisse in der Anwendung der neuen Technik sind unerläßlich ge-
worden. Daneben haben sich Berufsfelder etabliert, die sich ausschließlich mit
dem ökonomischen und technisch effizienten Einsatz der Rechner beschäfti-
gen. Für beide gilt aber die Tatsache, dass jede Computer-Ausbildung nur dann
zukunftssicher ist, wenn sie mit der technischen Entwicklung Schritt hält: Der
Wille zur Weiterbildung ist unerläßlich...
Der Text enthält nur eine einzige lokale Angabe: „in der Berufswelt“.
Der Inhalt des Textes erfordert keine weitere Präzisierung.
Der folgende Text hingegen hat ein verzweigtes Lokalnetz, was auch
seiner Inhaltsstruktur entspricht:
Rund 70 Prozent der nachgewiesenen Erdölreserven befinden sich in den
OPEC-Ländern. Die OPEC wurde 1960 zum Zweck einer koordinierten Erdöl-
politik gegründet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Fördermengen und
Preise für Rohöl festzusetzen.
299
Die mit Abstand größten Vorräte entfallen auf die Länder des Nahen
Ostens (66,3 Prozent). Führend sind Saudi-Arabien (35,5 Mrd.t), Kuwait
(13,5 Mrd. t) und Irak (13,2 Mrd. t). Die Bundesrepublik hat aus Gründen der
Risikostreuung über 20 Lieferländer, wobei die Länder des häufig von politi-
schen Krisen geschüttelten Nahen Ostens nicht an der Spitze stehen. Die
größten Rohöllieferanten sind Großbritannien, Libyen und Norwegen. Z.B.
betrug der Anteil der Öllieferungen im Jahre 1990 aus Kuwait und Irak
zusammen lediglich 0,6 Prozent, so dass der Golfkrieg im folgenden Jahr zu
keiner Zeit die Ölversorgung gefährdete. Dennoch ist bei weltweit zurückge-
henden Beständen mit einer zunehmenden Abhängigkeit von den Ländern des
Nahen Ostens zu rechnen...
Das Lokalnetz dieses Textes besteht aus folgenden Gliedern: ...in den
OPEC-Ländern... auf die Länder des Nahen Ostens... Saudi-Arabien...
Kuwait... Irak... die Bundesrepublik... die Länder des Nahen Ostens...
Großbritannien... Libyen... Norwegen... Kuwait... Irak... von den Län-
dern des Nahen Ostens. Es sind also hauptsächlich Substantive, die im
Text wiederholt werden. Wie bekannt, erfüllen wiederholte Elemente
eine anaphorische Funktion (Anapher = Rückverweis) und schaf-
fen eine enge Verknüpfung der Sätze, die sich in verschiedenen Positio-
nen im Text befinden.
Genaue Lokalangaben sind in diesem Text unentbehrlich. Der Autor
ist danach bestrebt, ein volles Bild vor den Augen des Lesers entstehen
zu lassen, damit er eine Vorstellung über die weltweiten Perspektiven der
Erdölförderung bekommen kann.
§ 69. Die Aufgaben des Lokalnetzes
Das Lokalnetz kann im Text verschiedene Aufgaben erfüllen, die äs-
thetische, pragmatische, kommunikative und andere Absichten des Au-
tors realisieren.
Wenden wir uns E. Strittmatters lyrischer Miniatur „Wasser im Spät-
herbst“ zu:
Wasser im Spätherbst
Der Nebel fällt, und die Gräser glänzen. Die Sonne steht schräg, und die
Krähen schwärmen. Klar ist das Wasser in Tümpeln und Teichen, rein und
durchschaubar, bis auf den Grund. Alles, was sommers im Wasser schwebte,
sank in die Tiefe, lebt dort im Sumpf. Sommer und Winter — Steigen und
Sinken. Aber im Frühling entfliegen dem Moder blaue Libellen und schwe-
ben im Grün.
Diese Miniatur ist eigentlich ein Gedicht in Prosa: Sie ist rhythmisch
aufgebaut und nähert sich einem gereimten Text (Grund— Sumpf—
Grün). Dazu trägt auch der syntaktische Parallelismus der ersten zwei
Sätze bei: die Teilsätze der beiden Satzreihen sind nach dem Modell
Substantiv + Verbum finitum aufgebaut.
300
Das Lokalnetz des Textes besteht aus mehreren Gliedern und stellt
den Raum detailliert dar: ...in Tümpeln und Teichen ...im Wasser...
in die Tiefe... im Sumpf... dem Moder... im Grün.
Diese Substantive, die thematisch zu einer Gruppe gehören, bilden
eine Topikkette und dienen der Textkohärenz. Dank den zahlreichen lo-
kalen Indikatoren wird der künstlerische Raum in einzelne Teile geglie-
dert. Jeder Teil wird logisch betont und hervorgehoben, was der darge-
stellten Welt eine Vielseitigkeit beimisst. Außerdem schaffen die Sub-
stantive mit lokaler Bedeutung den Rhythmus.
Eine andere Aufgabe erfüllt das Lokalnetz in der Miniatur von S.
Pitschmann „In Theresienstadt“.
In Theresienstadt
Alle redeten laut von den Türmen der Goldenen Stadt, die irgendwann hin-
ter dem Hügelgelände erscheinen sollten, nachdem sie auf einem Marktplatz
gehalten hatten, wo es unter den Arkaden Pfirsiche und dicke Trauben gab,
die an den Hängen über dem Fluß wuchsen, und wo in der Kirche das alte Ge-
wölbe zu sehen war, das die böhmischen Mönche aus Knochen und Schädeln
errichtet hatten, falls man sich nicht fürchtete vor den Gebeinen des Mittel-
alters. Der Bus hielt später noch einmal, und jetzt merkten alle, wie heiß es
geworden war, als sie ausstiegen, als es plötzlich auf einen massigen Eingang
mit Wachstuben zuging, geradeaus unter Ahorn und Kastanien und der blutro-
ten Sonne. Es war nur das Geräusch der Füße zu hören, während sie sich
langsam durch das Tor schoben. Keine Kommandos, kein Hundegekläff, kei-
ne Schreie, auch keine Musik. Die Schuhe scharrten über die Steine, mit de-
nen die Höfe gepflastert waren, vorbei an Dahlienrabatten und Rasenstücken,
symmetrisch geordnet, der Kleiderkammer, dem Bunker, den geteerten
Blocks, in denen man dunkel die Stockwerkpritschen erkennen konnte, und
im letzten Hof mit der Mauer mit dem durchlöcherten Putz, wo nichts mehr
wuchs, zog der Dolmetscher seine Mütze ab. Wär an der Grenze zugestiegen,
ein ruhiger, höflicher Mann, der bloß dastand, der stumm auf die Mauer
blickte, dann auf die Leute, deren Sprache er schon zu lieben geglaubt hatte,
der keine Braue bewegte, dessen Gedächtnis jedoch ungeheure Zahlen wälz-
te, als der Verschluß einer Kodak schnarrte, als eine Stimme sagte: Bißchen
weiter rechts, Liebling.
In diesem Text werden eine Touristengruppe und ihre Stadtrundfahrt
beschrieben. Die Bewegung wird im bedeutenden Maße dank einem
häufigen Wechsel der Präpositionen in den präpositionalen Gruppen
wiedergegeben, die auf die Richtung hinweisen: ...hinter dem Hügelge-
bäude... auf dem Marktplatz... unter den Arkaden... an den Hängen...
über dem Fluß... in der Kirche... auf einen Eingang... unter Ahorn... durch
das Tor... über die Steine... vorbei an Dahlienrabatten... im letzten Hof...
an der Grenze.
Das Lokalnetz des Textes besteht also aus präpositionalen Substanti-
ven, aus Adverbien {vorbei, weiter rechts) und Lokalsätzen {...wo es unter
den Arkaden...', ...und wo in der Kirche...). Die Rolle der Präposi-
tionen ist dabei kaum zu überschätzen.
301
Das Hin und Her der Touristengruppe empfindet der Leser dadurch,
dass die Präpositionen die Bewegung nicht in eine, sondern in ver-
schiedene Richtungen lenken (hinter.,, auf... unter... über). Das er-
laubt dem Autor, das zerstreute Hinschauen der Touristen spüren zu las-
sen, die alles Gesehene nur als Sehenswürdigkeiten empfangen.
Das Lokalnetz der folgenden Miniatur von H. Czechowski besteht
auch aus präpositionalen Substantiven, erfüllt aber eine andere Aufgabe:
Zwei Frauen
Von meinem Fenster aus sehe ich: Zwei Frauen sitzen unter dem Apfelbaum
auf einer Obstkiste.
Im Hintergrund wehende Wäsche. Das Gesicht der einen, die mit einem
meiner besten Freunde verheiratet ist, kann ich nicht sehen. Aber ich weiß: Sie
ist schön.
Es ist Herbst. Die Schöne hat Äpfel gepflückt. Jetzt reden die beiden Frau-
en wahrscheinlich über Äpfel. Aber sie können natürlich auch über etwas ganz
anderes reden.
Ich finde, es ist gut, wenn man an einem Tisch sitzt, um zu arbeiten, zwei
Frauen zu sehen, gleichgültig, worüber sie reden.
Die lokalen Substantive bestimmen die Position des Autors und set-
zen die Grenzen des künstlerischen Raums fest. Der Raum dieser Mi-
niatur gleicht dem Raum eines Gemäldes, das der Autor von seinem
Schreibtisch aus gesehen hat. Diese Ähnlichkeit mit einem Gemälde
verstärkt nicht nur der Rahmen (das Fenster), sondern auch die Unbe-
weglichkeit des Gesehenen: von meinem Fenster aus, im Hintergrund. Die
Handlung fehlt, das Bild ist statisch. Die Stützpunkte des Rahmens bil-
den die unterstrichenen Substantive. Sie verleihen den einzelnen Text-
teilen eine Angemessenheit und dem ganzen Text einen rhyth-
mischen Klang.
Im Lokalnetz eines belletristischen Textes erscheinen sel-
ten genaue Angaben über den Handlungsort. Der künstlerische Raum
wird nach den Gesetzmäßigkeiten der fiktionalen Welt aufgebaut, und
die Besonderheiten dieses Baus spiegeln sich in seiner sprachlichen Ge-
staltung wieder. Deshalb sehen wir in belletristischen Texten neben dem
substantivischen und adjektivischen Lokalnetz auch ein präpositio-
nales („In Theresienstadt“), ein präfixales Lokalnetz oder ein
Lokalnetz, das aus Komposita besteht (weiterfahren, weitergehen,
Waldwege, landwärts, Gassenfenster, Galeriebesucher). Diese Netzglieder
sind hinreichend für die Ortsbestimmung in einem belletristischen Text.
In einem Pressebericht ist solch ein Lokalnetz ungenügend. Laut der
Pragmatik des Zeitungsstils sind in seinen Texten genaue Ortsan-
gaben obligatorisch. Wir konnten uns dessen vergewissern, als wir
die Chronik der „Ersten Tour de France“ analysierten (S. 298 — 299).
Ein belletristischer Text unterscheidet sich von einem Zeitungstext
auch dadurch, dass das Lokalnetz einer Kurzgeschichte, einer Miniatur
oder einer Erzählung aus Einheiten (Wörtern, Wortgruppen) besteht,
302
die zum Bereich Hintergrundwissen gehören. So wird z.B. der
künstlerische Raum des Textes gleich identifiziert, sobald wir darin ei-
nen Hinweis auf die FDJ treffen: die Freie Deutsche Jugend war eine
Organisation der Jugendlichen in der DDR.
Wenn wir in einem belletristischen Text mit einem künstlerischen
Raum zu tun haben, so ist der Raum in Texten, die zu anderen Funktio-
nalstilen gehören, durch andere Charakteristiken gekennzeichnet.
Im Programm eines österreichischen Verlags finden wir kurze Infor-
mationen über die Schriftsteller und ihre Werke. Da die Information do-
kumentarischen Charakter und knappen Raum auf dem Blatt hat, ist der
Text kurz und enthält nur das Notwendige (beim Zitieren behalten wir
die Schreibweise des Originals bei):
Marie-Therese Kerschbaumer, geb. 1936 nahe Paris. Mutter Österreiche-
rin, Vater Kubaner. 1939 Rückkehr nach Tirol. Haupt- und Berufsschule;
Fremdarbeiten. Abendmatura. Studium der Romanistik und Germanistik, Stu-
dienaufenthalte in Italien und Rumänien. Lebt seit 1971 als freie Schriftstellerin
und Übersetzerin in Wien.
Das Lokalnetz dieses Textes besteht aus Substantiven (geografische
Namen), die dem Leser eine genaue Orientierung sichern (autose-
mantisches Lokalnetz) und einen realen (keinen fiktionalen) Raum
bezeichnen. Seinem Charakter nach gleicht das Lokalnetz dieses Textes
dem eines Zeitungsberichtes oder einer Chronik (siehe den Text „Erste
Tour de France“). Das wird durch die Pragmatik dieser Texte bedingt:
sie haben als Ziel das möglichst genaue Informieren der Leser über be-
stimmte Sachverhalte.
Einen Sonderfall bilden Texte, die fast ausschließlich aus lokalen An-
gaben bestehen. Ein Beispiel dafür ist das folgende Gedicht von
G. Fritsch (1924-1969):
Augustmond
Aus dem Scheunenatem
aus dem Maisfelderdunst
aus den Kastanienkronen
aus den Disteln vergessener Bahndämme
aus den Holunderzäunen
aus den Friedhofsecken
aus dem Staub
aus dem Staub
aus dem Ozean von Staub
rollt lautlos der Mond
der riesige Kürbis
auf die Sternstraßen
der Ebene.
Von Dorf zu Dorf
Bahnen ihm Hunde
den Weg.
303
Die mehrfache Wiederholung einer und derselben Struktur — des prä-
positionalen Substantivs mit lokaler Bedeutung — und die dreifache Wie-
derholung des Substantivs „Staub“ in derselben Form (aus dem Staub, aus
dem Staub, aus dem Ozean von Staub) verwandeln das Gedicht in einen
Zauberspruch. In den literarischen Anmerkungen zu den Gedichten von
G. Fritsch wird betont, dass alles Gegenständliche bei ihm symbo-
lisch wirkt. So ist auch der Mond im Gedicht nicht nur eine poetische
Gestalt, sondern auch etwas Mystisches und Rätselhaftes.
Literaturnachweis
1. Moskalskaja O.I. Textgrammatik. — Leipzig, 1984.
2. EaxmuH M.M. <I>opMbi BpeMenn h xponoTona b poMane. OqepKH no hc-
TopHHecKon nosTMKe // Bonpocbi JiHTepaTypbi h sctcthkh / M. BaxTHH. —
M., 1975.
3. Jluxauee JJ. C. üosTHKa .apeBHepyccKOH JiHTepaTypbi. — M., 1979.
4. JIontMQH IO. M. IIpoßjieMa xyjxoxecTBeHHoro npocrpaHCTBa b npoae To-
rojifl // Yli. 3an. Taprycxoro roc. yHHBepcHTera. — Tapry, 1968. — Bbin. 209. —
C. 5-50.
5. MapueHKo 3. P. Tnn TeKCTa KaK KOMMyHHKaTHBHaa HopMa: ABTopecj).
ähc. ... Kana. 4)hjioji. HayK. — M., 1983.
6. MocKüJibCKax 0.14. TpaMMaTHKa TeKCTa. — M., 1981.
7. Ho3ÖpUHa JI.A. IIosTHKa rpaMMaTHHecKHx KaTeropHH: Kypc jickuhh no
HHTepnperauHH xyaoxecTBeHHoro TeKCTa. — M., 2004.
8. Phtm, npocrpaHCTBo h BpeMH b JiHTeparype h HCKyccTBe. — M., 1974.
9. VcneHCKUü E.A. CeMHOTHKa HCKyccTBa. — M., 1995.
10. IIInemHblÜ K.H. JlHHFBOCTHJIHCTH'ieCKHe H CTpyKTypHO-KOMnO3HUHOH-
Hbie ocoßeHHOCTH TeKCTa KopoTKoro paccKaaa (na MaTepnajie aMepHKancKOÜ
JiHTepaTypbi): ABTopecj). ähc.... Kann. (Jihjioji. HayK. — M., 1980.
11. IIIepGa B.n. JlHHFBOCTHJIHCTHHeCKafl H (JiyHKUHOHajIbHO-KOMMyHHKa-
THBHaa xapaicrepHCTHKa TeKCTa (na MaTepnajie pajinonbec): ABTopecj). ähc. ...
Kana. (jiHJioji. HayK. — M., 1981.
12. EKoeneea E. C. OparMeHTH pyccKOH R3Hkoboh KapTHHbi MHpa:
Mojxejin npocTpaHCTBa, BpeMenn h BocnpnaTHH. — M., 1994.
Kapitel 15
DIE PERSONALE STRUKTUR DES TEXTES
§ 70. Einige Aspekte der Kategorie der Person
Der personalen Struktur des belletristischen Textes liegt die
Kategorie der Person zu Grunde. In der Erforschung dieser Kategorie
kann man einige Aspekte aussondern, darunter den literarischen, den
stilistischen, den grammatischen und den pragmalinguistischen.
304
Der literarische Aspekt zeigt sich in erster Linie im Zusammenhang
mit der Gestalt des Autors und mit der Erzählperspektive. Die Haupt-
frage ist dabei die Bestimmung der Erzählform (Ich-Form
oder Er-Form). Durch diese Formen kommen die zeitlich-räumlichen,
aber auch andere Positionen des Autors zum Ausdruck. Dabei muss be-
tont werden, dass bei der Bestimmung der Erzählform in der Literatur-
wissenschaft nicht so sehr der Gebrauch der Personalpronomen und der
Personalformen des finiten Verbs berücksichtigt wird, sondern vielmehr
andere Parameter.
In der Ich-Form wird der Erzähler immer explizit ausgedrückt. Er ist
die handelnde Person und existiert in derselben zeitlich-räumlichen
Welt wie auch die anderen Gestalten des künstlerischen Textes. Die drei
semantischen Besonderheiten dieser Form sind: Glaubwürdigkeit
(Ich habe das selbst gesehen), Subjektivität (die Welt wird vom
Teilnehmer der Ereignisse dargestellt) und Unvollständigkeit
(die dargestellte Welt ist durch die Erfahrung und den Gesichtskreis des
Erzählers begrenzt).
In der Er-Form ist die Autorengestalt von den anderen getrennt und
ihnen gegenübergestellt. Er ist der Schöpfer der fiktionalen Wfelt, in der
andere Gestalten existieren. Die Hauptsemantik der Er-Form ist E r-
findung, Vollständigkeit der Darstellung, Objekti-
vität [vgl. Arapoßa, JleccKirc, 1976; 1980],
Wenn die Literaturwissenschaftler die Texte in zwei Gruppen eintei-
len (Texte der Ich-Form und Texte der Er-Form), so können die Lin-
guisten auch die Du-Form kaum ignorieren. Die 2. Person gehört in das
Paradigma der Person und ist ein „gleichberechtigtes“ Glied. Das Perso-
nalpronomen „du“ korreliert mit den anderen Personalpronomen und
bildet mit ihnen zusammen eine Korrelationsreihe: ich—du—er.
R. Jakobson berücksichtigt den Gebrauch der Personalprono-
men, indem er verschiedene Genres der Literatur miteinander ver-
gleicht, in denen sich sechs Funktionen in unterschiedlichem Maße
realisieren: die kommunikative, die appellative, die poetische, die ex-
pressive, die fatische und die metasprachliche Funktion. Bei der Be-
stimmung der Besonderheiten jedes einzelnes Genres stützt sich R. Ja-
kobson auch auf die Kategorie der Person. So ist die lyrische Po e-
s i e mit der expressiven Funktion verbunden und bevorzugt die 1. Per-
son. Die Poesie, die sich auf die 2. Person stützt, erfüllt eine appellati-
ve Funktion: der Autor bittet oder belehrt jemanden. Die epische
Poesie erfüllt die kommunikative Funktion und ist durch die 3. Per-
son gekennzeichnet. In der Epopöe greift der Autor zur 3. Person
und wählt aus dem System der Zeitformen die Zeitform der Vergan-
genheit [s. Rkoöcoh, 1987, 86],
In den Beiträgen von K. Hamburger wird betont, dass alle
Äußerungen im lyrischen Text als Mittelpunkt das lyrische Ich ha-
ben. Das ganze lyrische Gedicht wird vom Leser als Empfindungsbe-
reich des Subjekts wahrgenommen. Die Äußerung wird nicht auf das
11 EoraTbipeua
305
Gedicht gerichtet. Es wird nur in den Bereich der Gefühle und Empfin-
dungen des Subjekts einbezogen. Das lyrische Ich hat eigene Gestal-
tungsmittel, und zwar die Personalpronomen „ich“ und „wir“, die Pos-
sessivpronomen „mein“, „unser“, sowie den indirekten Hinweis auf die
1. Person durch die Ansprache „du“. Dabei ist die Bedeutung des Perso-
nalpronomens „ich“ so groß, dass sein einmaliger Gebrauch im Text ge-
nügt, um den ganzen Text dieser Form unterzuordnen [s. Hamburger,
1968, 217, 232].
Man unterscheidet auch, wie bereits gesagt wurde, zwischen absolu-
tem und abhängigem Gebrauch der Pronomen [vgl. CnjibMan, 1969],
Beim absoluten (unabhängigen) Gebrauch drückt das Personalpronomen
„ich“ unmittelbar das lyrische Ich aus. Name, Alter, Äußeres und die so-
ziale Charakteristik des Subjekts spielen dabei keine Rolle. Das lyrische
Ich tritt also „inkognito“ auf.
Den abhängigen Gebrauch der Pronomen finden wir im epischen
Genre,™ die Pronomen der 3. Person die entsprechenden Substantive
ersetzen.
Die Kategorie der Person spielt eine bedeutende Rolle bei der Kons-
tituierung des Textes eines beliebigen Genres. Der wissenschaftliche
Text ist nicht so anthropozentrisch gestaltet wie der künstlerische Text,
aber die Kategorie der Person ist auch in diesem Funktionalstil sehr „ak-
tiv“. Die russische wissenschaftliche Prosa tendiert zu unper-
sönlichen Satzstrukturen, die englische dagegen zum häufigen Ge-
brauch der persönlichen Sätze mit dem Personalpronomen das
schon im ersten Absatz eingeführt wird. In den deutschen wissenschaft-
lichen Texten wird die erste Person vermieden und das unpersönliche
Passiv bevorzugt:
Im Folgenden wird zunächst, ausgehend „vom Text der amtlichen Rege-
lung“ in Kürze und beschränkt auf einige wesentliche Punkte die Neuregelung
der Getrennt- und Zusammenschreibung vorgestellt. Anschließend soll auf die
sich daraus ergebenden Probleme eingegangen werden.
Auch in den anderen Funktionalstilen spielen die Personalpronomen
„ich“, „du“ und „er“ eine bedeutende Rolle. So wird das Ich des Autors
als Mittelpunkt jeder Äußerung behandelt und lässt uns jede Äußerung
als egozentrisch und subjektiv einschätzen. Dabei wird dem
Pronomen „Ich“ die Hauptrolle zugewiesen. Aber auch die Personal-
pronomen „du“ und „er“ dürfen nicht übersehen werden. Sie werden
bei der Klassifizierung der Äußerungen nach dem Prinzip der subjekti-
ven Modalität berücksichtigt [s. ConrannK, 1981]:
Erster Typ: Äußerungen in der Ich-Form. Sie enthalten Personal-
pronomen „ich“, „wir“, Personalformen der Verben, Possessivprono-
men, Aufforderungs- und Fragesätze, Ausrufesätze und emotional ge-
färbte Strukturen, Schaltwörter, die eine subjektive Einschätzung aus-
drücken.
Zweiter Typ: Äußerungen in der Du-Form.
306
Dritter Typ: Äußerungen in der Er-Form. In diesen Äußerungen
ist die Subjektivität am wenigsten ausgedrückt.
Laut der traditionellen Grammatik und der Kommunikationstheo-
rie bezeichnet die 1. Person den Sprecher, die 2. Person den Angespro-
chenen und die 3. den Besprochenen oder das Besprochene. Aber bei
der Anwendung auf eine einfache Äußerung versagt diese Bestimmung.
So ist das Personalpronomen „wir“ in der Äußerung Ich kann heute
nicht kommen, wir haben Gäste nicht der Plural von „ich“, das heißt,
nicht eine Mehrzahl von Sprechern, sondern der Sprecher und min-
destens noch eine Person, die momentan in das Gespräch mit einbe-
zogen wird, die aber nicht als Sprecher fungiert. In der modernen Lin-
guistik wird nachhaltig betont, dass die traditionelle grammatische Ka-
tegorie „Person“ vom k o m m u nikation s - texttheoreti-
schen Standpunkt aus behandelt werden soll [s. Scherner, 1984,
100-101].
Die so verstandene Kategorie der Person kommt nicht nur im Pa-
radigma des Verbs und als Pronomen vor. Sprachliche Mittel, die zu
verschiedenen Ebenen gehören, können in ihrem Zusammenwirken
im Text die Kategorie der Person zum Ausdruck bringen. So kann
nach der Meinung von M. Scherner ein Katalog der personhalti-
gen Phänomene zusammengestellt werden. Er enthält sowohl explizit
personhaltige Phänomene (Personalpronomen, Possessivpronomen,
Anrede, Imperativ) als auch implizit personhaltige Phänomene (das
Pronomen „man“, eine besondere Verwendung des Pronomens „wir“
im Gespräch mit kleinen Kindern: Wir müssen ins Bett, Interjektio-
nen, Partikeln, alle Wort- und Satzfragen, die "Verwendung von Ei-
gennamen und dem bestimmten Artikel, Adverbien „vermutlich“,
„leider“, Modalverben, metakommunikative Wendungen „das
heißt“, „kurz und bündig“, mit denen der Sprecher seine Mitteilung
kommentiert).
Diese Sprachmittel implizieren den Sprecher und den Angesproche-
nen.
Außer den literaturwissenschaftlichen, stilistischen, pragmatischen
und textlinguistischen Interpretationen wird die Kategorie der Person
auch als ein Ausdrucksmittel der impliziten globalen Superkategorie
„MENSCH“ ausgelegt. Die Personalpronomen der 1., 2. und 3. Person
bilden eine Opposition, in der das Sem „Mensch“ mit verschiedenem
Intensitätsgrad vertreten ist: „die 1. Person (das starke Glied) — die 2.,
3. Personen (die schwachen Glieder)“. Das bezieht sich auch auf Präpo-
sitionalfügungen wie „mit ihm“, „von ihr“ usw, die im Unterschied zu
den Pronominaladverbien „damit“, „davon“ u.a. nur ein Lebewesen
bezeichnen [vgl. Schendels, 1980, 372].
Wenn wir die Kategorie der Person in der Vielfalt ihrer Funktionen
behandeln, so können wir auch ihre Rolle in der Textgestaltung im vol-
len Maße auswerten und über die Herausbildung der personalen Text-
struktur sprechen.
307
§71. Das Pfcrsonalnetz des Textes und seine Aufgaben.
Monopersonale und polypersonale Texte
Bei der Beschreibung der personalen Textstruktur stützen wir uns auf
das Personalnetz, das wir als Zusammenspiel von vielen Mitteln ver-
schiedener Ebenen verstehen. Dazu können folgende Einheiten gehö-
ren: Personalpronomen, Possessivpronomen, Anrede durch Pronomen,
Anrede mit Namen, Titeln, Berufsbezeichnungen, der Imperativ, das
Pronomen „man“, Inteijektionen, Partikeln, Fragen u.a.
Im Vergleich zum Temporal- und Lokalnetz ist das Personalnetz
mehrgliedrig. Einen Hinweis auf die Person enthält in einer be-
stimmten Form praktisch jeder Satz. Oft erscheinen im Rahmen eines
Satzes einige Hinweise auf die Person.
Die zweite Besonderheit der personalen Textstruktur besteht darin,
dass jede Person nicht nur mit zwei Formen des Numerus (Singular und
Plural), sondern auch mit einigen zusätzlichen Formen vertreten
ist. So bringt uns die stilistische und literaturwissenschaftliche Analyse
auf den Gedanken, dass das Pronomen „man“ einen besonderen Wert
für die inhaltliche Interpretation des Textes hat. Außerdem verfügt die
deutsche Sprache über drei Formen für die angesprochenen Personen:
„du“, „ihr“ und „Sie“.
Nun wenden wir uns einem konkreten Text zu.
Wunsch, Indianer zu werden
(F. Kafka)
Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden
Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden
Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel
wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemäh-
te Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.
Das Personalnetz dieses Textes besteht aus den folgenden Gliedern:
uww-Satz,... wäre... man... erzitterte... man... ließ... man... wegwarf. Es
ist ein explizites, Netz, denn es hat konkrete sprachliche Einheiten,
die die Kategorie der Person zum Ausdruck bringen. Es besteht also aus
Pronomen, Personalformen des Verbs, einem Wunschsatz und Verben
im Konjunktiv, die einen Sprecher implizieren. Das Netz ist monoperso-
nal, denn der ganze Text ist in der 3. Person geschaffen.
Von besonderem Interesse ist hier das unbestimmt-persönliche Pro-
nomen „man“. Wir können von seinem Seriengebrauch in diesem Text
sprechen.
Die Fantasie des Autors lässt uns klar und deutlich die Gefühle
des Menschen vorstellen, den der Autor mit „man“ bezeichnet. Wir
fühlen mit, und dieses man wird von uns schon bald als lyrisches Ich
empfunden. Subjektive Färbung bringt in den Text der irreale
Wunschsatz (Wenn man...) mit zwei Verben im Konjunktiv (wäre,
308
erzitterte). Er impliziert den lyrischen Helden im Zustand der „lyri-
schen Konzentration“.
Wie gesagt, ist das lyrische Gedicht in erster Linie mit der expressiven
Funktion verbunden und bevorzugt die erste Person. Wenn der Autor je-
manden um etwas bittet oder an jemanden appelliert, führt er die
zweite Person ein. Verfolgen wir das an einem Beispiel aus der mo-
dernen Poesie, die völlig auf Reim und Rhythmus verzichtet, die
wichtigsten Züge eines lyrischen Textes aber beibehält, darunter das ly-
rische Ich und das namenlose Du. So ist es also poiypersonal:
Wo
Wo nähme ich noch Hände her,
sie darüber zu ringen —
wenn du keine Hände hast,
mich aufzuhalten?
An deiner Schulter
Fall ich handlos,
ein Torso,
vorbei.
(O. Leist)
Das lyrische Gedicht setzt einen Akzent auf den inneren Zu-
stand des lyrischen He 1 den und braucht keine genauen An-
gaben über Zeit und Ort sowie auch keine Präzisierung der Personen
(des Sprechers und des Angesprochenen).
Eine andere Aufgabe erfüllt das Personalpronomen in Kafkas Minia-
tur „Die Bäume“:
Die Bäume
Denn wir sind wie Baumstämme im Schnee. Scheinbar liegen sie glatt auf,
und mit kleinem Anstoß sollte man sie wegschieben können. Nein, das kann
man nicht, denn sie sind fest mit dem Boden verbunden. Aber sieh, sogar das
ist nur scheinbar.
Diese Miniatur hat den Charakter einer Sentenz. Ihre künstlerische
Zeit ist nicht genau bestimmt und erstreckt sich auf eine unbegrenzte
Zeitperiode, die als Jetzt“ und „immer“ bezeichnet werden kann. Als
ihr grammatisches Ausdrucksmittel dient das generalisierende Präsens.
Der Ort der Handlung ist nicht angegeben. Das entspricht vollkommen
dem pragmatischen Ziel dieses Textes — eine Verallgemeinerung
zu äußern, einen Gedanken, der für alle Zeiten gültig ist. Das wird auch
durch die personale Textstruktur unterstrichen. Das Personalnetz dieser
Miniatur besteht aus fünf Formen, die sieben Übergänge von einer
Form zu einer anderen bilden: 1. Person PI. {man, sind)', 3. Person PI.
(sie, liegen auf)', 3. Person Sg. (man, sollte)', 3. Person PI. (sie); 3. Person
Sg. (man, kann); 3. Person PI. (sie, sind); 2. Person Sg. (sich); 3. Person
Sg. (das, ist).
309
Das Pronomen „wir“, das am Anfang des Textes erscheint, stellt
schon eine Verallgemeinerung dar. Sie nimmt mit der Einführung des
unbestimmt-persönlichen „man“ zu. Einen Kontrast bildet die Anspra-
che an den Leser: Aber sieh.... Damit wird ein Übergang aus dem Be-
reich der abstrakten Überlegungen zu einem Dialog mit dem Leser ver-
zeichnet.
Dieser Personenwechsel ist allen Texten eigen, die einen belehren-
den Charakter haben. Dazu zählen die Parabeln und die Kalen-
dergeschichten von J. P. Hebel, die oft mit einer Moral enden. Sie
ist mit dem Verb „merken“ im Imperativ versehen:
Merke: Man muß nie mehr scheinen wollen, als man ist und als man sich zu
bleiben getrauen kann wegen der Zukunft.
Die Einführung der 2. Person durch den Imperativ macht die Infor-
mation, die früher mitgeteilt wurde, aktuell: der Imperativ zielt auf
einen konkreten Leser, der eine Lehre daraus ziehen soll.
Inden publizistischen Texten überwiegt die 3. Person. Das
Personalnetz hat zahlreiche Glieder, die aber hauptsächlich durch die
Personalpronomen als Ersatzformen der Substantive und durch die ver-
balen Personalformen vertreten sind. Selbstverständlich hängt der Be-
stand des Personalnetzes vom Genre ab, aber das Ich des Autors sowie
auch das Du/Sie des Lesers treten in vielen publizistischen Texten in den
Hintergrund. So lesen wir in einem Verlagsprogramm:
In seinem vierten Gedichtbuch sammelt der österreichische Lyriker Hans
Raimund poetische Scherben von den Mythen des Alltags, aus Lebensaltern,
Orten des Vorübergehens, des Verbleibens. Es entstehen Bildkreise zum Mythos
Landschaft, Beziehung, Geschichte, Kunst, Kindheit, Wort, Gewalt, Angst,
Wen ... Gibt es noch „Drachen in unbeschriebenen Himmeln fischend“? Er-
übrigt es sich, „die Schrift der Zehen im Staub zu entziffern“, nehmen wir eher
„zu Protokoll was wir aus dem Stegreif träumen“? In diesen Gedichten, (Kin-
der-)Liedern, Märchen, Strophen, Zyklen und Kürzeln findet sich ein „Weiter-
schauen mit den Augen des richtigen Worts“ (Peter Handke) und aus den ver-
worfenen Steinen der Weisen wächst Menschliches. Raimunds feine, von Mu-
sik gestimmte, poetische Wtter-Gabe („witterst Lug, witterst Trug“) faßt das
unwägbar Prekäre der menschlichen Existenz in diesen Fin de sidcle-Zeiten in
unausgewogene, verdichtete wie spielerische Sprachgebilde, deren Wort-Schär-
fe und Satz-Fügungen die Bilder auf eine Weise randen, die den Lesenden wei-
ter ahnen läßt, übers Kaputte, Vertane, Verengte hinaus, ins Offene. „Ich setze |
dem Leben | Zwickel ein.“
Obwohl in diesem Text dreimal die 1. Person erscheint, zweimal da-
bei in Zitaten, überwiegen in der personalen Textstruktur die Formen
der dritten Person. Das erlaubt dem Autor, sein pragmatisches Ziel zu
erreichen, das darin besteht, dem Leser eine volle und möglichst
objektive Information mitzuteilen. Das Distanzieren vom Dargeleg-
ten und die sich daraus ergebende bestimmte Objektivität wird gerade
durch die 3. Person gesichert.
310
In der Alltagsrede finden wir alle Ausdrucksformen der Katego-
rie der Person. Der rasche Übergang von der 1. Person zur 2. und 3. ist
für diesen Funktionalstil kennzeichnend. Als Beispiel führen wir ein Te-
lefongespräch an, das die spontane Rede darstellt:
B: B.
A: Tag, Frau B, hier is A.
B: Frau A.
A: Liegt irgendwas an?
B: Ja, ich hab ä/en Fernschreiben hier liegen, ö, in Französisch, nu weiß ich
ja nit, ob Sie dat übersetzen müssen, oder ob er so klar kommt. Er ist nit da
heut morgen.
A: Ah so.
B: Is ers heut namittag da.
A: Naja, wenner nich klar kommt, kanner mich ja anrufen. Dann würdich
ma vorbeikommen. Es ist so, ich hatte auf die ö/das Formular von der D drauf-
geschrieben, ich wurddie bis Ende September abgeben. Ich könntdie auch heu-
te abgeben...
(R. Brons-Albert. „Gesprochenes Standarddeutsch“)
Dieses Gespräch zwischen einer wissenschaftlichen Hilfskraft und
der Sekretärin ihres Übersetzungs-Auftraggebers beweist die Tatsache,
dass der Dialog zahlreiche Übergänge in der Personalstruktur hat:
l.P. - 2.P. (Sze-Form) - 3.P. - 2.P. - 3.P. - l.P. - 3.P. - LP. -
2.P. (Sze-Form) - 3.P. - l.P. — 3.P. - l.P. - 3.P. - l.P.
Dabei wird die Kategorie der Person nicht nur durch explizite For-
men (Personalpronomen „ich“, „er“, „Sie“; Anrede), sondern auch
durch implizite Formen (Fragen, Konjunktiv Dann würdich...) zum
Ausdruck gebracht.
Literaturnachweis
1. Brons-Albert R. Gesprochenes Standarddeutsch: Telefondialoge. — Tü-
bingen, 1984.
2. Hamburger K. Die Logik der Dichtung. — 2. Aufl. — Stuttgart, 1968.
3. Schendels E. I. Die Kategorie Mensch in der deutschen Gegenwartsspra-
che // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsfor-
schung. - 1980. - Bd. 33. - H. 3. — S. 371-378.
4. Schemer M. Sprache als Text. — Tübingen, 1984.
5. Amapoea K.H., Jleccicuc F.A. CeMaHTKKa n crpyicrypa noßecTBOBaHMH ot
nepBoro Jinua b xynoxecTBeHHon npoae // Hsbccthm AH CCCP. CepKM jimt.
h M3. - 1976. - T. 35. - No 4. - C. 343-356.
6. Amapoea K.H., Jleccicuc F.A. CeMaHTMKa n crpyicrypa noBeCTBOBannfl ot
TpeTbero jinua b xyuoxecTBeHHow npoae // Hsbccthm AH CCCP. CepKM jimt.
h M3. - 1980. - T. 39. - No 1. - C. 33-46.
7. Eoeambipeea H.A. IIoBecTBOBaHne ot nepBoro Jinija b coBpeMenHon
hcmcukom xyjjoxecTBeHHOü jiKTeparype: ABTopecj). jjkc. ... Kami. (Jjkjioji.
HayK. — M., 1973.
311
8. Ho3dpUHa JI.A. IIoaTHKa rpaMMaTMHecKKX KareropKÜ: Kypc jickumü no
KHTepnpeTauwM xyjjoxeCTBCHHoro tckctb. — M., 2004.
9. CwibMciH T.A. CrpyKTypHbie oco6chhoctk jimpmhcckmx BCTaBOK npoaa-
KnecKoro TCKCTa // IIpoßjieMbi JiKHrBKCTuqecKOw ctkjimctkkk. MaTepnajibi
Hay^HOw KOH^epcHnnn. — M., 1969. — C. 132—133.
10. CoßeaHUK F.$L K npoßjieMe Tnnojiomn penn // Bonpocbi H3biKO3Ha-
hum. - 1981. - Nöl. - C. 70-79.
11. Hkoöcoh P. PaßoTbi no no3TKKC. — M., 1987.
Kapitel 16
DIE REFERENTIELLE STRUKTUR DES TEXTES
§ 72. Der Begriff „Referenz“
Das kognitive Herangehen an den Text lässt uns die Inhaltsstruktur
des Textes vom Standpunkt des erkennenden Subjekts aus darstellen
und eine Antwort auf die Frage suchen: Wie erkennt der Mensch seine
Umwelt?
Dabei rückt die Intention des Sprechenden in den Vordergrund —
was will er dem Gesprächspartner mitteilen, zu welchem Zweck und
wie, in welcher Form bringt er die Information — als etwas Neues
oder etwas schon Bekanntes, in einer verallgemeinernden oder einer
konkretisierten Form. Damit kommen wir auf die Referenz zu spre-
chen.
Im Unterschied zu den anderen Kategorien (Kategorie der Zeit, des
Ortes, der Person), die Analoge in der Literaturwissenschaft haben, kam
die Referenz in die Linguistik aus der Logik.
Unter Referenz versteht man in der Linguistik das Bezogensein eines
Wortes auf ein Denotat, das heißt auf einen Gegenstand der eigentlichen
Wirklichkeit \s. Moskalskaja, 1984, 99}.
Der Gegenstand heißt Referent. Keine Textreferenten sind viele
Substantive, die in der Autorerzählung und im Dialog nur einmal vor-
kommen. Das sich wiederholende Substantiv oder seine Substitute müs-
sen sich auf ein und denselben Gegenstand beziehen. Der Text kann ei-
nen oder einige Referenten haben, die in verschiedenen Positionen er-
scheinen: im Titel, am Anfang oder erst in der Mitte des Textes.
In der ersten Forschungsperiode wurden hauptsächlich die Aus-
drucksmittel der Bestimmtheit/Unbestimmtheit untersucht, darunter
der bestimmte/unbestimmte Artikel, später — verschiedene Arten der
Referenz.
Bleibt man auf dem Niveau eines Satzes oder einer Äußerung, so
spricht man über die folgenden Arten der Referenz: identifizierende —
nichtidentifizierende, generalisierende — individualisierende Referenz.
312
Ausdrucksmittel der Textreferenten sind hauptsächlich das Substan-
tiv, das Pronomen und der Artikel, der auf die Bestimmtheit oder Unbe-
stimmtheit hinweist.
§ 73. Das Referenznetz. Monoreferentielle
und polyreferentielle Texte
Heute spricht man von der referentiellen Textstruktur. Sie besteht aus
allen Textreferenten und ihren Begleitern. Sprachliche Ausdrucksmittel
der Referenz sind demnach Substantive und Pronomen, Artikel, Nume-
ralien, Quantitätsadjektive, Demonstrativpronomen und Possessivpro-
nomen, Adjektive, die auf verschiedene Referenzarten hinweisen (viele,
etliche, folgende, irgendein, kein usw), der Attributsatz. Diese Mittel bil-
den das Referenznetz des Textes.
Bei der Beschreibung des Referenznetzes muss man also zwei Cha-
rakteristiken berücksichtigen: die des Referenten selbst und die seiner
Begleitung. Die meisten Texte haben einen expliziten Referenten.
Der monoreferentielle Text hat nur einen Referenten, wie z. B. die
folgende Kalender geschickte von E. Strittmatter:
Wände!
Ein Blatt fallt vom Baum. Weiß es noch, dass es zum Baum gehörte; fühlt
sich’s noch Lunge oder schon Wurzeldung?
Das Referenznetz dieses Textes besteht aus vier Gliedern mit einem
Begleiter (dem unbestimmten Artikel): Ein Blatt... es... es... es. Die Auf-
merksamkeit des Lesers wird auf einen Gegenstand gerichtet. Der Text
gleicht einer Sentenz, was auch seinen Umfang und seine referentielle
Struktur bedingt. Die Konzentration auf einen Gegenstand beschränkt
die Zahl der Referenten.
Die meisten Texte sind polyreferentiell: sie haben zwei oder mehrere
Referenten. So sind auch Texte polyreferentiell, deren Inhalt nur einem
Thema gewidmet ist. Nehmen wir als Beispiel eine Rezension. Sie
lautet:
N.N. geht es um Sprachkunstwerke oder künstlerisch-literarische Werke.
Wenn „Erkenntnisse über das literarische Werk als solches gewonnen werden
sollen“, wird—völlig zu Recht — der Linguistik die Rolle einer Hilfswissen-
schaft zugewiesen, die Beiträge zu leisten hätte: (1) zur Beschreibung der lite-
rarisch-künstlerischen Kommunikation; (2) zur Bewertung literarischer Werke;
(3) zur Erhöhung der Sprachkultur durch Bewußtmachen des ästhetischen
Reizes sprachlicher Gestaltung; (4) zur Erfassung der individuellen Gestal-
tungsweise eines Schriftstellers; (5) zum vollen Werkverständnis. Ungeachtet
der im Grundsätzlichen sicher richtigen Orientierung muß man wohl die ein-
zelnen Zielstellungen bzw Möglichkeiten differenzierter und damit konkreter
fassen. Der Verfasser beschränkt sich bei der Erläuterung von Punkt (1) auf die
Aneignungs-Probleme, doch wenn von literarisch-künstlerischer Kommunika-
313
tion die Rede ist, müßte man wohl doch zwischen künstlerischer Produktion,
Reproduktion und Rezeption unterscheiden...
Der Text hat einige Referenten, die die referentielle Struktur bilden.
Das Referenznetz sieht so aus:
Referent 1: Sprachkunstwerke... künstlerisch-literarische Werke...
das literarische Werk als solches... literarischer Werke... Werk{verständ-
nis).
Referent 2: ...der literarisch-künstlerischen Kommunikation... von
literarisch-künstlerischer Kommunikation... zwischen künstlerischer Pro-
duktion, Reproduktion und Rezeption...
Referent 3: N.N. ...der Verfasser ...man...
Hauptsächlich werden die Referenten durch Substantive vertreten
und von adjektivischen Attributen begleitet. Der zweite Referent (Kom-
munikation) wird auch durch seine Bestandteile (Produktion, Repro-
duktion und Rezeption) genannt, der dritte auch durch Eigennamen
und das unbestimmt-persönliche Pronomen „man“, unter dem auch
der Verfasser verstanden wird. So können wir in diesem Fall über ein ge-
mischtes Referenznetz sprechen.
Ein pronominales Referenznetz ist für lyrische Werke charakte-
ristisch, was wir z. B. in der Miniatur von R. Putzger beobachten können:
Kurzer Besuch in vertrauter Gegend
Hochwasser, noch immer kannst Du den Bootssteg betreten, kühl weht der
Wind um die blattlosen Bäume, aus der sandigen Erde stoßen vereinzelt zart-
grün die Halme, im Folie-Gewächshaus wachsen die Nelken, die Boote im
Schuppen geschliffen und lackiert, aufgebockt harren sie auf die Sonne, die
Straße wird schon wieder mal aufgerissen, noch finde ich den Weg zu deinem
Haus, da sitzt du mit einem anderen, das Fenster geschlossen, leere Kaffeetas-
sen auf dem Tisch, du blickst auf die dünnen Zweige der Trauerweide vorm See,
der Sohn kommt aus der Schule, sagt: Guten Tag, der andere holt eine Flasche
Wein aus dem Schlafzimmer, die Gespräche, höflich, drehn sich ums Segeln
und die Hoffnung auf wärmere Tage. Du brachtest mich bis an die Tür, langsam
lief ich den ausgefahrenen Weg bis zur Straße, Krokusse blühten vorm Spargel-
beet, als ich mich umdrehte, sah ich dich klein in der Haustür stehn, weiß
leuchtete dein Pullover, keiner von uns hob die Hände zum Winken.
Der Text hat zwei Hauptreferenten, die durch Personalpronomen
vertreten sind:
Referent 1: du ... zu deinem {Haus) ... du ... du ... Du ... dich.
Referent 2: ich ... mich ... ich ... ich ... mich ... ich.
Dabei können wir vom absoluten oder unabhängigen Ge-
brauch der Personalpronomen sprechen: sie ersetzen kein Substantiv,
sind also keine Substituten der Substantive. Einerseits werden die beiden
Referenten als konkrete Gestalten der fiktionalen, poetischen Welt
wahrgenommen. Das sind der Autor {ich) und seine ehemalige Frau
{du), an die er sich wendet. In diesem Fall sprechen wir über die identifi-
zierende Referenz.
314
Das Ich und Du können aber nur eine verallgemeinernde Bedeutung
haben. Sie bezeichnen die Person als Mittelpunkt des lyrischen Textes,
als Ausgangspunkt aller Erlebnisse und Empfindungen:
Ich und Du
Wir träumen voneinander
Und sind davon erwacht,
Wir leben, um uns zu lieben,
Und sinken zurück in die Nacht.
Du tratst aus meinem Traume,
Aus deinem trat ich hervor,
Wir sterben, wenn sich eines
Im anderen ganz verlor.
Auf einer Lilie zittern
Zwei Tropfen rein und rund,
Zerfließen in eins und rollen
Hinab in des Kelches Grund.
(Friedrich Hebbel)
Die Textreferenten „ich“ und „du“ sind von allen überflüssigen Ein-
zelheiten frei. Sie fungieren im Text als zwei Inkognitos. Wir wissen
nichts von ihrem Alter, Charakter oder Äußeren. Der Autor betont nur
ihre Gefüh 1 e, ihren Gemütszustand.
An diesem Beispiel können wir eine andere Besonderheit des lyri-
schen Textes verfolgen: die Spaltung des Textreferenten „wir“ und die
Wiedervereinigung des „Ich“ und „Du“ in „Wir“.
§ 74. Die Aufgaben des Referenznetzes
in verschiedenen Funktionalstilen
Die genauesten Charakteristiken bekommen Textreferenten, wenn
sie mit adjektivischen Attributen gebraucht werden. In kognitiver Hin-
sicht helfen sie dem Leser das Verhalten des Autors zum Textreferenten
zu bestimmen. Sie enthalten die wichtigste Information über seine
Sichtweise.
Im Funktionalstil der Presse und Publizistik, der durch das
Streben nach objektiver und glaubwürdiger Information gekennzeichnet
ist, werden als Textreferenten oft Eigennamen gebraucht. Sie tragen
zum dokumentarischen Charakter des Textes bei, indem sie real
existierende Orte oder Menschen nennen:
Geburt der abstrakten Malerei
Die Kunst entfernt sich vom Gegenständlichen. Der russische Maler
Wassily Kandinsky beginnt mit der Arbeit an seinem Essay: „Über das Geis-
tige in der Kunst“, der 1912 veröffentlicht wird. In der Verbindung von Idee,
315
Philosophie mit dem künstlerischen Schaffen durchbricht er bewußt die
Formen des Gegenständlichen. Er entwickelt die Konzeption von der rei-
nen nichtdinglichen Malerei. In diesen Bildern konkretisiert er sein Vorha-
ben: zum erstenmal entstehen gegenstandslose oder abstrakte Bilder. Seine
Kompositionen sind geometrische Farbflächen und perspektiveerzeugende
Linien.
Der abstrakten Malerei nähert sich Kandinsky in seinen Bildern schrittwei-
se, Figuren werden zu Farbflächen und Mustern.
Die Arbeiten sind von größter Tragweite für die Geschichte der modernen
Malerei. „Die Harmonie von Farbe und Form“, schreibt Kandinsky, „muß al-
lein auf dem Prinzip des eigenen Kontakts mit der menschlichen Seele beru-
hen“. (Chronik des 20. Jahrhunderts)
Die Bezeichnung des Textreferenten durch einen Eigennamen ( Was-
sily Kandinsky) und seine Ersatzform (er) fordert keine Begleitwörter.
Die knappe Form eines Artikels aus der Chronik, sein dokumentarisch
bedingter Charakter spiegeln die Objektivität als Unterschei-
dungsmerkmal dieses Genres wider.
Einen implizit vorhandenen Referenten finden wir im Text „Im
Hofe“ (S. 281). Zwei Hauptreferenten — Flora und Fauna — werden
im Text nicht genannt und sind nur durch ihre Bestandteile vertreten.
Der erste Referent „Fauna“ wird durch die Substantive Starenkasten,
Jungstare, Schwalben, Kleinkäfer, Geziefer, der zweite „Flora“ —
durch Wiesenkraut) Fliederdolden) Blumen eingeführt. Die beiden
Textreferenten gestalten zwei Unterthemen, die den Hauptgedanken
des Autors zum Ausdruck bringen: alle Erscheinungen sind in der
Natur miteinander verbunden und bilden eine kontinuierliche Folge.
Man kann auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten im Gebrauch der Be-
gleiter (Quantifikatoren) des Referenten feststellen. So erscheint, wie
gesagt, der Textreferent in einem Märchen mit dem unbestimmten
Artikel und erst dann mit dem bestimmten:
Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: „Ach,
wenn wir doch ein Kind hätten!“ und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als
die Königin einmal im Bade saß, daß ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch
und zu ihr sprach: „Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht,
wirst du eine Tochter zur Welt bringen.“ (Grimm. „Dornröschen“)
Die Reihenfolge „unbestimmter Artikel — bestimmter Artikel“
wird dadurch bedingt, dass am Anfang des Textes neue, für den In-
halt des Textes bedeutende Personen und Gegenstände eingeführt
werden. Wie im Abschnitt über den Artikel betont wurde (s. S. 219 —
220), lässt uns der unbestimmte Artikel den Wortschatz des gegebe-
nen Märchens zusammenstellen, denn Substantive mit dem unbe-
stimmten Artikel kennzeichnen (nach T. M.Nikolajeva) die wichtigs-
ten Begriffe und bilden die Stichpunkte des Märchens. Außer-
dem spielt dabei die kommunikative Struktur des Textes eine bedeu-
tende Rolle. Das Märchen ist nach der linearen kommunikativen Pro-
316
gressiqn gebaut: das Rhema des vorhergehenden Satzes wird zum
Thema des nachfolgenden Satzes (nach F. Dane§). Wie bekannt, er-
scheint das Thematische Element mit dem unbestimmten und das
thematische mit dem bestimmten Artikel. Dank diesem Aufbau
klingt der Text melodisch, die Handlung entwickelt sich ohne
Hast, was den pragmatischen Zielen des Märchens völlig entspricht:
es soll nicht nur den Hörer unterhalten, sondern ihn auch in den
Schlaf wiegen.
Anders ist der Artikelgebrauch in der Fabel mit ihren symboli-
schen Gestalten. Schon bei der Ersterwähnung erscheint der Textrefe-
rent mit dem bestimmten Artikel:
Der Pfau und der Hahn
Einst sprach der Pfau zu der Henne'. Sieh einmal, wie hochmütig und trot-
zig dein Hahn einhertritt! Und doch sagen die Menschen nicht: der stolze
Hahn, sondern nur immer: der stolze Pfau.
Das macht, sagte die Henne, weil der Mensch gegründeten Stolz übersieht.
Der Hahn ist auf seine Wachsamkeit, auf seine Mannheit stolz; aber worauf
du? — Auf Farben und Federn. (G. E. Lessing)
Da aber die Fabel oft schwer von einem Märchen abzugrenzen ist,
gilt auch für die Fabel manchmal die Regel des Artikelgebrauchs, die wir
im Märchen beobachten: zuerst erscheint der Referent mit dem unbe-
stimmten, dann mit dem bestimmten Artikel:
Das Schaf und die Schwalbe
Eine Schwalbe flog auf ein Schaf ihm ein wenig Wolle für ihr Nest auszu-
rupfen. Das Schaf sprang unwillig hin und wieder. Wie bist du denn gegen mich
so karg? sagte die Schwalbe. Dem Hirten erlaubst du, dass er dich deiner Wolle
über und über entblößen darf, und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Wo-
her kömmt das?
Das kömmt daher, antwortete das Schaf, weil du mir meine Wolle nicht mit
ebenso guter Art zu nehmen weißt als der Hirte.
Literaturnachweis
1. Moskalskaja O.I. Textgrammatik. — Leipzig, 1984.
2. Schendels E. I. Der Artikel als Gestaltungsmittel der Polyphonie im Wort-
kunstwerk // Zeitschrift für Germanistik. — H. 3. — 1981. — S. 314—321.
3. Weinrich H. Sprache in Texten. — Stuttgart, 1976.
4. Weinrich H. Textlinguistik: Zur Syntax des Artikels in der deutschen
Sprache// Jahrbuch für Internationale Germanistik. — 1969. — Jb. 1. —
H. l.-S. 61-74.
5. ÄpynuoHoea H.JJ. JlMHTBKCTKHecKne npoßjieMbi pe^epeHunn // Hoßoe
b aapyßexHow jiMHrBKCTKKe. — M., 1982. — Bbin. XIII. — C. 5 — 40.
6. KyaÜH y. O. Pe^epeHunn n MojjajibHocTb // Hoßoe b 3apy6exHow
jiKHrBKCTHKe. — M., 1982. — Bbin. XIIL — C. 87—108.
7. MocKajibCKax O.H. IpaMMaTHKa TeKCTa. — M., 1981.
317
8. HoidpuHa ILA. nosTHKa rpaMMaTwqeCKHX KaTeropun: Kypc jickuhü no
MHTepnpeTauMM xyuoxeCTBeHHoro TeKCTa. — M., 2004.
9. IJuebfiH T.B. KaTeropun onpeAeJieHHocTK — HeonpefleJieHHOCTH b
CTpyKType BOJimeÖHoif CKa3KM // KaTeropun onpe,aeJieHHOCTn —neonpe-
JieJieHHOCTM B CJiaBRHCKKX K ÖaJIKaHCKMX M3blKaX. — M., 1979. — C. 330 —
347.
Kapitel 17
DIE MODALE STRUKTUR DES TEXTES
§ 75. Die Kategorie der Modalität und ihre Aspekte
Die Kategorie der Modalität gewinnt in der letzten Zeit an Bedeu-
tung, weil die Linguistik ein besonderes Interesse an der kognitiven Seite
der Sprache zeigt. Diese Kategorie ist unmittelbar mit der Einschätzung
der Ereignisse als wahr/unwahr, real/irreal, möglich/notwendig verbun-
den. Die meisten Sprachforscher behaupten aber, dass nicht alle Funk-
tionalstile sich vom modalen Standpunkt aus beurteilen lassen. So gibt
der belletristische Text wegen seiner komplizierten Semantik keine
Möglichkeit, ein eindeutiges Verhältnis zwischen der fiktionalen und der
realen Welt festzustellen.
In der Literaturwissenschaft unterscheidet man in Bezug auf die Mo-
dalität folgende Typen von Texten:
1. Texte, in denen das Reale überwiegt. Dazu gehören der Aufklä-
rungsroman, der realistische Roman, die psychologische und philoso-
phische Prosa, der soziale Roman der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts.
2. Texte, in denen das Irreale überwiegt. Dazu zählen die heroischen
Poeme, der gotische Roman, der Ritterroman, die Abenteuerliteratur,
die Fantastik, der Mythos, die Posse, die Groteske, die Burleske
[s. Typaeea, 1994, 110—111}.
J. R. Galperin versteht Modalität als das direkt oder indirekt ge-
äußerte Verhalten des Autors zur poetischen Welt, die er geschaffen hat
[vgl. laJibnepriH, 1978, 725].
Neben den grammatischen und lexikalischen Ausdrucksmitteln sind
an der Gestaltung der Textmodalität stilistische, intonatorische und
kompositionelle Mittel beteiligt.
Als subjektive Einschätzung drückt sich die Modalität besonders
deutlich in den poetischen Werken aus.
Die anderen Sprachforscher schließen in die Modalität auch Beja-
hung und Verneinung, Expressivität und Emotionalität, Frage und Auf-
forderung ein, so wie sie, zum Beispiel, im Gedicht „Lichtbild eines
Frauengesichts“ von Josef Leitgeb (1897— 1952) zum Vorschein
kommt, der so hell und begeistert die Welt sieht:
318
Wie glücklich muß das Licht gewesen sein
im Augenblicke, da es dich umfing,
so ganz umfing, dass es dich ganz behielt!
Wie zärtlich hat es mit dem Haar gespielt,
bevor’s, die Stirne streifend, niederging
und auf der Wange blieb als warmer Schein!
Die Augen? Ach, was sollte da das Licht?
Sie leuchteten so stark von innen her
mit jenem Blicke, den der Gott entfacht!
O Lebenstag! O Liebesnacht!
Wenn nicht das Licht aus diesen Augen wär’,
von welchem Lichte lebte das Gesicht?
Zahlreiche Ausrufesätze, Fragesätze, der u^nn-Satz mit dem Kon-
junktiv, der die irreale Bedingung zum Ausdruck bringt, sind Mittel,
die den höchsten Grad der Emotionalität und dadurch auch die Ein-
stellung des Autors zu der von ihm geschaffenen poetischen Welt
äußern.
Anders sind wissenschaftliche Texte, wo eine leidenschafts-
lose, logische, sachliche, gut argumentierte Beschreibung in den Vorder-
grund tritt. Das Subjektive bleibt aus:
Es kann heute als allgemein verbreitete Auffassung angesehen werden, dass
stilistische Fragestellungen nicht auf die schöne Literatur beschränkt werden,
sondern dass der übergreifende Gegenstand der Stilistik in ihrer Ausprägung als
relativ eigenständiger wissenschaftlicher Teildisziplin im Bereich der funktional
bestimmten Nutzung der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten auf allen Ge-
bieten der gesellschaftlichen Praxis liegt. (W. Fleischer, G. Michel. „Stilistik der
deutschen Gegenwartssprache“)
In den meisten Zeitungstexten ist die subjektive modale Bedeu-
tung deutlich zu erkennen, denn der Autor ist fast immer engagiert, will
dem Leser seine Einstellung zum Thema eindeutig zeigen und ihn für
sich gewinnen:
Es ist eine traurige Geschichte, die sich um das Tanzpaar Kati Winkler und
Rene Lohse rankt: Viele Stunden und das fast täglich, arbeiten sie seit einem
Jahrzehnt an dem Sprung auf ein internationales Podium. Doch geschafft ha-
ben sie es nie — bei den Olympischen Spielen 2002 in Sait Lake City waren sie
wegen einer langwierigen Knieverletzung Lohses mit Trainingsdefiziten an den
Start gegangen und nur Achte geworden. („Die Welt“, 2004)
Wortwahl (emotionale, einschätzende Lexik: eine traurige Geschich-
te), die Anfangsstellung des Partizips II (affektive Syntax: ...geschafft ha-
ben sie es nie...) und Metapherngebrauch {Sprung auf ein internationales
Podium) machen den Text gefühlsbetont und ausdrucksvoll.
Man unterscheidet auch die „dialogische Modalität“, die in den
dramatischen Texten zum Ausdruck kommt und das subjektive
Verhalten des Autors zur Information im Text ausdrückt. Zur dialogi-
319
sehen Modalität werden Billigung, Nachsicht, Bewunderung, Verurtei-
lung, Verachtung und Ironie gezählt [vgl. Aohckobh, 1982, 5],
Dieser Standpunkt scheint originell, aber nicht überzeugend genug
zu sein, denn dabei sind die Grenzen der Kategorie der Modalität völlig
verwischt.
Die Positionen der Grammatiker zeigen ebenfalls eine Vielfalt der
Standpunkte. Die meisten verstehen aber die Modalität als eine syntak-
tische Kategorie und unterscheiden drei Modi: Indikativ, Imperativ und
Konjunktiv. Einige schließen den Imperativ aus dieser Reihe aus, weil er
ein lückenhaftes Paradigma hat (er ist auf die 2. Person konzentriert, hat
die inklusive 1. Person und dabei keine Zeitformen). Der Imperativ wird
als eine besondere Form und nicht als ein selbstständiger Modus
behandelt [s. Moskalskaja, 2004].
Wir vertreten aber die Meinung, dass der Imperativ trotz seines lü-
ckenhaften Paradigmas ein selbstständiger Modus ist.
§ 76. Monomodale und polymodale Texte
Texte, die zum Stil der schöngeistigen Literatur gehören, sind mono-
modal oder polymodal, je nachdem, ob sie nur durch die Modalität der
Wirklichkeit oder auch durch die der Nichtwirklichkeit gekennzeichnet
sind.
Die Grundform der meisten Texte ist die Modalität der Wirklichkeit.
Das früher angeführte Gedicht von J. Leitgeb schildert emotionell eine
Welt, die die künstlerische Wirklichkeit widerspiegelt. Nur die letzten
zwei Zeilen drücken die irreale Bedingung aus und versetzen den Text in
die Klasse der polymodalen Texte.
Es gibt nur wenige Texte, die einen anderen Modus als Grundform
haben. Einer davon ist „Wenn die Haifische Menschen wären“ von
B. Brecht:
„Wenn die Haifische Menschen wären“, fragte Henn K. die kleine Tochter
seiner Wirtin, „wären sie dann netter zu den kleinen Fischen?“ „Sicher“, sagte
er. „Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im Meer für die kleinen
Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand Nahrung drin, sowohl
Pflanzen als auch Tierzeug. Sie würden sorgen, daß die Kästen immer frisches
Wasser hätten, und sie würden überhaupt allerhand sanitäre Maßnahmen tref-
fen...“
Zur potenzial-irrealen Modalität greift der Autor, um den Leser irre-
zuführen. Er gestaltet diesen Text als Fantasie. Auf den ersten Blick
scheint sie unwahrscheinlich zu sein, und erst später verspürt der Leser
die Identität der dargestellten Situation mit dem realen Leben.
Monomodal ist auch der auf S. 319 angeführte Auszug aus einem
wissenschaftlichen Text. Seine Autoren verfolgen das Ziel,
möglichst genau ihre Gedanken zu formulieren und die Information
320
mitzuteilen. Bei der Gestaltung eines wirklichkeitsbezogenen Textes
entspricht der trockenen, sachlichen Ausdrucksweise am besten der In-
dikativ.
In Werbungstexten, die Empfehlungen und Ratschläge enthal-
ten, erscheint oft der Imperativ als G run dmodus:
Tauchen Sie ein in die warmen Fluten des Roten Meeres!
Verfolgen Sie regenbogenfarbene Fische durch tropische Korallenriefe’
Bestellen Sie alle Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt!
Oder genießen Sie einfach ganzjährigen Sonnenschein an unberührten, gol-
denen Stränden!
Wählen Sie Ihren Favoriten unter den glattvollen Resorts, von vielen Urlau-
bern noch unentdeckt...
Viel öfter haben die Texte polymodalen Charakter. In der schön-
geistigen Literatur werden die Worte des Autors durch die Repli-
ken der handelnden Personen unterbrochen, die oft emotional gefärbt
und durch verschiedene Arten der Modalität gekennzeichnet sind. Bit-
ten, Wünsche, Annahmen, Befehle werden mit Hilfe verschiedener
Sprachmittel ausgedrückt, die zum Modalfeld gehören:
Studer fluchte, weil er sich einen Nagel abgebrochen hatte...
„Wenn Ihr nicht so verdammt rückständig wäret“, sagte Studer, „und we-
nigstens Drahtgitter vor den Fenstern anbringen würdet, dann könnten solche
Sachen nicht passieren. — So! Aber jetzt spring, Liechti, und hol den Doktor!“
„Ja, ja!“ sagte der Wärter ängstlich und humpelte davon. (JF.Glauser.
„Wachtmeister Studer“)
Es können auch verschiedene Arten der fremden Rede sein, die
den Text polymodal machen:
Ottilia Buffatto kommt mit zwei riesigen Metallkannen; Kaffee, Milch.
Sie sammelt die kleinen Kännchen auf den Tisch ein, füllt sie von neuem,
verteilt sie. Das hat Studer noch nie gesehen. Darum fragt er das Anni, wa-
rum sie sich nicht begnüge, eine Portion zu geben? — Die Leute sollen nicht
hungrig und durstig vom Tisch aufstehen, meint die Wirtin. Ein gutes Prin-
zip, findet der Wachtmeister, aber ob es auch ökonomisch sei? (F.Glauser.
„Krock & Co“)
Manchmal ist die Einführung einer anderen Art der Modalität da-
durch bedingt, dass im Text Überlegungen, philosophische Abweichun-
gen, prospektive und retrospektive Einblendungen, Verallgemeinerun-
gen und Annahmen erscheinen. Als Beispiel könnte die Miniatur von
U. Grüning „Waldwege“ angeführt werden. Da der Text ziemlich um-
fangreich ist, werden hier nur einige Absätze angeführt, die eine Vorstel-
lung über den Gedankenlauf des Autors und die modale Gestaltung des
Textes verschaffen:
„Es gibt schmale, kiesharte Wege an Waldrändern, Rainen, Bahndämmen
und Bächen, so daß wir, sobald sie sich von den Gleisen entfernen, aussteigen
möchten, um ihnen zu folgen.
321
Es sind nicht nur die Gesichter der Landschaft und das im Nachmittag stil-
ler werdende Licht, die uns zu unerfüllbaren Wünschen verleiten, und nicht al-
lein die an den Fenstern vorüberziehenden Tümpel und Bäume; es ist auch die
Ahnung, ein Vertrautes, Heimatliches durch unsere Fahrt zu verlieren. (...)
So verloren sind wir, daß, falls der Zug hielte, uns kein Fahrplan sagen
müßte, wann der nächste Zug fahre oder wie weit der nächste Flecken entfernt
sei. Uns weder um unsere Koffer noch um unsere Ankunft kümmernd, stiegen
wir aus in der Gewißheit, daß wir ihrer nicht mehr bedürften. Und nach vielen
Wegkrümmungen und schmalen hölzernen Brücken gelangten wir gegen Abend
in das erhoffte, waldverborgene Land.
Geliebt müßten wir werden und lieben in einer zwar verhaltenen, doch wär-
menden Sonne, wie sie an Sommerabenden zwischen den Bergkuppen steht.
Nur eines bäten wir uns aus’, daß keine dort auf Erlösung warte, wie es so oft im
Märchen geschieht.
Aber zum Glück hält der Zug nicht, und sobald wir die nächste Station er-
reicht haben, ist auch der Zauber verflogen...
Dieser Text stellt die Überlegungen des Autors dar, enthält Verallge-
meinerungen und ist temporal in das generalisierende Präsens gefasst.
Eine „Schaltepisode“ bilden zwei Absätze {So verloren... und Geliebt
müßten wir werden...). Inhaltlich sind sie ein Versuch des Autors, sich
eine ungewöhnliche Situation vorzustellen. Dieser Schritt in das Irreale
ist durch den Übergang in eine andere Art der Modalität gekennzeich-
net—in die potenzial-irreale Modalität mit Verben im Präterit
Konjunktiv, die eine Schicht der ausgedachten, erfundenen Welt gestal-
ten. Die Rückkehr in die Wirklichkeit wird durch die Umschaltung auf
den Indikativ und auf das generalisierende Präsens begleitet (Aber zum
Glück hält der Zug nicht...).
Polymodal ist in der Regel ein Alltagsgespräch, auch wenn es
nur eine Nachahmung ist:
Mann: Und ich habe oft Angst, die Tür zu berühren, die Wände, die
Schränke — weil ich fürchte, sie könnten unter meiner Berührung in Staub zer-
fallen...
Frau: Aber du siehst doch, daß es hält. (Lacht.) Hörst du? (Klopft gegen
die Tür.) Hörst du nicht, daß es standhält?
Mann: Ich bewundere deinen Mut.
Frau: Komm, überzeug dich davon, daß die Dinge, die uns umgeben, nicht
zu Staub zerfallen. Nimm die Flasche Wein da, öffne sie. (Eine Flasche Wein
wird geöffnet — es wird eingegossen.) Trinken wir auf Julius, wenn du auf ihn
trinken magst... (H.Böll. „Klopfzeichen“)
Die meisten Sätze sind durch die Modalität der Wirklichkeit/Reali-
tät charakterisiert, aber es erscheinen auch Sätze mit der potenzial-
irrealen Modalität {...sie könnten...) und mit der imperativi-
schen Modalität {Komm, überzeug dich... Nimm die Flasche usw.). Sie
gestalten die Rede als lebendige Äußerungen.
Nach einer lebendigen Ausdrucksweise streben auch die Autoren von
Leserbriefen. Ihre Sprache ist in der Regel emotionell, weil der Le-
322
serbrief erst dann entsteht, wenn die Veröffentlichungen einen tief be-
troffen haben. Solche Texte enthalten außerdem Wünsche, Bitten, An-
nahmen. Dies wird in der nachstehenden Reaktion einer Leserin auf
den Artikel über Thyssen-Henne und ihren beispielhaften Einsatz für
arme Tiere deutlich. Der Brief wurde in der Zeitschrift „Bunte“ (2003,
Ne 26) unter dem Titel „Die Seelen — Streichler“ gedruckt:
Liebe Frau Thyssen-Henne,
meine Hochachtung für Ihren selbstlosen Einsatz für arme Kreaturen. Es
könnten sich viele Menschen ein Beispiel daran nehmen. Tiere können nicht
wie wir Menschen ihr Leid ausdrücken und sind immer auf Menschen wie Sie
angewiesen. Ich bin sicher, wenn alle geschundenen Kreaturen meinen könnten,
so viele Tränen wären es. Auch viele meiner Freunde und Bekannten bewun-
dern und lieben Sie deswegen. Danke! {Brigitte Zahn, Steinbach)
Außer der Modalität der Realität mit dem Indikativ als Ausdrucks-
mittel, erscheinen in drei Sätzen die Formen des Konjunktivs, die eine
irrea le Bedin g u n g zum Ausdruck bringen. Sie verleihen dem
Text den Charakter der gesprochenen Rede, so emotionell, unbefangen
und ungezwungen diese Worte lauten.
§ 77. Das Modalnetz und seine stilistischen Aufgaben
in verschiedenen Funktionalstilen
Bei der Textanalyse hat der Sprachforscher die Modalität eines gan-
zen Textes zu analysieren und die allgemeineren, nicht auf der Satz-
ebene gegebenen Gesetzmäßigkeiten zu deuten [s. Moskalskaja, 1984,
116].
Jeder Funktionalstil ist durch eigene Besonderheiten gekennzeich-
net. Texte von Sprachkunstwerken haben ein komplizierteres Modali-
tätsmuster als Sachtexte, schreibt O. I. M oskalskaj a. Das erklärt
sich durch den häufigen Wechsel des Modalitätsschlüssels beim Zusam-
menwirken von Autorenrede und Figurenrede. Ein anderer Faktor ist
die Mannigfaltigkeit der Redeformen, deren sich der Autor bei der Re-
dewiedergabe der handelnden Personen bedient (direkte, indirekte, un-
eigentlich direkte Rede, innerer Monolog). Manche dieser Formen
erfordern den Konjunktiv [vgl. Moskalskaja, 1984, 119]. Die modale
Struktur eines ganzen Textes kann man als Modalnetz darstellen.
Unter dem Modalnetz wird die Gesamtheit der Sprachmittel aller Ebe-
nen {der morphologischen, syntaktischen, lexikalischen) verstanden, die
die Orientierung des Lesers im modalen Aspekt der fiktionalen Welt eines
konkreten belletristischen Textes sichern.
Dazu können folgende Bestandteile des grammatisch-lexikalischen
Feldes der Modalität gezählt werden wie drei Modi (der Indikativ, der
Konjunktiv, der Imperativ), Modalverben und Verben mit modaler Be-
deutung, Modalwörter, Adverbien {überzeugend), einige Verben {zwei-
323
fein), die Konstruktionen haben + zu + Infinitiv und sein + zu + Infinitiv,
das Futur I und das Futur II in der modalen Bedeutung, lexikalisch-syn-
taktische Mittel (Sätze wie Es scheint, dass...; Es ist sicher, dass...; Sätze
mit als, als ob) [s. HosjipnHa, 2004, 145}.
Weil das Modalnetz eine syntagmatische Kategorie der Textebene ist,
spiegeln seine Charakteristiken funktionale und Genrebesonderheiten
des gegebenen Textes wider.
So ist die Modalität der Annahme sowohl für die künst-
lerische Literatur als auch für die Alltagsrede typisch. Dabei
wäre sie in Instruktionen, Gesetzen, Vorschriften fehl am Platze. Texte
des „offiziellen“ Stils sind durch die imperativische Modalität gekenn-
zeichnet. Verfolgen wir das an einigen Beispielen. Als erstes nehmen wir
die folgende Miniatur von F. Kafka:
Die Vorüberlaufenden
Wenn man in der Nacht durch eine Gasse spazierengeht und ein Mann, von
weitem schon sichtbar — denn die Gasse vor uns steigt an und es ist Voll-
mond — uns entgegenläuft, so werden wir ihn nicht anpacken, selbst wenn er
schwach und zerlumpt ist, selbst wenn jemand hinter ihm läuft und schreit,
sondern wir werden ihn weiter laufen lassen.
Denn es ist Nacht, und wir können nicht dafür, dass die Gasse im Vollmond
vor uns aufsteigt, und überdies, vielleicht haben diese zwei die Hetze zu ihrer
Unterhaltung veranstaltet, vielleicht verfolgen beide einen dritten, vielleicht
wird der erste unschuldig verfolgt, vielleicht will der zweite morden, und wir
werden Mitschuldige des Mordes, vielleicht wissen die zwei nichts voneinan-
der, und es läuft nur jeder auf eigene Verantwortung in sein Bett, vielleicht sind
es Nachtwandler, vielleicht hat der erste Waffen.
Und endlich, dürften wir nicht müde sein, haben wir nicht so viel Wein ge-
trunken? Wir sind froh, dass wir auch den zweiten nicht mehr sehen.
Das Modalnetz dieses Textes besteht aus Verben im Indikativ, die die
Modalität der Wirklichkeit ausdrücken, zwei Verben im Präterit Kon-
junktiv (würden, dürften), die die irreale Möglichkeit wiedergeben, und
dem Modalwort „vielleicht“, dem Ausdrucksmittel der Annahme. Die
Wahl der Modalitätsarten ist natürlich durch den Inhalt des Textes be-
dingt.
Der lyrische Held überlegt sich verschiedene Varianten seiner Reak-
tion auf die erlebte Episode, indem er immer neue Entschuldigungen für
seine Untätigkeit und Passivität findet.
Die Umschaltung auf eine neue Erläuterung der Situation, auf eine
neue Annahme erzeugt bei dem Leser den Eindruck der Dyna-
mik. Den Gegensatz zur statischen, passiven Position des lyrischen
Helden bildet die Dynamik, die Beweglichkeit seiner Gedanken, die mit
Hilfe eines rhythmischen Zeitformenwechsels betont
wird: das Präsens, das Futur, das Perfekt, das Präterit Indikativ und das
Präterit Konjunktiv wechseln einander ab. Die Bedeutung entsteht auch
dank dem Modalitätswechsel: die Modalität der Wirklichkeit im
ersten Absatz wird durch die Modalität der Annahme des zweiten Absat-
324
zes ersetzt und erscheint im Schluss des Textes wieder. Das Modalnetz
verstärkt auch den Eindruck des rhythmischen Erzählens: das
sieben Male wiederholte Modalwort „vielleicht“, ein Ausdrucksmittel
der Annahme, trägt dazu bei.
Die Alltagsrede ist, wie gesagt, durch einen mehrmaligen Moda-
litätswechsel gekennzeichnet. Das können wir am Beispiel eines Tele-
fongesprächs beobachten:
A.\ Guten Tag, hier ist A. Ich wollte einen Termin für eine Kurzbehandlung
ausmachen. Is noch irgendetwas frei nächste Wache?
B.: Momentchen bidde, ich guck ma nach, ja, ich stell ma nach vorne
durch... Ginge bei Ihnen jetzt ab Dienstag?
A.: Dienstag, hm...
B.: Beziehungsweise, Mittwoch wär besser!
A.-. Ja, Mittwoch ginge für mich wenn, ö, ginge vormittags, wenn ich bis
11 Uhr rauswär, dass ich dann noch in die Uni kann.
B.: Ja, ich trage Sie dann schon für 9 Uhr ein, ja?
A.-. Ja, das wär gut.
B:. Un Sie wissen ja, falls was dazwischen kommen sollte, rufen Sie bitte
vorher an, ja.
A.: Ja klar, is gut... Dankeschön.
B.: Bitteschön, widderhörn.
(A. Brons-Albert. „Gesprochenes Standarddeutsch“)
Dieses Gespräch ist in modaler Hinsicht bunt. Das Mitteilen einer
Information, das Erfragen der fehlenden Information, der Ausdruck ei-
nes Wunsches, einer Möglichkeit oder der Annahme werden mit Hilfe
des Indikativs und des Konjunktivs gestaltet. Zahlreiche Übergänge von
einer Form zur anderen charakterisieren die Alltagsrede und machen sie
lebendig, unbefangen, expressiv und ausdrucksvoll.
Anders ist die modale Struktur eines Presseberichts-,
In deutschen Büros bellt nicht mehr nur der Chef. Acht Prozent der Deut-
schen nehmen ihr Haustier regelmäßig mit zur Arbeit. Die unzertrennlichsten
Tierfreunde sind die selbstständigen: 37 Prozent von ihnen teilen ihren Arbeits-
tisch mit Bello & Co. („Bunte“, 2003, Ne 28)
Das Modalnetz des Textes besteht aus folgenden Gliedern: bellt
nicht... nehmen mit... sind... teilen. Das Anliegen des Autors besteht im
Mitteilen einer Information. Er informiert die Leser, wenn auch mit ei-
nem Schuss Humor, über eine neue Erscheinung, indem er die Verben
im Indikativ gebraucht und dadurch seine Mitteilung als real und
wahrheitsgetreu gestaltet.
Das Modalnetz eines Textes aus der Zeitung oder der Zeitschrift
kann auch Modalwörter enthalten, die die Einstellung des Autors zum
Inhalt des Artikels demonstrieren und nicht selten emotional ein-
schätzen (wahrscheinlich, angeblich, sicher, gewiss u. a.).
Der wissenschaftliche Text strebt, wie gesagt, nach der Ob-
jektivität und vermeidet jegliche emotionale Färbung:
325
Als zuerst erschienener Band eines Unternehmens von sechs Bänden, in der
Reihenfolge eigentlich als zweiter angekündigt, liegt die Monographie über die
deutsche antifaschistische Emigration in der Schweiz vor. W. M., Leiter des
Gesamtprojekts, schickt den sechs Bänden ein Vorwort voraus, aus dem hervor-
geht, dass die Form einer Darstellung nach Ländern gewählt wurde, und dass
es auf diese Weise neben reinen Ein-Land-Monographien auch eine einen gan-
zen Erdteil erfassende Darstellung (Lateinamerika) geben wird und einige, auf
den ersten Blick etwas rätselhaft wirkende Verknüpfungen, z.B. Skandinavien,
England und Palästina in einem Band, oder Frankreich, die Niederlande und
die Tschechoslowakei in einem anderen... („Deutsch als Fremdsprache“)
In diesen zwei Sätzen, die so trocken und verwickelt wirken, werden
folgende Glieder des Temporalnetzes gebraucht: ...liegt vor... schickt
voraus... hervorgeht... gewählt wurde... geben wird... Die Verben stehen
also im Indikativ und verzeichnen die objektive Wirklichkeit der darge-
stellten Situation. Sowohl nach ihrer Semantik als auch nach der stilisti-
schen Färbung entsprechen die Verben den Anforderungen an einen
wissenschaftlichen Text: sie wirken sachlich und drücken weder Ex-
pressivität noch Emotionalität des Autors aus.
Literaturnachweis
1. Brons-Albert R. Gesprochenes Standarddeutsch: Telefondialoge. — Tü-
bingen, 1984.
2. Große E. U. Text und Kommunikation. — Stuttgart, 1976.
3. Moskalskaja O.I. Textgrammatik. — Leipzig, 1984.
4. Moskalskaja O. I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. — M.,
2004.
5. FajibnepuH H.P. MojiajibHOCTb Texcra // COopHWK Hayq. Tp. MITIHIMI
hm. M.Topeaa. — 1978.— Bbin. 158.— C. 123 — 128.
6. jjoHCKoea O.A. CpejicTBa Bbipa^cenwa KaTeropww MOjiajibHOCTM b upaMa-
TypmHecKOM Texcre (na MaTepnajie aHTJio-äMepHKaHCKoft .upaMbi XX Bexa):
ABTOpe(j)epaT «uncc. ... Kami. (Jjhjioji. HayK. — M., 1982.
7. Hosdpuiia JI. A. riosTHKa rpaMMaTHHecxnx xaTeropnü: Kypc jiexuHft no
HHTepnpeTaunn xynoxecTBeHHoro rexcra. — M., 2004.
8. Typaeea 3.H. JlnHrBHCTnxa rexcra w KaTeropnn MOjiajibHOCTH // Bo-
npocbi H3biKO3HaHHH. — 1994. — Ne 3. — C. 105—114.
FORSCHUNGSAUSBLICK
Wr beginnen unsere Überlegungen mit den Worten von Georg Wil-
helm Friedrich Hegel: „Jede Philosophie ist zu ihrer Zeit erschienen. Es
kann kein Individuum über seine Zeit hinaus; seine Zeit enthält das
Prinzip seines Geistes.“
Die deutsche Stilistik kennt mehrere Namen, die zu ihrer Entwick-
lung beigetragen haben. Jede Zeitperiode brachte neue Talente und
neue Tendenzen, die die Stilistik als eine selbstständige Disziplin präg-
ten. Die Linguistik von Heute mit ihrem Interesse für den Ganztext und
für die intertextuellen Beziehungen stützt sich auf das schon Erreichte
und geht weiter in ihrem Streben, die menschliche Sprache in all ihren
Erscheinungsformen und Facetten zu ergründen. Einige ihrer Wege
möchten wir näher behandeln.
Der Begriff „das grammatisch-lexikalische Feld“, der in den 70er Jah-
ren von E. W. G u 1 y g a und E. I. S c h e n d e 1 s für die deutsche Spra-
che ausgearbeitet wurde, fand in den 90er Jahren seine weitere Entwick-
lung. Mit der Entstehung der Textlinguistik wurde es möglich, diesen
Begriff auf den Ganztext auszudehnen. So entstanden die Textnetze als
Realisierung des Feldes in einem konkreten Text.
Die nächste Stufe in der Untersuchung des Feldes/Netzes war die
Idee über ihren systemhaften Charakter und über die Beziehungen, die
zwischen den Textstrukturen im Prozess der Textgestaltung entstehen.
Es wurden die so genannten „Tiefenkategorien“ untersucht und be-
schrieben, die die inhaltliche Struktur des Textes konstituieren. Zu den
Tiefenkategorien gehören:
— die Kategorie des Chronotopos, die sich aus dem Zusammenspiel
der temporalen und lokalen Strukturen ergibt;
— die Kategorie der Koordinaten, die aus dem Zusammenwirken von
drei Strukturen entsteht, und zwar der temporalen, lokalen und perso-
nalen Struktur des Ganztextes;
— die Kategorie der Deixis, die sich aus vier Textstrukturen zusam-
mensetzt: aus der temporalen, der lokalen, der personalen und referen-
tiellen;
— die Kategorie der Sichtweise, aus fünf Strukturen bestehend: der
temporalen, der lokalen, der personalen, der referentiellen und der mo-
dalen.
Diese Kategorien haben folgende Charakteristiken:
327
1. Sie sind Kategorien der Poetik Unter der Poetik verste-
hen wir die Struktur der Beziehungen, die unter den Textelementen be-
stehen.
2. Sie sind Kategorien der Tiefenebene. Sie liegen nicht
auf der Oberfläche und können nicht unmittelbar beobachtet werden,
sondern nur durch die Untersuchung der Oberflächenstrukturen.
3. Sie sind universell, d.h. jedem Text eigen, unabhängig von
dem Genre oder dem Funktionalstil.
4. Sie stellen ein System dar, indem sie ineinander eingeschlossen
sind: die Kategorie des Chronotopos ist einerseits selbstständig, ande-
rerseits ist sie ein Bestandteil der Kategorie der Koordinaten. Die letzte
ist ebenfalls selbstständig und zugleich der Bestandteil einer größeren
Kategorie der Deixis. Diese Kategorie wird als eine selbstständige sowie
als eine im Bestand der nächsten Kategorie, der Kategorie der Sichtwei-
se, behandelt.
5. Die Tiefenkategorien haben den kognitiven Charakter:
sie helfen dem Menschen die Welt zu verstehen, sich darin zu orientie-
ren und das Weltbild des Sprechenden oder des Schreibenden als Sub-
jektes der Sprechtätigkeit kennen zu lernen. Sie erfüllen im Text ver-
schiedene Aufgaben, darunter auch genrespezifische, literarisch-stilisti-
sche u. a.
Die Aufgabe der Linguistik besteht u. E. unter anderem darin, die
Besonderheiten und die Eigenartigkeit der Tiefenkategorien in den ver-
schiedenen Funktionalstilen und Genres zu beschreiben.
In den 70er und 80er Jahren entwickelte sich die Textlinguistik rasch
als eine neue Disziplin mit ihrem eigenen Gegenstand, Objekt und eige-
nen Aufgaben. Die Untersuchung des Mikro- und Makrotextes, die Be-
stimmung ihrer Grenzen und die Delimitation, die innere Struktur und
die Gesetzmäßigkeiten ihres Aufbaus standen im Mittelpunkt der For-
schungen.
Heute spricht man immer öfter vom Diskurs. Es gibt vorläufig keine
einheitliche Definition. Der Diskurs ist doch eine komplizierte Erschei-
nung. Bis heute sind weder seine Grenzen noch seine Struktur und Ka-
tegorien bestimmt. Aber das neue, kognitiv-diskursive Paradigma, das
heutzutage in der Wissenschaft immer deutlicher zu spüren ist, verlangt
nach einer Lösung dieser Fragen. Ohne Zweifel findet auch die Stilistik
ihr Interesse an diesem neuen Forschungsobjekt.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort..............................................................3
Einführung...........................................................5
Teil I
WORT UND WORTKONFIGURATIONEN ALS QUELLE
STILISTISCHER EFFEKTE
Kapitel 1. Zum Wesen der stilistischen Phänomene..................9
§ 1. Stilistische Qualitäten der sprachlichen Einheiten..............9
§ 2. Stil und Expressivität..........................................11
§ 3. Stil als aktualisierte Variationsmöglichkeiten.................12
§ 4. Stilelemente...................................................15
§ 5. Determinanten des Stils....................................... 17
Kapitel 2. Stilnonnen............................................21
§ 6. Zum Begriff der Stil norm.......................................21
§ 7. Stilistische Schichtung des deutschen Wortschatzes.............23
§ 8. System von Stilfarbungen.......................................26
Kapitel 3. Stilwerte und Stilzüge...............................28
§ 9. Stilwerte......................................................28
§ 10. Stilzüge als Zusammenwirken von Stilelementen................30
Kapitel 4. Funktionale Stile.....................................34
§11 . Funktional bedingte Typisierungsmöglichkeiten des Stils.....34
§ 12. Kurzer Umriss der funktionalen Stiltypen....................35
Kapitel 5. Der deutsche Wortschatz zu stilistischen Zwecken......48
§13 . Die Bedeutung der Wortwahl..................................48
§ 14. Systemhafte Organisation des deutschen Wortschatzes.........50
§15 . Synonymisches Verhältnis als Basis der Wortwahl.............54
§16 . Erstarrte phraseologische Wendungen als stilistische
Verwertung der Synonymie.......................................59
§ 17. Stilistische Werte der Zwillingsformeln.....................63
§18 . Stilistische Werte einfacher phraseologischer Wendungen.....69
§19 . Stilistische Leistungen der Homonymie.......................72
§ 20. Stilistische Leistungen der Antonymie.......................74
§21 . Das einheimische Wort unter dem Andrang
des Fremdländischen.................................................77
329
Kapitel 6. Wortschatz mit besonderem Geltungsbereich.............83
§ 22. Stilistische Werte des allgemeinen Wortschatzes...............83
§ 23. Der Fachwortschatz und seine stilistische Verwertung.........85
§ 24. Einfluss von Fachsprachen auf die Gemeinsprache...............92
§ 25. Sozial-, territorial-, alters- und geschlechtsmarkierte
Ausdrucksweisen als Widerspiegelung der gesellschaftlichen
Verhältnisse..................................................101
§ 26. Zeitliche und individuell schöpferische Ansätze
im Wortgebrauch....................................................118
Kapitel 7. Stilistische Mittel und Verfahren zur Steigerung
der Anschaulichkeit und Wirksamkeit der Rede.......................129
§ 27. Anschaulichkeit durch Detailangabe und Beiwort...............129
§ 28. Der Vergleich und seine stilistischen Werte..................132
§ 29- Stilwirkungen der Metapher...................................135
§ 30. Personifikation und Synästhesie als wichtigste
Erscheinungsformen der Metapher....................................143
§31. Stilistische Wirkungen der Metonymie........................145
§ 32. Untertreibungen und Übertreibungen..........................148
Kapitel 8.Darstellungsarten,Texttypologien.........................150
§ 33. Allgemeines zu den Darstellungsarten........................150
§ 34. Traditionelle Auflassung von Texten und Textklassifikation.153
§ 35. Zum Begriff „Textsorte“, „Textexemplar“. Texttypologie
von B. Sandig.................................................156
§ 36. Brieflich-mitteilende Textformen.............................160
§ 37. Beschreibende Textformen....................................169
§ 38. Berichtende Textformen......................................171
§ 39. Erzählende Textformen.......................................172
§ 40. Erörternde Textformen.......................................173
§41. Schildernde Textformen.......................................175
§42. Betrachtende Textformen.....................................177
Teil II
TEXTGRAMMATISCHE ASPEKTE DER STILISTIK
Kapitel 9. Der Text als Objekt textlinguistischer Forschung.....180
§ 43. Textlinguistik und ihre Bestandteile........................180
§ 44. Der Makrotext und der Mikrotext. Ihre Kategorien............181
Kapitel 10. Die Komposition des Makrotextes.....................188
§ 45. Die Komposition und die Architektonik.......................188
§ 46. „Starke Positionen“ im Text (der Titel, das Epigraf,
der Anfang, der Schluss)...........................................192
Kapitel 11. Sprachliche Einheiten im Text und ihre stilistische
Leistung 206
§ 47. Das Fonem...................................................206
§ 48. Das Morphem.................................................209
§ 49. Das Wort. Das Substantiv. Ausdrucksmittel des Nominalstils... 212
330
§ 50. Der Artikel.................................................218
§51. Das Adjektiv................................................222
§ 52. Das Pronomen................................................229
§ 53. Das Numerale................................................235
§ 54. Das Partizip................................................238
§ 55. Das Verb....................................................242
§ 56. Die Inteijektion............................................251
Kapitel 12. Syntaktische Einheiten im Text und ihre Stilwerte...254
§ 57. Der Satz. Der Satzumfang....................................254
§ 58. Wiederholung der Satzstruktur...............................259
§ 59. Verblose Sätze....,.........................................263
§ 60. Die Parzellierung...........................................265
§ 61. Die Aussage-, Frage- und Aufibrderungssätze.................266
Kapitel 13. Der Text. Die temporale Struktur des Textes.........268
§ 62. Die Kategorie der Zeit und ihre Aspekte.....................268
§ 63. Monotemporale und polytemporale Texte.......................273
§ 64. Die Kategorie der Zeit in verschiedenen Funktionalstilen....281
§ 65. Das Temporalnetz und seine Aufgaben im Text.................287
Kapitel 14. Die lokale Struktur des Textes......................293
§ 66. Der Raum als eine Kategorie der Poetik......................293
§ 67. Der linguistische Aspekt der lokalen Textstruktur...........296
§ 68. Das Lokalnetz. Monolokale und polylokale Texte..............297
§ 69. Die Aufgaben des Lokalnetzes................................300
Kapitel 15. Die personale Struktur des Textes...................304
§ 70. Einige Aspekte der Kategorie der Person.....................304
§71 . Das Personalnetz des Textes und seine Aufgaben.
Monopersonale und polypersonale Texte.........................308
Kapitel 16. Die referentielle Struktur des Textes...............312
§ 72. Der Begriff „Referenz“......................................312
§73. Das Referenznetz. Monoreferentielle und polyreferentielle
Texte..............................................................313
§ 74. Die Aufgaben des Referenznetzes in verschiedenen
Funktionalstilen...................................................315
Kapitel 17. Die modale Struktur des Textes......................318
§ 75. Die Kategorie der Modalität und ihre Aspekte................318
§ 76. Monomodale und polymodale Texte.............................320
§ 77. Das Modalnetz und seine stilistischen Aufgaben
in verschiedenen Funktionalstilen.............................323
Forschungsausblick.................................................327
VueÖHoe ujdaHue
EoraTbipeBa Hnua ÄJieKceeBHa,
Ho3jipHHa JIioAMHJia AjieKcaiupoBHa
CTMJiMCTWKa coßpeMeHHoro HeMeuKoro B3biKa
Stilistik der deutschen Gegenwartssprache
YueÖHoe nocoöne
PejiaKTop A. B. Oey/ibvaHCKax
OTBercTBeHHbiii pejjaKTOp H. II. lajiKUHa
TexHHHecKMM peaaicrop O. H. Kpaünoea
KoMnbioTepHaa BepcTKa: T. A. Kaumchko
KoppeKTOp B.JJ.Jlezmnpee
JlHano3HTHBhi npeßocraBJieHH wa^aTejibCTBOM.
W3ji. No A-1453-I. FIo^nMcaHO b nenaTb 19.07.2005. OopMaT 60 x 90/16.
ByMara Tun. 2. FleqaTb o^ceTHaa. PapmiTypa «TaÜMC». Yen. neq. ji. 21,0.
Tnpa>K 3000 3K3. 3aKa3 N? 15274.
H3naTejibCKMH ueHTp «AKa^eMHH». www.academia-moscow.ru
CaHWTapHO-anHAeMMonorwqecKoe 3aKJnoqeHne .Ns 77.99.02.953./I.004796.07.04 ot 20.07.2004.
117342, MocKBa, yn. Eyrnepoßa, 17-E, k. 360. Teji./(J)aKc: (095)330-1092, 334-8337.
OrnenaTaHO b OAO «CapaTOBCKnii nojiMrpatJiHqecKMii KOMÖHHaT».
410004, r. CapaTOB, yji. HepHbimeBCKoro, 59.
ACADEMA
Khmfm WaflaTejibCKoro ijeHTpa
«AKAßEMMSI»
MOXHO npMO6peCTM
B po3HMQy:
• BbicTOBKa-npOAaxa nnTepaTypbi M3jiaTenbCTBa
(Mockbo, yn. HepHfixoBCKoro, 9, scanne klHCTmyra posbmtma
npocJjeccMOHanbHora o6pa3OBaHMfl). Ten./4>aKc: (095) 152-1878
• KnMXHbiH KJiy6 «Ojimmommckhm» (Mockbo, Ojimmfimmckhm np-T, 16,
5-fi bto>k, MecTO 20; 3-h bto>k, mccto 166)
• Khhxhoh apMOpKO na TyjibCKOki (Mockbo, BapujOBCKoe Luocce, 9,
MarasMH-cKJiaji «MapKo»)
• MoCKOBCKMM flOM KHMTM (MOCKBO, yn. HoBbIM Ap6aT, 8)
• floM nexiarorMHecKOM khmtm (Mockbo, yn. 5. /Jmutpobko, 7/5; yn. KysneuKMM moct, 4)
• ToproBbiä flOM «5n6nno-rna6yc» (Mockbo, yn. MacHPfLiKaa, 6)
• floM TexHMHecKOki KHnrn (Mockbo, JIchmhckum np-T, 40)
• JJ.OM MeAMUMHCKOki KHMrM (MOCKBO, KoMCOMOnbCKMM Hp-T, 25)
• Mara3MH «5n6nnoc(t)epa» (Mockbo, yn. Mopkcmctckoh, 9)
• CeTb Mara3MHOB «Hobhm KHMXHbiw» (Mockbo, CyxopeBCKOH nn., 12;
BonrorpoflCKMM np-T, 78)
OmroM:
• Mockbo, yn. ByrnepoBO, 17-5, 3-ä btox, k. 360 (scanne r/FI «KHnroBKcnopT»).
Ten./4>OKc: (095) 334-7873, 330-1092, 334-8337.
E-mail: sales@academia-moscow.ru
• Mockbo, ABTOMo6nnbHbifi np-fl, 10 (TeppnTOphA P/n «TaraHCKoe»).
Ten./4>OKc: (095) 975-8927, 975-8928. E-mail: sales@acodemia-moscow.ru
• CaHKT-FleTep6ypr, na6. OÖBojjHoro KOHOna, 211-213, nMTep «B».
Ten./4>aKc: (812) 259-6229, 251-9253. E-mail.fspbacod@peterstar.ru
(onTOBO-pO3HMHHOH TOprOBnfi)
EoraTbipeBa Huna AneKceeBHa -
KaHflwflaT (fimiojiornHecKMX HayK, npoc^eccop
Kacjjeflpbi JinHrBncruKU h npocpeccnoHanbHon
KOMMyHHKaUHH B OÖJiaCTH 3KOHOMHKH MMY,
cneunajincr b o6nacTH KnaccnnecKon cthjihcthkh
H CTHJIHCTHKH TeKCTa. AßTOp MHOrOHHCJieHHblX
yHeÖHbix nocoßnü ßna cryfleHTOB-neflaroroB
H CTyfleHTOB-3KOHOMWCTOB.
Ho3ApiiHa JliojiMnjia AneiccaHApoBHa -
AOKTop (pujioJiornHecKMX HayK, npocf)eccop Kacpeßpbi
rpaMMaTHKH h ncTopnn HeMeuKoro A3biKa MTJiy,
cneu,na/iMCT b o6jiac™ cwjihcthkh uejiocrHoro
TeKcra. Abtop 6ojibuioro KOJinHecrea ny6nnKauwüi
b oönacTH rpaMMaTHKH TeKcra n xanpoßon
cneun^HKH TeKCTa.
CTHAHCTJ4KA COBPEMEHHOFO
HEMELJKOrO H3BIKA
STILISTIK DER DEUTSCHEN
GEGENWARTSSPRACHE
l/l3AaTeJlbCKMM LjeHTp «AKaAeMMfl»
www. academia-moscow. ru